1. Einleitung
-
-
Einführung zur Yogalehrer/innen ausbildung im YOGA V1ovA-Stil
Du hast dich für eine Yogalehrer/innenausbildung im ganzheit lichen yoga und den hatha-yoga-Stil YOGA VIovAs entschieden. In diesem Stil sind von uns bisher rund 17 000 Yogalehrende ausgebildet worden. Allein in Deutschland praktizieren rund eine halbe Million Menschen (bewusst oder unbewusst) nach dem YOGA VIDYA-Stil.
Möge dieses Handbuch dir ein guter Begleiter und Ratgeber für deine Ausbildung und später für deinen eigenen Yoga unterricht sein.
Wir wünschen dir viel Freude, Inspiration und Erkenntnis für deinen persönlichen und spirituellen Weg.
In der Yogalehrer/innenausbildung lernst du den ganzheitli chen yoga als praktisches und spirituelles Übungs- und Lehrsystem gründlich in Theorie und Praxis kennen. Neben den Zweigen jfiäna-yoga (yoga des Wissens}, räja-yoga (Kenntnis und Beherrschung der menschlichen Psyche}, bhakti-yoga (Herzensöffnung, Hingabe) und karma-yaga (selbstlosem Handeln im Alltag) lernst du natürlich vor allem, selbst hatha yoga im YOGA V1ovA-Stil zu unterrichten. Es gibt verschiedene Ausbildungsformen bei YOGA VIDYA, sodass du die Form wählen kannst, die am besten zu deiner Veranlagung passt und sich am besten in deinen Alltag integrieren lässt.
-
lntensivausbildung 4 Wochen am Stück oder 2x2 Wochen oder 4xl Woche
In früheren Zeiten lebte ein Schüler mit seinem Lehrer. Er wurde als Mitglied der Familie betrachtet und lebte und lernte bei seinem guru. Neben den täglichen Lektionen in Philosophie usw. lernte er auch die praktische Seite des yoga kennen: äsana, pränäyama und karma-yoga. Es wurde z. B. vom Schüler erwartet, das Haus seines guru zu betreuen und Holz zu sammeln - eben alles zu tun, was nötig war, damit die Familie überleben konnte.
Dieses guruku/a-System umfasste gewöhnlich ein Studium von zwölf Jahren. Der Schüler begann im Alter zwischen ca. fünf und sechzehn Jahren. Die YOGA V1DYA-Yogalehrer/innenausbil dung folgt diesem alten Modell. Im folgenden Monat wirst du mit deinen Lehrern und Mitschülern leben, arbeiten und ler nen.
Anstatt der zwölf Jahre wurde der Kurs, um ihn mit der moder nen Lebensweise in Einklang zu bringen, zu einem einmonati gen Programm verdichtet. Jeder Teil des Programms ist für das Ganze von äußerster Wichtigkeit. Daher ist die Anwesenheit bei allen Veranstaltungen überaus wichtig und aus diesem Grund wird die Anwesenheit überprüft.
Zweimal täglich, morgens und abends, ist Meditation. In der Meditation können wir das finden, wonach wir alle suchen: den „Frieden jenseits aller Vernunft". Durch Regelmäßigkeit werden gute Gewohnheiten geschaffen und verstärkt.
Dieser Monat gibt dir die ideale Gelegenheit, die Gewohn-
heit der täglichen Meditation zu festigen. Nach den Medi tationen kommt kirtana (mantra-Singen). Mantra-Singen reinigt die cakras (Energiezentren}, öffnet das Herz und bringt den Suchen-den in Kontakt mit dem Göttlichen. Nach dem Morgen-kirtana folgt ein Vortrag über Meditation und räja-yoga. Nach dem Abend-kirtana folgt ein Vortrag über jfiäna-yoga.
Die hatha-yoga-Stunde am Morgen mit äsanas, prär,ä yäma und Tiefenentspannung dient deiner eigenen Praxis. Sie trägt dazu bei, deinen Körper stark zu machen. Der Körper ist das Vehikel, um durch das Leben zu gehen. Er wird in diesem Monat einiger ungewohnter Anstrengung unterliegen. Es ist daher wichtig, ihn gesund zu erhalten. Außerdem wird der Kurs hoffentlich noch eine weitere gute Gewohnheit in dir aufbauen helfen: die tägliche äsana Praxis. Die hatha-yoga-Stunde am Nachmittag führt dich ins Unterrichten des hatha-yoga im YoGA VIDYA-Stil ein.
Bitte komme zu dieser und zu allen anderen Veranstaltun gen ohne vorgefasste Meinung; so wirst du für das Gelehrte offen und aufnahmefähig sein. Ein offener Geist und Bereit schaft zur Disziplin sind die wichtigsten Vorbedingungen für diese Yogalehrer/innenausbildung, wichtiger als Vorkennt nisse, körperliche Flexibilität etc.
Während der Ausbildung hast du auch Gelegenheit zu karma-yoga, selbstlosem Dienst. Das ist ein wesentlicher Bestandteil des Programms. Swami Sivananda sagte:
,,Manche Schüler behaupten, räja-yogis zu sein, sie glau ben, den ganzen Tag meditieren zu können, aber ihr Geist ist dafür nicht bereit. Sie verlieren sich nur in Tagträumen." Karma-yoga ist nötig, um Konzentration und W illenskraft zu entwickeln. Selbstloses Dienen reinigt den Geist und lässt uns die Einheit von allem erkennen.
Jeden Nachmittag um 14.00 Uhr findet der Hauptvortrag statt, in dem unter anderem verschiedene T hemen wie Philosophie und Physiologie erörtert werden.
-
2-Jahres-Ausbildung
In der 2-Jahres-Ausbildung lernst du die verschiedenen Aspekte des yoga kennen und in dein Leben zu integrieren. Die Kontinuität des Kurses und die feste Gruppe gewährleis ten eine systematische Schulung und eine individuelle Führung.
Der Kurs findet einmal pro Woche von 18.30 bis 22.00 Uhr, mit pränäyäma, Meditation, Besprechung, Theorie, äsanas, Tiefenentspannung, statt; ca. 21.45 Uhr Suppe/Salat und gemütliches Beisammensein. Die Zeiten variieren etwas in den einzelnen Zentren. Für jede Woche werden Übungen empfohlen und Aufgaben für das tägliche Leben gegeben. Im Unterrichtsplan findest du Buchausschnitte, die du bis zur nächsten Woche durcharbeiten solltest.
Etwa alle zwei Monate findet ein Wochenendseminar - oder alternativ zweimal jährlich eine lntensivwoche, je nach YOGA
7
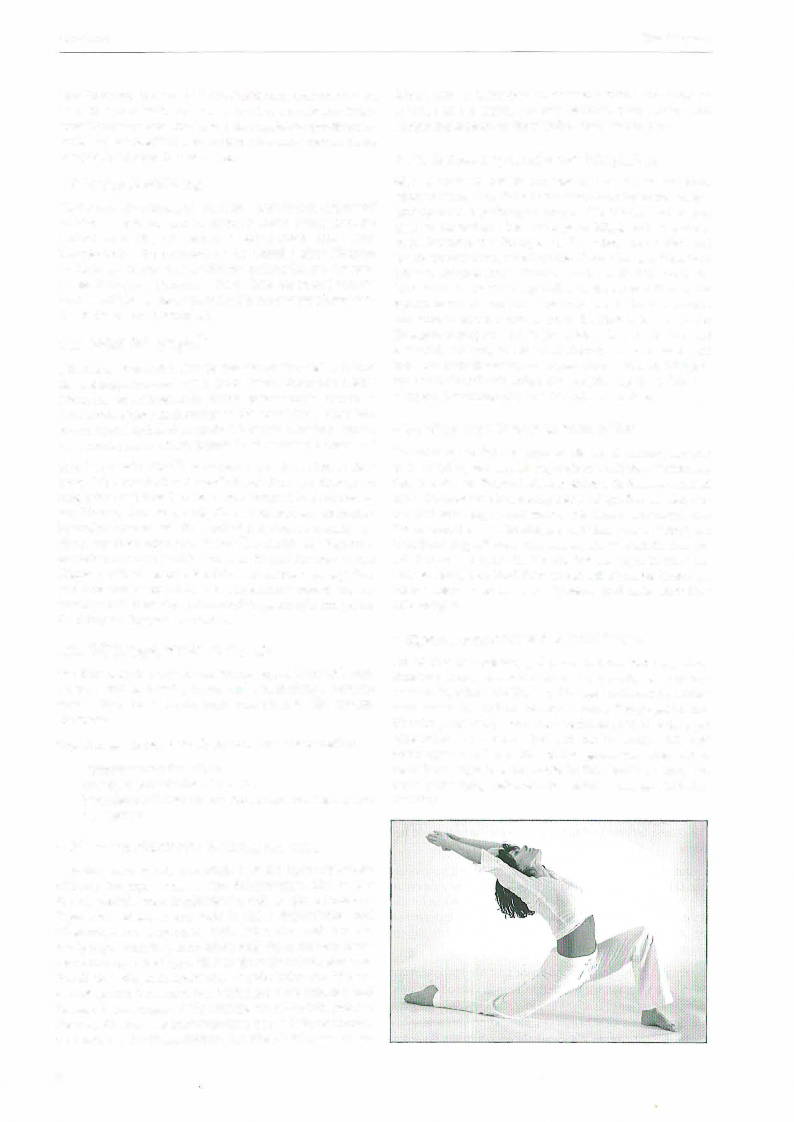
Einleitung
VIDYA-Zentrum, in dem du deine Ausbildung absolvierst - im Haus YOGA VIDYA statt, an dem du zu einer intensiveren Erfah rung kommen kannst. Besonders das kury;JalinT-yoga-Wochen ende und das Meditationsintensivwochenende werden deine Yogapraxis auf neue Ebenen heben.
-
3-Jahres-Ausbildung
Die 3-Jahres-Ausbildung ist ideal, um yoga wirklich umfassend zu üben, zu erfahren und im täglichen Leben umzusetzen. Sie besteht aus jährlich sieben Wochenenden und einer lntensivwoche. Sie verbindet so die Vorteile einer längeren Ausbildung wie individuelle Führung, Verinnerlichung der spiri tuellen Prinzipien, Umsetzung ins tägliche Leben und engerer Kontakt mit den anderen Teilnehmern mit der transformieren den Kraft von lntensivwochen.
-
-
-
Was ist yoga?
„Ein Gramm Praxis ist besser als Tonnen von Theorie" war einer der Lieblingssätze des Yogameisters Swami Sivananda (1887- 1963). Als Swami Sivananda einmal gefragt wurde, warum er dann so viele (über 200) Bücher geschrieben hätte, antwortete er verschmitzt lächelnd: ,,Manche Menschen brauchen Tonnen von Theorie, um zu einem Gramm Praxis angeregt zu werden."
Yoga ist ein sehr altes Übungssystem, das sich in Indien über lange Zeit entwickelt und bewährt hat. Auch im Westen ist yoga schon seit über hundert Jahren bekannt und hat bewei sen können, dass es gerade für den westlichen Menschen besonders wertvoll ist. Ein bewährtes System zu nutzen, hat einen entscheidenden Vorteil: Der Übende ist kein Versuchs kaninchen, sondern profitiert von dem Wissen darüber, wie die Übungen wirken, welche Vorsichtsmaß-nahmen zu ergreifen sind und was er beachten soll. Abgestimmt darauf, was er erreichen will, kann ein/e erfahrene/r Yogalehrer/in ihm genau die richtigen Übungen empfehlen.
-
Wirkungsebenen des yoga
Das Wort yogo kommt von der Wurzel yuj, ,,anschirren", ,,ver binden", und bedeutet „Anschirren", ,,Verbindung", ,,Vereini gung". Yoga wird heute auch interpretiert als Einheit, Harmonie.
Yogaübungen können dem Übenden zu dreierlei verhelfen:
-
Harmonisierung des Lebens
-
Erweckung schlafender Fähigkeiten
-
Vereinigung mit dem wahren Selbst und dem kosmischen Bewusstsein
-
-
Die harmonisierende Wirkung des yoga
In vielen wissenschaftlichen Studien ist die harmonisierende Wirkung des yoga erwiesen und dokumentiert. Dies ist der Grund, weshalb viele Krankenkassen sich an den Kosten von Yogakursen beteiligen und yoga in vielen Gesundheits- und Fitnessratgebern empfohlen wird. Jeder, der auch nur ein wenig yoga praktiziert, kann schon bald einige der wundersa men Wirkungen des yoga erfahren: ein vorher nicht gekanntes Gefühl der völligen Entspannung, Verschwinden von Rücken schmerzen und Kopfschmerzen, Reduzierung von Schulter- und Nackenverspannungen, mehr Energie, neue Vitalität, geistige Klarheit, Stärkung des Immunsystems, neues Selbstvertrauen, Verbesserung der Konzentration. Um diese Wirkungen zu er-
8
Was ist yoga?
fahren, kann es ausreichen, zu einer Yogastunde pro Woche zu kommen und vielleicht ein paar einfache Atem-, Dehn- und Entspannungsübungen ins tägliche Leben einzubauen.
-
-
Die Erweckung schlafender Fähigkeiten
Wer an mehr als der Harmonisierung von Körper und Geist interessiert ist, kann sich an eine intensivere Praxis von fortge schritteneren Yogaübungen wagen. Die Yogameister sagen, dass im Menschen viele verborgene Möglichkeiten schlum mern. Intensive Yogaübung kann Fähigkeiten wie Intuition und Kreativität aktivieren, künstlerische Fähigkeiten zum Vorschein bringen, geistige Kräfte, Charisma und persönliche Ausstrah lung erhöhen. Für einen yogT eröffnen sich andere Ebenen des Bewusstseins: Er kann die Lebensenergien in sich und manch mal auch in anderen wahrnehmen, ihr Kreisen in den cakras (Energiezentren) und när;iTs (Energiekanälen) bemerken und willentlich steuern, er bekommt Kontakt zur Astralwelt und kann das Körperbewusstsein transzendieren. Er kann Fähigkei ten wie Hellsichtigkeit, prä('lo-Heilung (Heilung durch Übertra gung von Lebensenergie) und Telepathie erwerben.
-
Vereinigung mit dem wahren Selbst
Das erhabenste Ziel des yoga ist die Verwirklichung unseres wahren Selbst, welches die yogTs als eins mit dem Göttlichen, dem kosmischen Bewusstsein, bezeichnen. So faszinierend und wünschenswert die Erweckung neuer Fähigkeiten auf den ers ten Blick sein mag, so sehr warnen die Yogameister davor, dies überzubewerten. Die Vereinigung mit dem wahren Selbst, die Verschmelzung mit dem Kosmischen, die Erkenntnis, dass wir mit Gott eins sind, ist das höchste Ziel des yoga. Es führt zur wahren Liebe, zum Gefühl der Einheit mit allem, zur Erfahrung reinen Seins, vollkommenen Wissens und unbeschränkter Glückseligkeit.
-
Eigenverantwortung des Individuums
Um all dies zu erreichen, gibt yoga die Verantwortung jedem Einzelnen. Jeder kann selbst etwas tun, um sein Leben zu ver bessern. Yoga hat eine Fülle von Übungen und Praktiken. Jeder muss selbst entscheiden, wie weit er/sie mit yoga gehen will. Wer sich „nur" entspannen und wohlfühlen will, ist beim yoga willkommen und kann dies mit relativ wenig Zeit und Anstrengung erreichen. Wer weiter gehen will, muss etwas mehr üben. Yoga ist keine magische Pille, sondern etwas, das durch geduldiges, systematisches Training zum gewünschten Ziel führt.
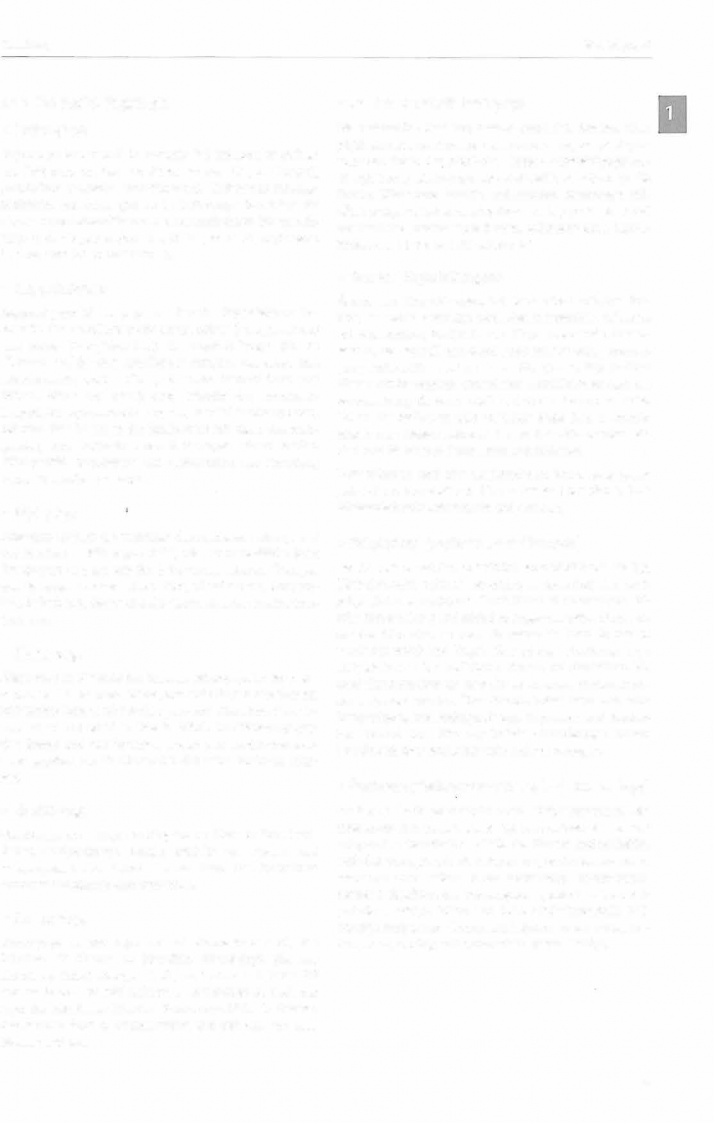
Einleitung
1.2.2 Die sechs Yogawege
-
Hatha-yoga
Hatha-yoga ist der wohl bekannteste Teil des yoga. Er umfasst die körperorientierten Praktiken: asanas (Yogastellungen), pra,:iayama (yogische Atemübungen), Tiefenentspannungs techniken. Außerdem gibt es im hatha-yoga Ratschläge für eine gesunde Lebensführung, u. a. vegetarische Vollwerternäh rung. In der Yogalehrer/innenausbildung lernst du, hatha-yoga im YOGA V1DYA-Stil zu unterrichten.
-
Kur:i<;lalini-yoga
Ku,:i<;ialinT-yoga ist der yoga der Energie. Ku,:i<;ialinT-yoga be schreibt den Astralkörper mit seinen cakras (Energiezentren) und na<;/Ts (Energiekanälen). Im ku,:i<;ialinT-yoga gibt es Übungen, welche den Astralkörper reinigen, den pra,:ia (die Lebensenergie) stark erhöhen, die cakras harmonisieren und öffnen. Wenn wir bereit sind, erwacht die machtvolle ku,:i<;ialinT-Energie entweder langsam, allmählich oder spontan, plötzlich. Das Erwachen der ku,:i<;iolinT ist mit vielen überwälti genden, auch außersinnlichen Erfahrungen, einem starken Glücksgefühl, Erweiterung des Bewusstseins und Entfaltung neuer Fähigkeiten verbunden.
-
Räja-yoga
Raja-yoga umfasst die Techniken des mentalen Trainings und der Meditation. Raja-yoga erklärt, wie der menschliche Geist funktioniert und wie wir ihn beherrschen können. Übungen des raja-yoga umfassen Affirmation, Visualisierung, Achtsam keit, Selbstbeobachtung und die verschiedensten Meditations techniken.
-
Jfiäna-yoga
Jfiana-yoga ist der yoga des Wissens. Jfiana-yoga ist der philo sophische Teil des yoga. Jfiäna-yoga stellt Fragen wie: Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn des Lebens? Was ist wirklich? Was ist Glück? Im jfiana-yoga wer den karma und Reinkarnation erklärt und Meditationstech niken gegeben, um die Wahrheit in sich selbst intuitiv zu erfah ren.
-
Bhakti-yoga
Bhakti-yoga ist der yoga der Hingabe und Liebe zu Gott. Durch Gebet, mantra-Singen, Rituale, Erzählen von Mythen und Heiligengeschichten öffnet sich das Herz. Das Individuum kommt in Kontakt mit dem Göttlichen.
-
Karma-yoga
Karma-yoga ist der yoga der Tat. Karma-yoga lehrt, das Schicksal als Chance zu begreifen. Karma-yoga gibt uns Techniken, Entscheidungen richtig zu treffen und jeden Teil unseres Lebens zu spiritualisieren. Karma-yoga ist auch der yoga des selbstlosen Dienstes. Karma-yoga hilft, die Grenzen des eigenen Egos zu transzendieren und sich eins mit allen Wesen zu fühlen.
Was ist yoga?
1.2.3 Der ganzheitliche yoga
Die meisten heutigen Yogameister empfehlen den integralen yoga, eine Kombination der verschiedenen Yogawege: Hatha yoga entwickelt den physischen Körper, ku,:i<;ialinT-yogo den Energiekörper, bhakti-yoga den Gefühlskörper, räja-yoga die Psyche, jfiäna-yoga Intellekt und Intuition, karma-yoga hilft, alles ins tägliche Leben zu integrieren. So ist yoga ein wahrhaft ganzheitliches, umfassendes System. Jeder kann dabei heraus finden, was für ihn am hilfreichsten ist.
-
-
Äsanas (Yogastellungen)
Äsanas sind Körperübungen, bei denen eine bestimmte Stel lung eine zeitlang gehalten wird. Äsanas entwickeln auf sanfte Art Muskelstärke, Flexibilität und Körperbewusstsein. Interes sant ist, wie schnell man durch yoga mit nur wenig Anstren gung Fortschritte machen kann. Ein gleichmäßig flexibler Körper mit harmonisch entwickelter Muskelkraft ist auch die Voraussetzung für Gesundheit und Grazie. Durch das ruhige Halten der Stellungen wird gestauter pra,:ia (Lebensenergie) wieder zum Fließen gebracht, innere Heilkräfte werden akti viert und die inneren Organe besser durchblutet.
Yogastellungen sind eine ausgezeichnete Vorbeugung gegen jede Art von Krankheit und können andere Therapien in ihrer Wirksamkeit sehr unterstützen und erhöhen.
-
Prär:iäyäma (yogische Atemübungen)
Der Mensch atmet durchschnittlich etwa 25.920-mal am Tag. Über den Atem nehmen wir wichtigen Sauerstoff, aber auch prä,:ia (Lebensenergie) auf. Durch Stress, Verspannungen, fal sche Körperhaltung und schlechte Angewohnheiten atmen die meisten Menschen zu flach. So geben sie ihrem System zu wenig Sauerstoff und klagen über schnelle Ermüdung. Yoga hilft, wieder zu einer natürlichen Atmung zurückzukehren. Mit speziellen Atemübungen kann die Lebensenergie jederzeit wie der aufgebaut werden. Über Atemtechniken kann man auch Lampenfieber, unberechtigte Ängste, Depression und Reizbar keit überwinden. Wer regelmäßig Atemübungen macht, braucht sich über Müdigkeit nicht mehr zu beklagen.
-
Saväsana (Tiefenentspannung in d. Rückenlage)
Am Ende jeder Yogastunde gibt es eine Tiefenentspannung, die etwa 10-15 Min. dauert. Dabei liegt man auf dem Rücken und entspannt systematisch alle Teile des Körpers und schließlich auch den Geist. Gerade die Entspannung ist für den modernen Menschen entscheidend. In der Entspannung werden Stress hormone abgebaut, das Immunsystem gestärkt, Heilprozesse gefördert, geistige Stärke und Ruhe wiederhergestellt. Voll ständige Entspannung kommt nicht einfach so von selbst, son dern muss geduldig und systematisch gelernt werden.
9

Einleitung
1.2.4 Die sieben Prinzipien spiritueller Philosophie
Das von Sukadev Bretz entwickelte Konzept der sieben Grund prinzipien der Spiritualität kann man religionsübergreifend sehen- es beschreibt, was allen spirituellen Traditionen letzt lich gemeinsam ist, wenngleich jedes spirituelle System eine andere Sprache, andere Begriffe dafür benutzt.
-
Brahman (das Göttliche): Es gibt eine höhere Wirklichkeit, die hinter allem steckt. Diese höhere Wirklichkeit zu erfahren, ist eine tiefe Sehnsucht des Menschen.
-
Mäyä (Täuschung): So wie man die Welt im Normalbewusst sein wahrnimmt, so ist sie nicht. Das menschliche Wahrneh men, Denken und Fühlen ist fehlerhaft. Das Alltagsbewusstsein mag den Menschen als von der Schöpfung und von den ande ren Geschöpfen getrennt wahrnehmen, die Welt in Zeit und Raum erfahren- dies ist aber eine Täuschung, denn in Wahr heit ist alles miteinander verbunden und Manifestation des einen Göttlichen. Alles ist der Täuschung unterworfen, so kön nen wir alles mit einer gewissen Leichtigkeit und mit Humor anschauen.
-
Du�kha (existenzielles Leiden): Solange man der mäyä unter liegt, ist man im Leiden: Auf einer materiellen Ebene ist alles begrenzt, sterblich bzw. der Veränderung unterworfen und kann uns keine dauerhafte Befriedigung schenken. Leiden hängt nicht von den Umständen ab, sondern beruht darauf, dass man das Göttliche nicht verwirklicht hat.
-
Kaivalya bzw. mok$a (Erleuchtung, Gottverwirklichung, Selbstverwirklichung): Es ist möglich, das Göttliche vollständig zu erfahren, mit dem Göttlichen zu verschmelzen. Das ist Sinn und Zweck .des menschlichen Daseins. Bewusst oder unbe wusst strebt jeder Mensch nach der Erleuchtung- und ist des halb mit nichts anderem dauerhaft zufrieden. Meister/innen und Mystiker/innen aller spirituellen Traditionen erklären letzt lich: Es ist für jeden möglich, die Erleuchtung zu erlangen. Es ist es wert, danach zu streben.
-
Abhyäsa (spirituelle Praxis): Um zur Verwirklichung zu kom men, gilt es zu praktizieren, sich selbst zu bemühen. Es reicht nicht aus, Bücher zu lesen und zu hoffen. Vielmehr gilt es, Meditation und andere spirituelle Praktiken zu üben, und sich darin zu schulen, in allem das Göttliche zu sehen. Jede Tradi tion der Spiritualität hat dafür ihr eigenes Übungssystem ent wickelt.
-
Karma (Leben als Schule): Was auf uns zukommt, ist nicht einfach nur Zufall. Leben hat einen Sinn: Das Leben gibt dir genau die Erfahrungen, die du brauchst, um dich zu vervoll kommnen. Leben ist Schule. Das Schicksal ist dir geschickt, damit du daran wächst. Und es ist notwendig, dass du dich für eine gute Sache engagierst, um auf dem Weg der Spiritualität voranzuschreiten.
-
Krpä (kripa, Gnade): Du kannst dir die Erleuchtung nicht selbst erarbeiten, sie nicht erzwingen. Vielmehr kommt spiritu elle Erfahrung und Fortschritt auf dem Weg der Spiritualität als Gnade Gottes. Letztlich ist spirituelle Entwicklung ein Zusam-
10
Tradition
menspiel dieser drei Faktoren: abhyäsa (eigenes Bemühen), karma (Annehmen der Aufgaben des Lebens) und krpä (Öffnen für die göttliche Gnade).
-
-
-
-
Tradition
-
Swami Sivananda
(SvämT Sivänanda SarasvatT) wurde am 8. September 1887 in einer vornehmen Familie in Südindien geboren und hatte die natürliche Neigung, sein Leben dem Studium und der vedänta-Praxis zu widmen. Da zu kamen der angeborene Eifer zu dienen und ein Gefühl der Einheit mit allen Menschen. Obwohl er aus einer orthodo xen Brahmanenfamilie stamm
te, war er dennoch ausgesprochen tolerant und völlig frei von Kastendünkel und Vorurteilen. Swami Sivananda ging auf eine Missionsschule und kam so schon früh auch mit westlichem Gedankengut in Kontakt. Seine Leidenschaft zu dienen führte ihn auf die medizinische Laufbahn, und es trieb ihn vor allem in jene Teile der Welt, die seiner Hilfe am meisten bedurften. Er errichtete eine ausgezeichnete Praxis in Malaysia. Er gab auch eine Gesundheitszeitung heraus und schrieb ausführlich über Gesundheitsprobleme. Er stellte fest, dass den Menschen vor allem das rechte Wissen fehlte. Er sah die Verbreitung dieses Wissens als seine Mission an.
Es war göttliche Fügung und ein Segen Gottes für die Men schen, dass dieser Doktor für Körper und Seele auf seine Karri ere verzichtete und ein Leben der Entsagung aufnahm, um die Seelen der Menschen zu behandeln. Er siedelte sich 1924 in Rishikesh (��ikes) an, übte strenge Askese und erstrahlte als großer yogT, Weiser und erleuchtete Seele.
1934 gründete er den Sivananda Ashram (Sivänandäsram) und 1936 entstand die Divine Life Society. 1948 wurde die Yoga Vedanta Forest Academy eingerichtet. Verbreitung spirituellen Wissens und Unterweisung von Menschen in yoga und vedänta waren ihr Zweck und Ziel. Sivananda schrieb über 200 Bücher und hat Schüler auf der ganzen Welt, die allen Nationalitäten, Religionen und Glaubensbekenntnissen ange hören. Am 14. Juli 1963 erreichte er mahä-samädhi (Tod und gleichzeitige Selbstverwirklichung eines Meisters).
Swami Sivananda bildete zahlreiche Schüler aus, von denen viele selbst große Yogameister wurden. Seine wichtigsten Schüler waren/sind:
-
Swami Chidananda (1916-2008)
(ehemaliger Präsident der Divine Life Society, Rishikesh)
-
Swami Krishnananda (1922-2001)
(ehemaliger Leiter des Sivananda Ashrams, Rishikesh)
-
Swami Venkateshananda (1921-1982)
(Lieblingsschüler Sivanandas, lehrte in Australien und Südafrika)
-
-
Swami Satchidananda (1914-2002)
(Gründer von Integral Yoga Institute und Yogaville, USA)

Einleitung
-
Swami Chinmayananda (1916-1993) (Gründer der Chinmaya Mission)
-
Swami Jyotirmayananda (*1931)
(Präsident der Yoga Research Foundation in Miami, Florida)
-
Swami Vishnu-devananda (1927-1993)
(Gründer der International Sivananda Yoga Vedanta Zentren)
-
Andre van Lysbeth (1927-2004)
(belgischer Autor, verfasste mehrere Standardwerke über yoga, einer der Wegbereiter des yoga im Westen)
-
Boris Sacharow (1899-1959)
-
-
(wichtiger Wegbereiter des yoga in Europa, vor allem in Deutschland)
-
Swami Vishnu-devananda
(Svämi Vi$QUdevänanda) wurde am 31. Dezember 1927 in Kerala, Südindien, geboren. Während seines Dienstes in der indischen Armee kam er 1944 in Kontakt mit seinem zukünftigen Meister, Swami Sivananda. 1947-1957 lebte er im äsram von Swami Sivananda in Rishi kesh (f3,$ikes), unterbrochen von längeren Zeiten als parivrajaka (Wandermönch) und als Ein
siedler in Klausur zur intensiveren eigenen Übung. Er betrieb besonders intensive hatha-yoga-Praktiken und wurde zum hatha-yoga-Lehrer des asrams. Swami Sivananda sandte ihn mehrmals auf Vortragsreisen.
Als Swami Vishnu-devananda im Jahre 1957 auf einer dieser Reisen erstmals nach Amerika kam, sah er, dass auch der Westen reif für den yoga war. So blieb er gleich dort und grün dete seine eigene Organisation mit Hauptsitz in Val Marin bei Montreal (Kanada), die er International Sivananda Yoga Vedanta Centres (ISYVC) nannte. Er eröffnete viele Zentren in Nordamerika, Europa und später in Indien und begann 1969 die erste systematische Yogalehrer/innenausbildung im Westen. An diese von ihm begründete vierwöchige lntensiv ausbildung lehnen wir uns mit diesem Kurs stark an.
Er engagierte sich auch sehr in der Friedensbewegung und organisierte mehrere Friedenskampagnen, darunter 1971 einen Friedensflug von Israel nach Ägypten und 1983 einen Flug im Ultraleichtflugzeug über die Berliner Mauer. 1993 starb Swami Vishnu-devananda auf einer Pilgerreise in Indien.
-
Sukadev Bretz
Sukadev Volker Bretz (*1963) ist der Gründer und Leiter von YOGA VroYA. Er praktiziert seit 1980 yoga und wurde 1981 zum Yogalehrer ausgebildet. Er lernte zwölf Jahre bei Swami Vishnu devananda und war zeitweise auch dessen Assistent. Bis 1991 leitete er verschiedene Sivananda Yoga Vedanta Zentren in den USA, Kanada und in Europa. Um einen ganzheitlichen, lebens nahen yoga in Deutschland zu lehren, gründete er 1992 mit Eva-Maria Kürzinger das „Yoga Center am Zoo" in Frankfurt. Später wurde es dann in „YOGA VrovA Zentrum Frankfurt am Main" umbenannt. Gerüstet mit rund vier Jahrzehnten an Erfahrungen versteht es Sukadev wunderbar, sein Wissen und
Tradition
seine spirituelle Erfahrung an schaulich, humorvoll, struktu riert und praxisbezogen in sei nen Yogaseminaren weiterzu geben. Durch seine Vorträge und seine persönliche Aus strahlung schenkt er dir viel Inspiration und ein tiefes Ver ständnis des yoga und des spiri tuellen Weges.
Sukadev Bretz ist erster Vorsitzender des Berufsverbandes der YOGA VrovA Lehrer/innen (BYV), Buchautor (bzw. lntiator) von
„Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute", ,,Das Yoga Vidya Asana-Buch", ,,Die Kundalini-Energie erwecken",
,,Karma und Reinkarnation", ,,Yoga Geschichten", ,, Der Königs weg zur Gelassenheit", ,,Die Bhagavad-Gita für Menschen von heute", ,,Das große Yoga Vidya Hatha Yoga Buch" etc. sowie Sprecher und Anleiter auf vielen CDs und DVDs.
-
YOGA VIDYA
Heute ist YOGA VroYA Europas größtes Institut für Yogalehrer/ innen. Im September 1993 begann die erste 2-Jahres Ausbildung für Yogalehrer/innen. Im Dezember fand das erste ku0qalinT-yoga-lntensivseminar statt. Seit 1994 bietet YoGA V1ovA zusätzlich auch Yogawochen und -wochenendseminare sowie Yogaferien in angemieteten Seminarhäusern an. 1995 wurde der YOGA VrovA VERLAG gegründet und die ersten eigenen Yogabücher, -videos und -kassetten (heute in Form von DVDs und CDs) wurden herausgegeben. Heute verwaltet der Verlag über 100 Titel.
1995 wurden die bei.den Vereine YoGA VrovA e. V. und Berufsver band der YoGA VrovA Lehrer/innen e. V. (BYV) gegründet. Gleichzeitig fand YOGA VrovAs erste vierwöchige Yogalehrer intensivausbildung nach dem bewährten Konzept von Swami Vishnu-devananda statt, das 5ukadev Bretz bereits seit vielen Jahren unterrichtet und weiterentwickelt hatte.
Um den an yoga interessierten Menschen die Möglichkeit zu geben, yoga abseits vom Alltag kennenzulernen und zu erle ben, wurde 1997 ein eigenes YOGA V1ovA-Seminarhaus im Westerwald eröffnet. 2003 übernahm YOGA VrovA e. V. die ehe malige und großzügige Kurklinik „Silvaticum" am Teutoburger Wald, Bad Meinberg. Seit Ende 2008 gibt es in Horumersiel an der Nordsee ein YoGA VrovA-Seminarhaus. Das vierte und jüngs te YOGA V1ovA-Seminarhaus wurde 2013 in Maria Rain, Allgäu eröffnet.
Der Abschluss der YOGA VrovA-Lehrer/innenausbildung berech tigt zur Mitgliedschaft im Berufsverband der YOGA VrDYA Lehrer/innen e. V. (BYV). Die Mitgliedschaft ermöglicht einen Austausch unter Gleichgesinnten, fachkundige Beratung und Unterstützung, Ermäßigung auf Kongresse und auf den Bezug von CDs und Büchern vom YOGA VrDYA VERLAG. Vor allem aber bietet sie die Möglichkeit, Unterstützung auf dem geistigen Weg und Rat bei der eigenen Unterrichtspraxis zu bekommen.
11
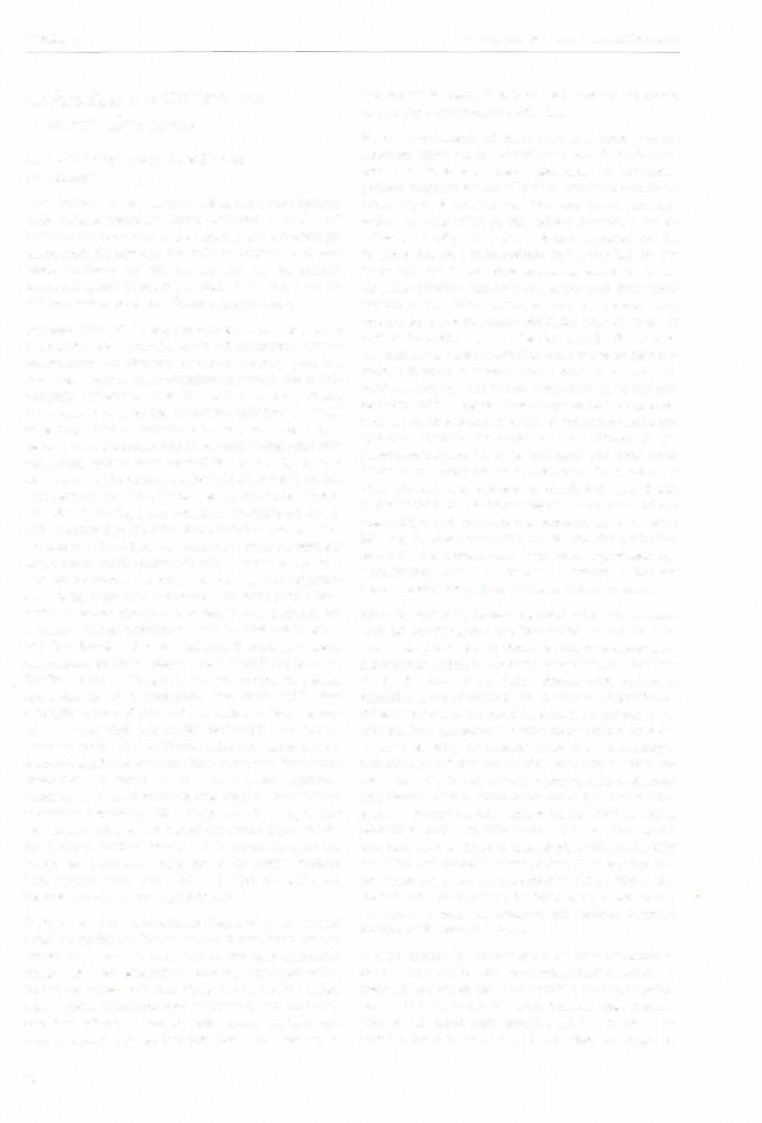
Einleitung
-
-
Auszüge aus Werken von Swami Sivananda
-
Eine psychologische Studie
(Aus „Sadhana")
Wer ernsthaft mit dem spirituellen Weg beginnt und systema tisch sädhana (spirituelle Übung) praktiziert, sieht sich mit bestimmten Schwierigkeiten und enttäuschenden Erfahrungen konfrontiert, die zunächst den Anfänger entmutigen können. Diese Probleme und Hindernisse sind für die meisten Suchenden gleich. Es ist daher wichtig, sie zu kennen und die richtigen Methoden zu ihrer Überwindung zu lernen.
Das erste Hindernis ist vorprogrammiert, wenn der sädhaka (Aspirant/in) sein spirituelles Leben mit bestimmten eigenen Vorstellungen von sädhana, Selbstverwirklichung, guru und Ähnlichem beginnt. Diese Vorstellungen können sich in tiefe Vorurteile verfestigen. Tatsächlich ist jedoch das spirituelle Leben ganz anders, als die individuelle Einbildung es glaubt. Viele Dinge sind verschieden von dem, was man vorher gedacht hatte. Manchmal sieht die spirituelle Wirklichkeit nicht nur anders, sondern sogar gegensätzlich zu den eigenen Vor stellungen aus. Die Vorurteile bekommen einen rüden Schock. Was passiert? Nur allzu oft ist der Neuling auf dem spirituellen Weg nicht in der Lage, sich mit diesen unerwarteten Augen öffnern abzufinden und geht wieder zurück zu seinem frühe ren gewohnheitsmäßigen, rein sinnlichen Leben. Das wäre der größte Fehler. Der/die Aspirant/in hält ein strahlendes Juwel in seinen/ihren Händen und wirft es wieder weg. Eine unschätz bare Gelegenheit wird verschenkt. Der Geist geht wieder zurück zu seinen alten Gewohnheiten. Der/die Suchende will seine/ihre eigenen Vorstellungen und Vorurteile nicht aufge ben. Zum Beispiel hat er/sie bestimmte Vorstellungen davon, was sädhana ist. Er/sie erwartet, dass sein(e)/ihr(e) Lehrer/in ihm/ihr nur solche Übungen zu tun gibt, die ihm/ihr passen. Andernfalls ist er/sie enttäuscht. Dann denkt er/sie, dass sein(e)/ihr(e) Lehrer/in sich auf eine bestimmte Weise verhal ten soll. Schließlich hat der/die Aspirant/in eine genaue Vorstellung seiner/ihrer spirituellen Entwicklungsstufe und der Geschwindigkeit und Art seines/ihres spirituellen Fortschritts. Tatsächlich aber kennt nur Gott deine genaue spirituelle Entwicklung. Dennoch tendieren viele dazu, an ihrer eigenen Vorstellung festzuhalten. Wenn Ereignisse später zeigen, dass man unrecht hatte, verliert man oft den Enthusiasmus und die Begeisterung. Enttäuschungen und Desillusionierungen am Anfang des spirituellen Lebens können ein großes Handikap sein. Verliere nicht den Mut. [...] Sädhana sollte auf Enthusiasmus und Freude gegründet sein.
Beginne das Leben eines sädhaka (Aspirant/in) mit geistiger Offenheit. Sei frei von Vorurteilen und Vorstellungen, die von deinem Ego erzeugt wurden. Nähere dich allen spirituellen Dingen mit einer ernsthaften, offenen, empfangsbereiten Einstellung, gepaart mit dem Wunsch zu lernen. Sei bereit, deine geistige Einstellung dem anzupassen, was du lernst, anstatt zu wünschen, dass sich alles deiner geistigen Vor stellung anpasst. Den Lieblingsvorstellungen zu entsagen, ist
12
Auszüge aus Werken von Swami Sivananda
sehr notwendig, wenn du auf dem spirituellen Weg beständig und harmonisch fortschreiten willst[...].
Ein weiteres Hindernis mit dem es fast jeder Anfänger zu tun bekommt, hängt mit den Vorstellungen von Verpflichtungen zusammen. Oft ist es so, dass vor dem Anfang des spirituellen sädhana Vorstellungen von Pflicht etc. unbekannt sind. Deine Eltern mögen dich um Gefallen bitten, aber du wirst dich taub stellen. [...) Aber wenn du mit sädhana beginnst, siehst du plötzlich alle möglichen neuen Pflichten gegenüber Familie, Freunden etc., die deinem sädhana im Wege stehen. Du bist überzeugt, dass du kein sädhana machen kannst, da du alle möglichen Pflichten hast, an die du vorher noch nicht einmal gedacht hast[...]. Außerdem werden deine Freunde versuchen, dich von yoga und Meditation abzuhalten oder dir sagen, es nicht zu übertreiben. [...) All dies sind typische Täuschungen des Geistes. Der Geist ist mäyä (Illusion). Der niedere Geist ver sucht, dich davon abzuhalten, die Wahrheit zu erfahren. Der Geist versucht, die Wahrheit zu verschleiern. Sei daher sehr wachsam und begegne den Bewegungen des Geistes systema tisch. [...] Sei dir bewusst: Zu verschiedenen Zeiten hast du ver schiedene Pflichten und Aufgaben. Aber sädhana für die Selbstverwirklichung ist deine wichtigste und dringendste Pflicht bis zur letzten Minute deines Lebens. Du kannst es dir nicht erlauben, dein sädhana zu verschieben. Lass diesen Gedanken tief in dich eindringen. Werde nicht schwach. Mache regelmäßiges und systematisches sädhana. [...] Denke stets über das Ziel des Lebens nach [...]. Beginne den spirituellen Weg und gehe unerschrocken voran. Gehe entschlossen und enthusiastisch voran. Halte dir das zu erreichende Ideal vor Augen. Du wirst das Ziel noch in diesem Leben erreichen.
Wenn du regelmäßig sädhana praktiziert, wirst du irgendwann auch auf Schwierigkeiten und Widerstände stoßen. Du wirst dann denken, dass diese Probleme von deinem sädhana verur sacht wurden und dass es dir vorher besser ging. Sei nicht trau rig. Es gibt einen Grund dafür. Sädhana heißt, bestimmte Restriktionen und Disziplin auf sich zu nehmen. Bis jetzt bist du vielleicht stets dem Ruf der Sinne gefolgt. Du bist daher nie mals mit ihrer Opposition in Berührung gekommen. Jetzt bist du auf einem Weg, der zunächst innere und äußere Disziplin bedeutet und auf dem du auf viele Widerstände stößt. Das heißt, dass du in Konflikt mit deinen unbeherrschten, eigenwil ligen Sinnen kommst. Wenn du so mit deinen ungeschulten Sinnen in Konflikt gerätst, beginnst du, ihre Kraft zu fühlen, während sie vorher scheinbar ruhig erschienen. Wenn du mit dem Fahrrad einen Hügel hinunterfährst, erscheint alles sehr angenehm und wunderbar. Wenn du dann aber den Hügel wie der hochfährst, siehst du, wie schwierig das ist. Waden und Oberschenkel scheinen unter der Anstrengung zu zerbrechen. Das passiert, wenn du ernsthaft mit sädhana beginnst. Sädhana heißt, bergauf zu fahren.
Es heißt, regelmäßig stromauf gegen die uralten Gewohnhei ten zu schwimmen. Es heißt, die ursprüngliche Höhe wiederzu gewinnen, von der du bisher unkontrolliert nach unten gefah ren bist. Und am Anfang ist der/die Suchende diese Anstren gung, diesen Kampf nicht gewohnt. [...] Dies ist alles ganz natürlich. Sei nicht verwirrt. Sei tapfer. Diese ursprünglichen
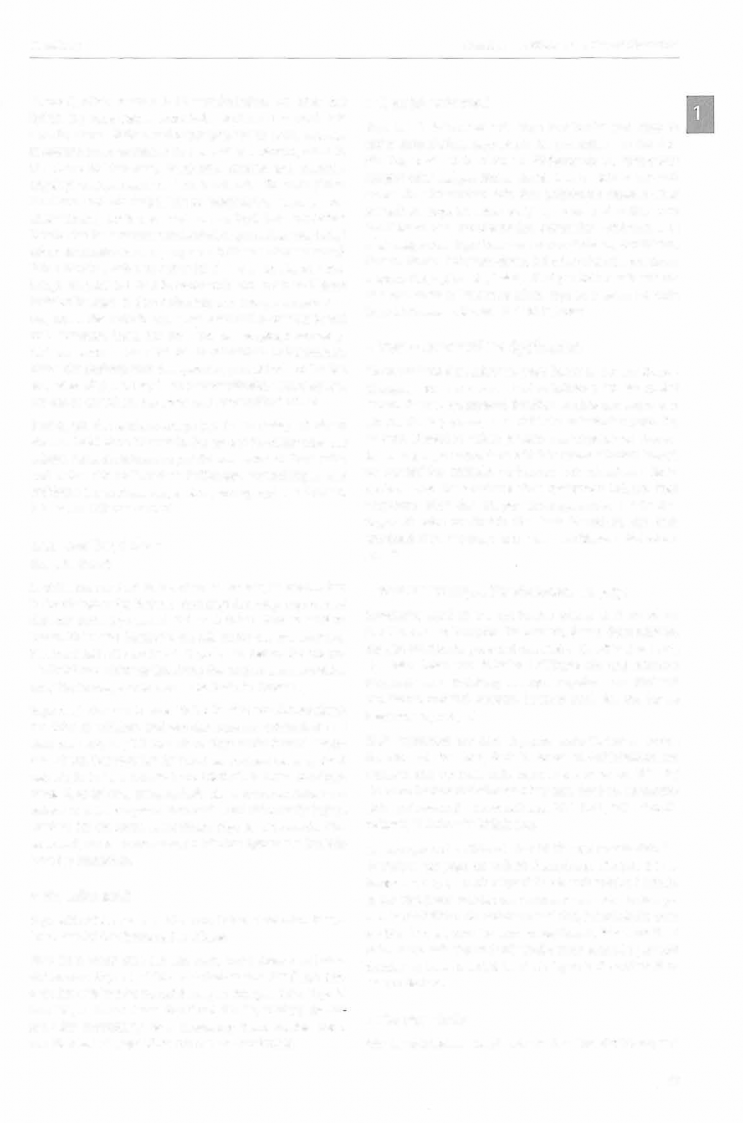
Einleitung
Schwierigkeiten werden bald verschwinden. Du wirst mit jedem Tag neue Stärke entwickeln. Denk nur mal nach, wie viele Probleme, Risiken und Anstrengungen du normalerweise in gewöhnlichen weltlichen Sachen auf dich nimmst, wie z. B. für kleine Geldgewinne, Geschäfte, Examen und Gerichts angelegenheiten. Dann wirst du bereit sein, die anfänglichen Probleme und Schwierigkeiten zu akzeptieren. Denke an den unendlichen, kostbaren und unvergänglichen atmischen Schatz, den du erreichen wirst. Auf dem spirituellen Weg bringt schon eine kleine Anstrengung und ein kleiner Schmerz unend lichen Gewinn. Erfolg ist sicher für den, der ein kleines Opfer bringt. Bis jetzt hat der/die Aspirant/in sich in einem kleinen Kreislauf bewegt, in dem er/sie Zeit und Energie aufgewendet hat, um modische Kleidung, gutes Essen und glitzerndes Metall zu bekommen. Er/sie hat einen Teil des Vergänglichen geop fert, um einen anderen Teil des Vergänglichen zu bekommen. Wenn der sädhaka jetzt den geraden, glorreichen spirituellen Weg einschlägt, wird er/sie ein paar vergängliche Dinge opfern, um das zu erreichen, das EWIG und UNVERGÄNGLICH ist.
Betritt jetzt den sädhana-märga (spirituellen Weg) mit einem offenen Geist ohne Vorurteile. Sei dir des höchsten Ziels des Lebens, nämlich sädhana zu praktizieren, bewusst. Trage ruhig und heiter alle anfänglichen Prüfungen, Versuchungen und Probleme. Du wirst das ewige Leben, unvergängliches Strahlen, Frieden und Wonne ernten!
-
Das Yogaleben
(Aus „Bliss Divine")
In Gott leben und mit Gott verbunden zu sein, ist yoga. Leben in Gott bringt ewige Wonne. Yoga zeigt den Weg. Yoga vereint dich mit Gott. Yoga macht dich unsterblich. Yoga ist erfülltes Leben. Es ist eine Methode, die alle Seiten der menschlichen Persönlichkeit mit einschließt. Yoga ist ein System der integra len Erziehung, nicht nur Erziehung des Körpers und des Geistes oder Verstandes, sondern auch der Seele im Inneren.
Yoga zeigt die wunderbare Methode, sich von Schlechtigkeit zur Güte zu erheben und von der Güte zur Göttlichkeit und dann zum ewigen göttlichen Glanz. Yoga ist die Kunst des rech ten Lebens. Der yag'i, der die Kunst des rechten Lebens gelernt hat, ist glücklich, harmonisch und friedvoll. Er ist frei von Span nung. Yoga ist eine Wissenschaft, die in früheren Zeiten von Sehern in Indien ausgearbeitet wurde, und nicht nur für Indien, sondern für die ganze Menschheit. Yoga ist eine exakte Wis senschaft, ein vollkommenes, praktisches System zur Entwick lung des Menschen.
-
-
Ein Lebensstil
-
Yoga will nicht, dass man sich vom Leben abwendet. Er ver langt eine Spiritualisierung des Lebens.
Yoga ist in erster Linie ein Lebensstil, nicht etwas vom Leben Getrenntes. Yoga ist nicht das Aufgeben von Handlung, son dern ihre erfolgreiche Durchführung im richtigen Geist. Yoga ist kein Weglaufen von Haus, Beruf und Familie, sondern ein Vor gang der Entwicklung einer Einstellung Heim, Familie, Beruf und Gesellschaft gegenüber mit neuem Verständnis.
Auszüge aus Werken von Swami Sivananda
-
Yoga ist universell
Yoga ist für jeden geeignet. Yoga ist allumfassend. Yoga ist nichts Sektenhaftes. Yoga ist ein Weg zu Gott, keine Religion. Die Yogapraxis steht nicht im Widerspruch zu irgendeiner Religion oder heiligen Kirche. Sie ist einfach spirituell und uni versell. Sie widerspricht nicht dem aufrichtigen Glauben eines Menschen. Yoga ist keine Religion, sondern eine Hilfe zum Praktizieren der grundlegenden spirituellen Wahrheiten in allen Religionen. Yoga kann von einem Christen, Buddhisten, Parsen, Hindu, Mohammedaner, Sufi oder Atheisten praktiziert werden. Ein yog'i zu sein, heißt, ständig in Gott zu sein und mit den Menschen in Frieden zu leben. Yoga ist Einssein mit Gott. Yoga ist Einssein mit allen. Gott ist in jedem.
-
Yoga - ganzheitliche Spiritualität
Die Vorstellung des Anfängers, yoga bestünde nur aus Körper übungen, nur aus äsanas und prär:iäyäma, ist ein großer Irrtum. Äsanas, prär:iäyäma, bandhas, mudräs und kriyäs sind ein Teil der Yogapraxis, aber nicht der vollständige yoga. Die meisten Menschen haben jenseits des körperlichen Niveaus keinen Zugang zu yoga, denn wirklicher yoga erfordert intensi ve persönliche Disziplin verbunden mit intensivem Nach denken unter der Anleitung eines geeigneten Lehrers. Yoga verspricht über den Körper hinausgehenden spirituellen Segen. Er wird unattraktiv für einen Menschen, der nach unmittelbaren Früchten und nach weltlichem Wohlstand schreit.
-
Voraussetzungen für ein Leben im yoga
Moralische Reinheit und spirituelles Sehnen sind die ersten Schritte auf dem Yogapfad. Ein Mensch, dessen Geist ruhig ist, der den Worten des guru und den sästras (Schriften) vertraut, der beim Essen und Schlafen Mäßigung übt und intensive Sehnsucht nach Befreiung aus dem sa{TJsära-cakra (Kreislauf von Geburt und Tod) verspürt, ist ein Mensch, der sich für die Praxis von yoga eignet.
Ein/e Aspirant/in auf dem Yogapfad sollte Vertrauen haben, Energie, Frohsinn, Mut, Geduld, Ausdauer, Aufrichtigkeit und Reinheit. Sein/ihr Geist sollte nicht so schnell verzweifeln. Er/ sie sollte Leidenschaftslosigkeit besitzen, Streben, Konzentra tion, Gelassenheit, Beherrschung, Wahrhaftigkeit, Gewalt losigkeit, Nichtbegehrlichkeit usw.
Ein strenges und schlichtes Leben ist für yoga unerlässlich. Die Grundlage für yoga ist Selbstbeherrschung. Disziplin ist die Essenz von yoga, sowohl körperliche als auch geistige Disziplin. In der Yogapraxis werden die normalerweise nach außen ge henden Aktivitäten des Geistes umgekehrt. Festigkeit des Geis tes ist sehr wesentlich für eine solche Umkehr. Wenn der Geist nicht zuerst gefestigt und vollständig unter Kontrolle gebracht worden ist, ist es unmöglich, sein Drängen in die andere Rich tung zu ändern.
-
Die vier Pfade
Die vier spirituellen Hauptpfade zur Selbstverwirklichung sind
13
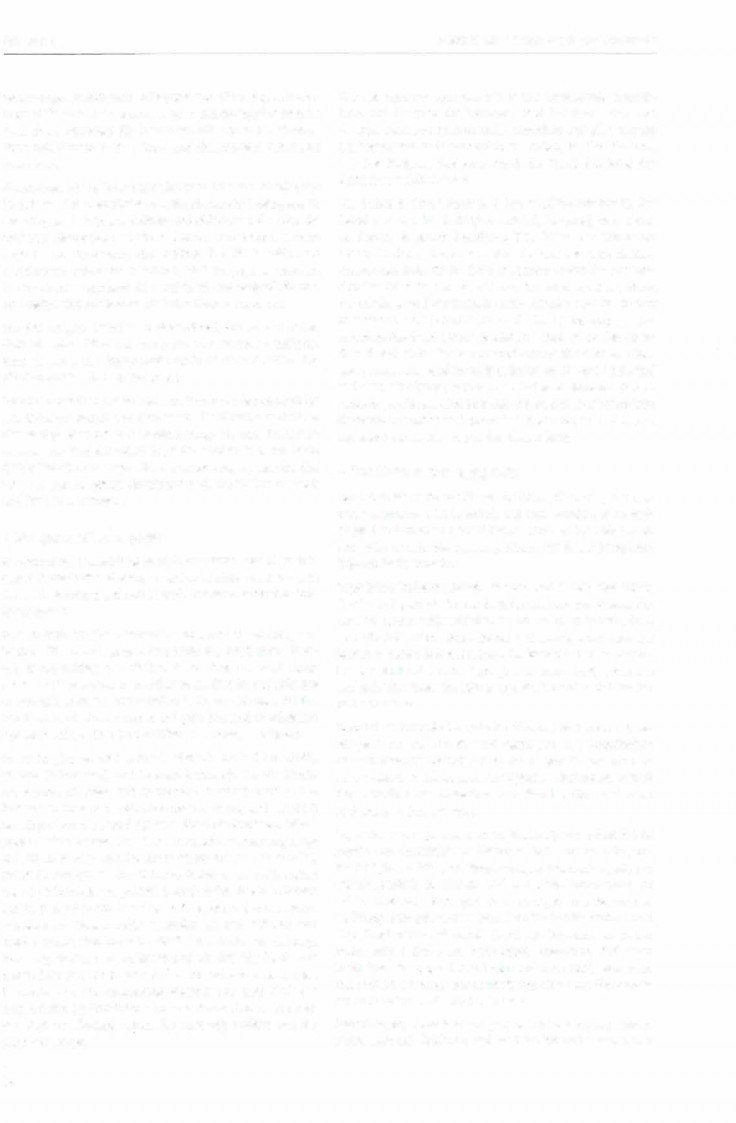
Einleitung
karma-yoga, bhakti-yoga, räja-yoga und JF,äna-yoga. Karma yoga ist für aktive Menschen geeignet, bhokti-yoga für fromme Menschen, räja-yoga für Menschen mit mystischer Veranla gung undjnäna-yoga für rational und philosophisch veranlagte Menschen.
Karma-yoga ist der Weg des selbstlosen Dienens. Bhakti-yoga ist der Weg der ausschließlichen Hingabe an Gott. Räja-yoga ist der Weg der Selbstbeherrschung und Jnäna-yoga der Weg der Weisheit. Karma-yoga ist die Ausbildung des Willens. Bhakti yoga ist die Ausbildung des Gefühls. Der Wille heiligt alle Handlungen, indem sie vollständig Gott hingegeben werden. Der Verstand verwirklicht die Herrlichkeit und Majestät Gottes. Das Gefühl gibt der Wonne göttlicher Ekstase Ausdruck.
Die drei ewigen Wahrheiten sind: bhakti, karma und jnäna. Gott ist Liebe, Güte und Wahrheit. Der Fromme empfindet Gott als Liebe. Der karma-yogT empfindet Gott als Güte. Der jnänT empfindet Gott als Wahrheit.
Manche Menschen halten allein die Praxis von karma-yoga für das Mittel zur Rettung. Andere sagen, die Hingabe an Gott sei der einzige Weg zur Gottverwirklichung. Manche Menschen meinen, der Pfad der Weisheit sei der einzige Weg, um letzte Glückseligkeit zu erlangen. Wieder andere sagen, dass die drei Wege in gleicher Weise zielführend sind, um Vollkommenheit und Freiheit zu bringen.
-
Der ganzheitliche yoga
Eine einseitige Entwicklung ist nicht angeraten. Der Mensch in seiner Gesamheit soll erzogen und entwickelt werden - sein Herz, sein Verstand und seine Hand. Nur dann erreicht er Voll kommenheit.
Der Mensch ist eine eigenartige komplexe Verbindung von Wollen, Fühlen und Denken. Er möchte das Gewünschte besit zen. Er hat Gefühle, also fühlt er. Er hat einen Verstand, daher denkt und überlegt er. In manchen Menschen ist vielleicht das emotionale Element vorherrschend. So wie Wollen, Fühlen und Denken nicht verschieden und getrennt sind, so schließen sich auch Arbeit, Hingabe und Wissen nicht gegenseitig aus.
Im Geist gibt es drei Mängel, nämlich mala (Unreinheit), vik�epa (Schwanken) und ävara(}a (Schleier). Die Unreinheit muss durch die Praxis von karma-yoga beseitigt werden. Das Schwanken muss durch bhakti-yoga (Verehrung und Hingabe) beseitigt werden. Der Schleier muss durch die Praxis vonjnäna yoga beseitigt werden. Nur dann ist Selbstverwirklichung mög lich. Wenn du dein Gesicht klar in einem Spiegel sehen willst, musst du den Spiegel vom Schmutz befreien, ihn ruhig halten und die Schutzhülle wegnehmen. Auch siehst du einen Schatz nur dann deutlich am Grund eines Sees, wenn das vom Wind aufgebrachte Wasser ruhig geworden ist und Trübung und Algen beseitigt sind. Dasselbe gilt für die Selbstverwirklichung. Handlung, Gefühl und Intelligenz sind die drei Pferde, die vor diesen Körperwagen gespannt sind. Sie müssen vollkommen harmonisch und im Gleichklang arbeiten. Nur dann läuft der Wagen ruhig. Die Entwicklung muss umfassend sein. Du musst den Kopf von Salikara haben, das Herz von Buddha und die Hand von Janaka.
14
Auszüge aus Werken von Swami Sivananda
Nur der yoga der Synthese bringt eine umfassende Entwick lung. Nur der yoga der Synthese entwickelt Hand, Herz und Hirn/Verstand und führt zu Vollkommenheit. Auf allen Ebenen ein harmonisches Gleichgewicht zu finden, ist das Ideal von jeglicher Religion. Das kann durch die Praxis des yoga der Synthese erreicht werden.
Das Selbst in allen Wesen zu sehen ist jnäna (Weisheit); das Selbst zu lieben ist bhakti (Frömmigkeit, Hingabe); dem Selbst zu dienen ist karmo (Handlung, Tat). Wenn der jnäna-yogT Weisheit erlangt, hat er auch Hingabe und handelt selbstlos. Karma-yoga stellt für ihn einen spontanen Ausdruck seiner spi rituellen Natur dar, und er sieht das eine Selbst in jedem. Wenn der Gläubige Vollkommenheit durch Hingabe erreicht, besitzt er Weisheit und Aktivität. Auch für ihn ist karma-yoga der spontane Ausdruck seiner göttlichen Natur, da er den einen Gott überall sieht. Der karma-yogT erlangt Weisheit und Hin gabe, wenn sein Handeln völlig selbstlos ist. Die drei Pfade sind in der Tat ein einziger, auf dem die drei verschiedenen Tempe ramente jeweils das eine oder das andere seiner untrennbaren Elemente hervorheben. Yoga gibt die Methode, durch die man das Selbst sehen, lieben und ihm dienen kann.
-
-
Der Nutzen der Yogapraxis
Das Leben ist heute voll Stress und Mühe, Spannung und ner vöser Reizbarkeit, Leidenschaft und Eile. Würde der Mensch einige der elementaren Prinzipien des yoga in die Praxis umset zen, wäre er sehr viel besser gerüstet, mit dieser komplexen Existenz fertigzuwerden.
Yoga bringt Vollkommenheit, Frieden und dauerhaftes Glück. Durch die Yogapraxis kannst du jederzeit Ruhe des Geistes fin den. Du kannst ruhig schlafen. Du kannst mehr Energie, Kraft und Vitalität haben, lange leben und sehr gesund sein. Du kannst in kurzer Zeit viel leisten. Du kannst in jedem Lebens bereich erfolgreich sein. Yoga gibt dir neue Kraft, Vertrauen und Selbstbewusstsein. Körper und Geist werden deinem Be fehl gehorchen.
Yoga bringt Kontrolle über die Emotionen. Die Konzentrations fähigkeit bei der Arbeit wird gesteigert. Die Yogadisziplin schenkt Ausgeglichenheit und Ruhe und gestaltet auf wunder bare Weise dein Leben neu. Die yogische Lebensweise vertieft das Verstehen des Menschen und lässt ihn Gott und seine Beziehung zu Ihm erkennen.
Yoga führt von l_!nwissenheit zu Weisheit, von Schwäche zu Stärke, von Uneinigkeit zu Harmonie, von Hass zu Liebe, von Bedürftigkeit zu Fülle, von Begrenzung zu Grenzenlosigkeit, von Verschiedenheit zu Einheit und von Unvollkommenheit zu Vollkommenheit. Yoga gibt dem Traurigen und Verlorenen Hoffnung, dem Schwachen Kraft, dem Kranken Gesundheit und dem Unwissenden Weisheit. Durch die Yogadisziplin wirken Geist, Körper und Seele harmonisch zusammen. Auf einen Menschen, der yoga übt, stürzen eine neue Sicht, eine neue Gesundheit, ein neues Bewusstsein und eine neue Philosophie ein und verändern deutlich sein Leben.
Machthunger, materielle Habgier, sinnliche Erregung, Selbst sucht, Lust auf Reichtum und niedrige Wünsche haben den

Einleitung
Menschen vom wirklichen Leben im Geist zu einem materialis tischen Leben hin weggezogen. Er kann seine verlorene göttli che Herrlichkeit wiedererlangen, wenn er mit richtigem Ernst die Yogaprinzipien übt. Yoga verändert die tierische Natur zu einer göttlichen Natur und erhebt den Menschen zum Gipfel
-
göttlicher Herrlichkeit und göttlichen Glanzes.
-
Spirituelles Wachstum erfolgt allmählich
Es liegt in der Kraft eines jeden Menschen, Erfolg im yoga zu haben. Es verlangt ernsthafte und aufrichtige Hingabe und dauernden und beständigen abhyäsa (Übung).
Spirituelles Wachstum erfolgt allmählich. Es ist eine progressi ve Entwicklung. Man darf nicht in fieberhafter Eile versuchen, große yogische Heldentaten zu vollführen, oder in zwei bis drei Monaten erwarten, nirvikalpa-samädhi (Erfahrung der absolu ten Einheit) zu erlangen. Die Sinne müssen zuerst vollständig bezwungen, göttliche Tugenden gepflegt und schlechte Eigen schaften beseitigt werden. Der Geist muss vollständig beherrscht werden. Das ist eine ungeheuer große Aufgabe. Es ist eine sehr schwierige Arbeit. Man muss strenges tapas und Meditation üben und geduldig auf die Ergebnisse warten. Man muss die Leiter des yogo Schritt für Schritt erklimmen. Man muss am spirituellen Weg Stufe für Stufe weitergehen.
-
Ein Hinweis zur Vorsicht
-
Wenn ein yogT nicht vorsichtig und nicht fest verwurzelt ist in den vorbereitenden Praktiken von yama und niyamo, wird er, ohne es zu merken, durch Versuchungen von seinem Ideal weggespült. Er benutzt seine Kräfte für selbstsüchtige Dinge und erleidet einen starken Rückschlag. Sein Verstand wird blind, verdorben und vergiftet. Sein Verstehen umwölkt sich. Er ist kein göttlicher yogT mehr. Er wird ein Schwarzmagier oder ein yogischer Scharlatan. Er ist das schwarze Schaf in der Herde der yogTs. Er ist eine Bedrohung für die Gesellschaft überhaupt.
V iele Menschen fühlen sich von prä,:,äyäma und anderen Yogaübungen angezogen, denn durch yoga kann man Wunder heilen, Telepathie, Gedankenübertragung und andere großarti ge siddhis (übernatürliche Kräfte) erlangen. Wenn sie Erfolg haben, sollten sie nicht einfach dabei stehenbleiben. Das Ziel des Lebens sind nicht.Heilungen und siddhis. Sie müssen ihre Energie dazu verwenden, das Höchste zu erreichen.
Yoga ist nicht dazu da, siddhis zu erlangen. Wenn ein Yoga schüler hierzu die Versuchung verspürt, wird sein weiterer Fortschritt ernsthaft verzögert. Er kann so dauerhaft vom Weg abkommen. Ein yogi, der darauf konzentriert ist, höchsten samädhi zu erreichen, muss siddhis zurückweisen, wo auch immer sie auftauchen. Siddhis sind Einladungen von devatäs. Nur wenn man diese siddhis zurückweisen kann, kann man Erfolg im yoga erlangen.
Beende dein sädhana nicht, wenn du kleine Visionen und Erfahrungen von Freude hast. Übe weiter, bis du Vollkommen heit erlangst. Höre mit der Praxis nicht auf und gehe achtlos in der Welt herum. Es gibt viele Menschen, die zu früh meinten, am Ziel zu sein. Ein kleiner Einblick ist noch nicht die höchste Verwirklichung.
Auszüge aus Werken von Swami Sivananda
-
-
-
Leben
-
-
(Aus „Bliss Divine")
Leben ist der Ausdruck Gottes. Leben ist Freude. Leben ist das überfließen der Wonne des Geistes.
Leben ist ein stetiger Fluss. Leben schwingt in jedem Atom. Leben ist in allem. So etwas wie unbelebte Materie gibt es nicht. In einem Stück Stein ist Leben. Die Materie schwingt vor Leben.
Leben ist eine Reise im unendlichen Ozean der Zeit, wo sich die Szenerie unaufhörlich verändert. Das Leben ist eine Reise von der Unreinheit zur Reinheit, vom Hass zur kosmischen Liebe, vom Tod zur Unsterblichkeit, von der Unvollkommenheit zur Vollkommenheit, von der Sklaverei zur Freiheit, von der Vielfalt zur Einheit, von der Unwissenheit zur ewigen Weisheit, vom Schmerz zur ewigen Wonne und von der Schwäche zur unend lichen Kraft. Leben ist eine großartige Gelegenheit, die Gott Seinen Kindern gibt, damit sie sich zu Ihm hin entwickeln.
Leben ist Dienen und Opfer. Leben ist Liebe. Leben ist Beziehung. Leben ist Poesie, nicht Prosa. Leben ist Kunst und Phantasie, nicht Wissenschaft. Leben ist Verehrung.
Wir sind hier als vorüberziehende Pilger. Unser Ziel ist Gott. Wir suchen nach der verlorenen Erbschaft, dem vergessenen Erbe. Das große zentrale Ziel des Lebens ist das Erreichen einer bewussten Verwirklichung unseres Einsseins mit Gott. Leben hat keine Bedeutung als getrenntes Leben. Es hat nur Bedeutung, wenn es voll oder das Ganze wird, wenn die indivi duelle Seele die höchste Seele erreicht.
-
Das Ziel des Lebens
Das wahre Ziel des Lebens ist die Rückkehr zu der Quelle, aus der wir kamen. So wie die Flüsse unaufhörlich fließen, bis sie den Ozean erreichen, die eigentliche Quelle, aus der sie ihr Wasser nehmen, und so wie Feuer züngelt und wild brennt, bis es in seinem Ursprung aufgeht, so sind auch wir hier ruhelos, bis wir Gottes Gnade erlangen und eins mit Ihm werden.
Der einzige Lebenszweck ist das Erreichen von Selbstver wirklichung, absoluter Freiheit. Das Ziel des menschlichen Lebens ist es, die Göttlichkeit zu entfalten und zu manifestie ren, die in Ewigkeit in Ihm existiert. Der Sinn des Lebens ist es, die Vorstellung der getrennten Persönlichkeit zu verlieren und
15
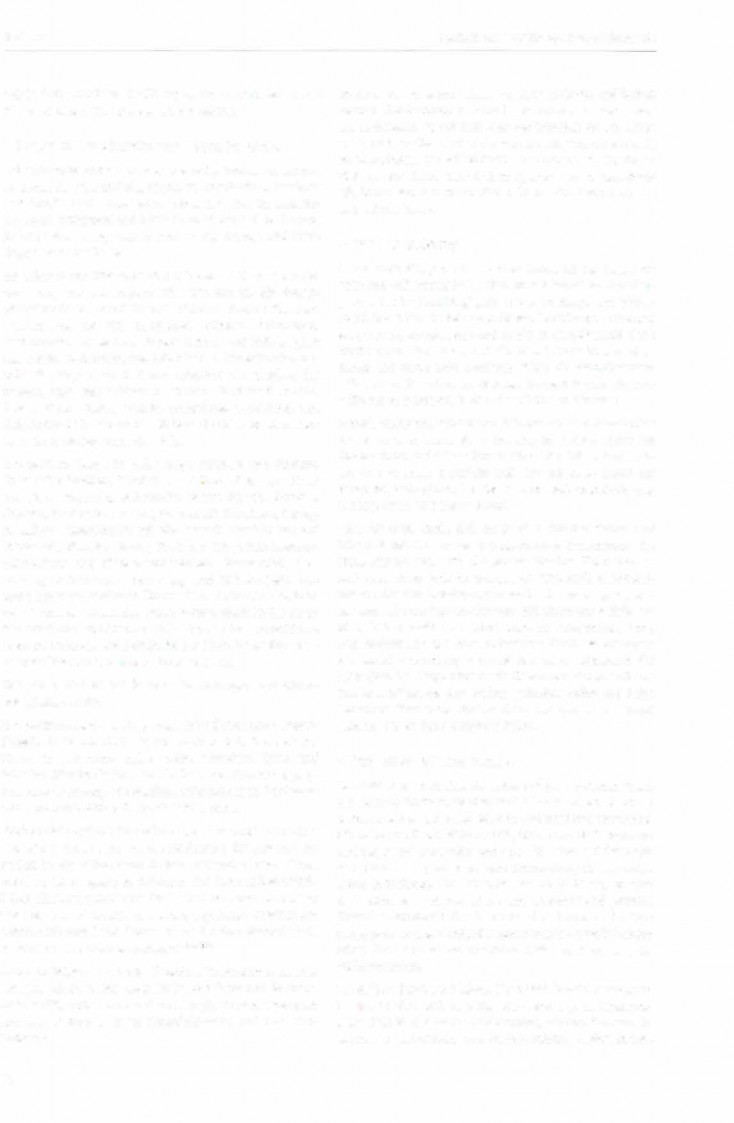
Einleitung
sich in Gott aufzulösen. Die Erlangung des unendlichen Lebens ist der erhabene Sinn des begrenzten Lebens.
-
Leben in der Materie und Leben im Geist
Leben im Geist ist das einzige wahre, ewige Leben. Das moder ne Leben der Hast und Eile, mit Angst, Unsicherheit, Krankheit und Konflikt ist nicht das wahre Leben. Ein Leben im materiel len Luxus, Wohlstand und Stärke ist nicht das Ziel des Lebens. So ein Leben bringt keinen Frieden des Geistes und keine Gelassenheit der Seele.
Ein Leben in den Sinnen ist nicht lebenswert. Sinnesfreude ist wie Honig, der mit starkem Gift vermischt ist. Ein Gramm Sinnesfreude ist vermischt mit fünfzehn Gramm Schmerz. Sinnesfreude ist mit Gebrechen, Sünden, Schmerzen, Verhaftungen, schlechten Gewohnheiten und Ruhelosigkeit des Geistes verbunden. Das Schwelgen in Sinnesfreuden zer stört die Hingabe an Gott und schwächt die Fähigkeit des Geistes, nach dem Wahren zu suchen. Sinnlichkeit zerstört Leben, Glanz, Stärke, Vitalität, Gedächtnis, Wohlstand, Ruf, Heiligkeit und Hingabe an das Höchste. Sie zieht den Menschen hinunter in die Abgründe der Hölle.
Das weltliche Leben ist voller Sorge, Schmerz und Bindung. Es ist voller Schäden, Schwächen und Einschränkungen. Es ist voll Hass, Eifersucht, Selbstsucht, Verrat, Sorgen, Kummer, Ängsten, Krankheiten und Tod, Gemeinheit, Schurkerei, Betrug, Falschheit, Halsabschneiderei, Wettbewerb, Unreinheiten und Dunkelheit, Kämpfen, Hader, Streit und Krieg, Enttäuschung, Verzweiflung und Niedergeschlagenheit, Grausamkeit, Aus nutzung, Entfremdung, Aufregung und Ruhelosigkeit. Alle Dinge haben einen dünnen Überzug illusorischer Freude. Es ist wie ein dünner galvanischer Belag. In Wirklichkeit ist das Leben hier nur Glitzer und Schatten. Unter dem Zuckerguss ist bittere Medizin. Unter der Goldschicht ist nur Blech. Unter den soge nannten Freuden ist Schmerz, Elend und Leid.
Das Leben hier ist mit Ängsten, Verhaftungen und Wider wärtigkeiten erfüllt.
Das weltliche Leben ist völlig irreal. Es ist Illusion und Vergäng lichkeit. Es ist oberflächlich und wertlos. Sein Ende ist nur Staub. Es gibt nichts außer Reden, Tratschen, Essen und Schlafen. Alles ist Illusion. Alles ist Schmerz. Alles ist vergäng lich. Alles ist flüchtig. Die weltliche Erfahrung allein hat keinen Wert und keine Wahrheit. Nur Gott ist wirklich.
Noch so viele Nullen haben keinen Wert, wenn nicht die Zahl 1 davorsteht. Selbst wenn du die Reichtümer der ganzen Welt besitzt, ist das nichts, wenn du kein spirituelles Leben führst, wenn du keinen geistigen Reichtum und keine Selbstverwirk lichung hast. Du musst in der Seele leben. Du musst dem Leben hier den ätman hinzufügen. Deshalb sagt Jesus: ,,Trachtet am
ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen!" IM•.•331
Leben im Ewigen ist Leben im Überfluss. Es ist reiches, inneres, geistiges Leben. Dieses Leben ist frei von Sorge und Schmerz. Es ist erfüllt, vollkommen und unabhängig. Es ist voll Weisheit und ewiger Wonne. Es ist alldurchdringend und ohne Ver änderung.
16
Auszüge aus Werken von Swami Sivananda
Beginne das seelische Leben. Du wirst gereinigt und befreit werden. Das Schönste im Leben ist, wenn man das, was einem am wichtigsten ist, auf dem Altar der Wahrheit opfert. Leben heißt, nach der Wahrheit zu streben und alle Hindernisse mutig zu überwinden. Die größte Freude des Lebens ist Hingabe an Gott und Meditation über Gott im eigenen Herzen. Das spiritu elle Leben gibt dem menschlichen Leben eine Bedeutung und verleiht ihm Glanz.
-
-
Der Lebenskampf
Leben heißt kämpfen für das Ideal. Leben ist der Kampf für Fülle und Vollkommenheit. Leben ist der Kampf um die Erlan gung höchster Unabhängigkeit. Leben ist Kampf und Wider stand. Leben ist eine Reihe von Siegen. Der Mensch entwickelt sich, wächst, entfaltet sich und macht im Kampf verschiedene Erfahrungen. Das Leben und die Gesellschaft können ohne Kampf und Streit nicht existieren. Wenn du weiterbestehen willst, musst du unbedingt kämpfen. Du wirst in dem Moment aufhören zu existieren, in dem du aufhörst zu kämpfen.
Kämpfe tapfer mit den inneren Feinden auf dem Schlachtfeld deines Herzens. Schon ein kleiner Sieg im inneren Kampf mit deinem Geist und deinen Sinnen wird deine Willenskraft stär ken und dir mehr Sicherheit und Mut geben. Je härter der Kampf ist, desto glorreicher der Triumph. Selbstverwirklichung verlangt einen sehr harten Kampf.
Lebe für Gott. Stelle dich mutig allen Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten dieses unbedeutenden Erdenlebens. Sei stark. Kämpfe mutig für den großen Gewinn. Einen Berg zu besteigen, einen Kanal zu überqueren, eine Stadt zu bombar dieren oder eine Befestigungsanlage in die Luft zu sprengen - das sind nicht die wahren Akte von Heldentum und wirklichem Mut. Deinen Geist und deine Sinne zu beherrschen, Zorn, Leidenschaft und Egoismus zu besiegen durch die Erlangung von Selbstbeherrschung - das ist das wahre Heldentum des Menschen. Wie lange wirst du ein Sklave von Leidenschaft und Sinnen sein? Mache dein wahres göttliches Selbst und deine Herrschaft über deine niedere Natur und das niedere Selbst geltend. Das ist deine wichtigste Pflicht.
-
Das Leben ist eine Schule
Das heißt aber nicht, dass das Leben auf der physischen Ebene der Materie ignoriert werden darf. Materie ist ein Ausdruck Gottes zu Seiner IT/ä (Spiel). Materie und Geist sind untrennbar wie Hitze und Feuer, Kälte und Eis, Blume und Duft. Brahman und mäyä sind untrennbar und eins. Ein Leben auf der physi schen Ebene ist ganz sicher eine Vorbereitung für das ewige Leben in brahman. Das Leben ist eine große Schule, wo man viele nützliche Lektionen erlernt und Charakter und göttliche Tugenden entwickelt. Das Leben ist eine Schule, in der jede Sorge, jeder Schmerz und jeder Kummer eine wertvolle Lektion bringt. Das Leben auf der Erde ist ein Mittel zur Erreichung der Vollkommenheit.
Die Welt ist dein bester Lehrer. Diese Welt ist dein bester guru. In allem ist eine Lektion. Es liegt eine Lehre in jeder Erfahrung. Diese Welt ist der beste Ausbildungsort, um verschiedene Tu genden zu entwickeln, wie Barmherzigkeit, Nachgiebigkeit,
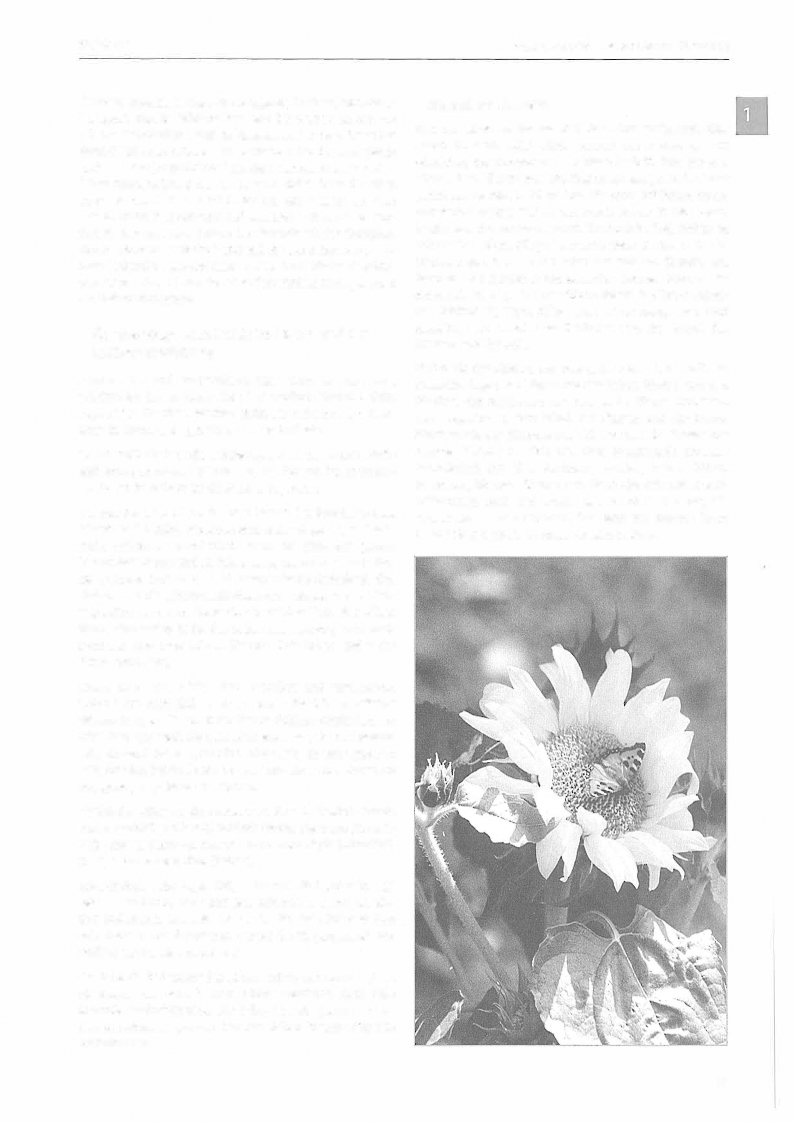
Einleitung
Toleranz, universelle Liebe, Großzügigkeit, Edelmut, Mut, Groß herzigkeit, Geduld, Willensstärke usw. Die Welt ist ein Ort, um mit der diabolischen Natur zu kämpfen und um von innen her Göttlichkeit auszudrücken. Die zentrale Lehre der „Bhagavad gTtä" und des „Yoga-väsi�tha" ist, dass man das Selbst verwirk lichen muss, während man in der Welt bleibt. Sei in der Welt, aber sei außerhalb der Welt. Sei wie das Wasser auf dem Lotosblatt: Es lässt sich zwar auf dem Blatt in Form eines Trop fens nieder, kann aber jederzeit vollständig wieder abtropfen. Gib die niedere asurische Natur auf, die aus Selbstsucht, Lust, Zorn, Habsucht, Hass und Eifersucht besteht. Mache die göttli che Natur geltend. Lebe ein Leben der geistigen Entsagung und der Selbstaufopferung.
-
Sichere Wege zum Erfolg im Leben und zur Gottverwirklichung
Lebe einfach und anspruchslos. Lebe nicht, um zu essen, sondern iss, um zu leben. Sei nicht neidisch. Tratsche nicht. Sage nichts Falsches. Betrüge nicht. Sei nicht boshaft. Dann wirst du immer froh, glücklich und friedvoll sein.
Rechtschaffenheit ist die Lebensregel. Lebe tugendhaft. Halte dich streng an dharma (die Regeln, das Gesetz). Das menschli che Leben ist nicht menschlich ohne Tugenden.
Das Salz des Lebens ist selbstloses Dienen. Das Brot des Lebens ist universelle Liebe. Das Leben wird nicht voll gelebt, und es ist nicht vollständig verwirklicht, wenn du nicht der ganzen Menschheit dienst und sie liebst. Lebe, um anderen zu helfen. Die göttliche Kraft wird als lebensspendende Kraft durch dich fließen. Lies die Lebensgeschichten von Heiligen und schöpfe Inspiration aus ihnen. Entwickle ein weiches Herz, eine offene Hand, eine sanfte Rede, das Leben des Dienstes, universelle Sicht und eine unparteiische Haltung. Dein Leben wird in der Tat gesegnet sein.
Diene, liebe, gib, reinige dich, meditiere und verwirkliche. Deine Reise wird dich in einen neuen Bereich unendlicher Wonne bringen. Du wirst strahlende Schätze entdecken. Du wirst Gott neu entdecken. Du wirst stark sein, du wirst gesund sein, du wirst frei sein, du wirst schön sein, du wirst glücklich sein, du wirst friedvoll sein. Du wirst alle Menschen, denen du begegnest, inspirieren und segnen.
Mache das Leben zu einer dauernden Freude. Schöpfe Freude aus satya {Wahrhaftigkeit). Schöpfe Freude aus tapas {Einfach heit, Askese, Disziplin). Schöpfe Freude aus dayä (Mitgefühl). Schöpfe Freude aus däna (Geben).
Lebe einfach. Lebe regelmäßig. Lebe hart. Sieh jeden Tag, als wäre er der letzte, und nutze jede Sekunde in Gebet, Medita tion und Dienst. Lass dein Leben ein ständiges Opfer an Gott sein. Lebe in der Gegenwart. Vergiss die Vergangenheit. Gib Hoffnungen für die Zukunft auf.
Verstehe die Bedeutung des Lebens richtig und dann beginne die Suche. Das Leben ist dein größtes Geschenk. Nutze jede Sekunde gewinnbringend. Der Erfolg ist meist jenen beschie den, die etwas wagen und handeln. Selten kommt er zu den Schüchternen.
Auszüge aus Werken von Swami Sivananda
-
-
Einheit des Lebens
Sieh das Leben als Ganzes. Sieh das Leben umfassend. Alles Leben ist eins. Alles Leben kommt aus brahman, dem Absoluten, der einzigen und alleinigen Realität. Gott atmet in allem Leben. Alles ist eins. Die Welt ist ein einziges Heim. Jeder gehört zur Familie der Menschen. Die ganze Schöpfung ist ein organisches Ganzes. Der Mensch macht sich unglücklich, wenn er sich von den anderen trennt. Trennung ist Tod. Einheit ist universelles Leben. Pflege kosmische Liebe. Schließe alle ein. Umfange alle. Erkenne den Wert der anderen. Zerstöre alle Barrieren, die Menschen von Menschen trennen. Erkenne das nichtduale Prinzip, die unsterbliche Essenz in allen Geschöp fen. Schütze die Tiere. Alles Leben sei dir heilig. Dann wird diese Welt ein Paradies der Schönheit sein, ein Himmel des Friedens und der Stille.
Lächle mit den Blumen und dem grünen Gras. Spiele mit den Schmetterlingen, den Vögeln und den Rehen. Gib die Hand den Büschen, den Farnen und den Zweigen der Bäume. Sprich mit dem Regenbogen, dem Wind, den Sternen und der Sonne. Plaudere mit den plätschernden Bächen und den Wellen des Meeres. Unterhalte dich mit dem Spazierstock. Schließe Freundschaft mit allen Nachbarn, Hunden, Katzen, Kühen, Menschen, Bäumen, Blumen usw. Dann wird dein Leben weit, vollkommen, reich und erfüllt sein. Du wirst eins sein, die Einheit des Lebens erfahren. Das kann mit Worten kaum beschrieben werden. Du musst es selbst spüren.
17

- - ----.
l
!
l
;
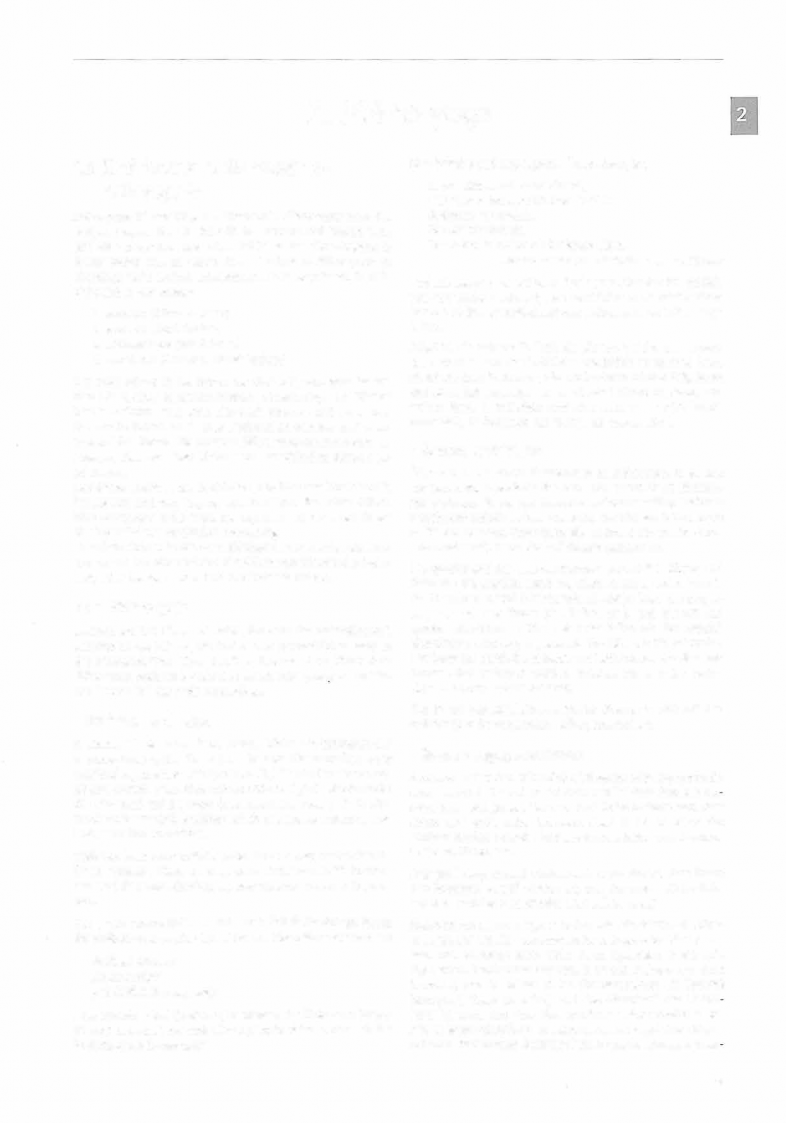
2. Jnäna-yoga
-
-
Einführung in die vedänta- Philosophie
Jfiäna-yoga ist der Weg der Erkenntnis. Jfiäno-yoga stellt die ewigen Fragen: Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn des Lebens? Gibt es eine Gerechtigkeit in dieser Welt? Was ist Glück? Was ist wirklich? Jfiäna-yoga ist allerdings nicht einfach intellektuelles Philosophieren. Er voll zieht sich in vier Stufen:
-
sravof.)a (Hören > Lesen)
-
manana (Nachdenken)
-
nididhyäsana (Meditieren)
-
anubhava (Erfahren, Verwirklichen)
Der erste Schritt ist das Hören der Weisheit, vorzugsweise aus dem Mund eines Selbstverwirklichten. Heutzutage sind Bücher leicht erhältlich, man kann also auch Bücher zuhilfe nehmen. Der zweite Schritt ist eigenes Nachdenken darüber und even tuelles Diskutieren. Die meisten jfiäno-yogo-Schriften sind als Zwiegespräch zwischen Meister und zweifelndem Schüler ge schrieben.
Der dritte Schritt ist die Meditation, die über das Intellektuelle hinausgeht und den Zugang zum intuitiven Begreifen öffnet. Eine Umsetzung in die Praxis des täglichen Lebens ist auf dieser Stufe parallel zur Meditation notwendig.
Der vierte Schritt ist die Verwirklichung. Hier werden alle Ant worten voll beantwortet und der jfiäna-yogi' erkennt die Wahr heit, oder besser, er verschmilzt mit der Wahrheit.
-
-
-
Philosophie
Vedänta wörtlich übersetzt heißt „das Ende des veda/Wissens". Vedänta ist die Philosophie hinter dem ganzheitlichen yoga in der Sivananda/YoGA V1DYA-Tradition, insbesondere hinter dem jfiäna-yoga. Vedänta bezieht sich auf die 108 upanisads, welche den letzten Teil der veda ausmachen.
-
Brahman und mäyä
-
-
-
-
-
-
-
Brahmon ist die unendliche, ewige, höchste Wirklichkeit der vedänto-Philosophie. Es ist jenseits aller Eigenschaften oder Merkmale, jenseits von Subjekt und Objekt, die Quelle von sat, cit und änanda (Sein, Weisheit und Glückseligkeit). Brahmon ist die Leinwand, auf die mäyä (das kosmische Drama, die Schöp fung) projiziert wird. Brahmon erhält das Drama aufrecht, aber bleibt von ihm unberührt.
Brahman kann nicht definiert oder durch einen verstandesmä ßigen Prozess erfasst werden, denn definieren heißt begren zen, und da es das Absolute ist, was wäre da, um es zu begren zen?
Der große nondualistische Philosoph Ädi Sarikaräcärya fasste die vedänto-Philosophie in drei kurzen Merksätzen zusammen:
brahma satyarr, Jagan mithyä
JIVO brahmaiva näparab
,,Das höchste Selbst (brohmon) ist wirklich, das Universum Uogot) ist unwirklich, die individuelle Seele UJva) ist nichts anderes als das höchste Selbst (brohmon)."
Eine lyrische und einprägsame Übersetzung ist: In drei Sätzen sei es verkündet,
was man in tausend Büchern findet:
Brahmon ist wirklich. Die Welt ist Schein.
Das Selbst ist nichts als brahman allein.
- Friedrich Rückert (1788-1866), Sprachgenie und Dichter
Und mit seiner meisterlichen Darlegung „Nur das ist wirklich, was sich weder verändert, noch aufhört zu sein" zeigt Sarikara klar die völlige Unwirklichkeit des Universums und aller Dinge in ihm.
Mäyä ist die universelle Kraft der Illusion, welche das Unwirk liche wirklich und das Wirkliche unwirklich erscheinen lässt. Sie ist die Kraft brahmans, die aus brahman mittels Zeit, Raum und Kausalität scheinbar das manifeste Universum, jagat, ent stehen lässt. In Wahrheit sind aber jagat und mäyä immer unwirklich, da brahman das Einzige ist, was existiert.
-
Ätman, upädhi, jTva
Ätman ist das absolute Bewusstsein im Individuum. Er ist eins mit brahman, unveränderlich und unbegrenzt. Er ist identisch mit brohman. Ätman und brohman meinen dasselbe; brahman bezieht sich jedoch auf das Absolute, das höchste Selbst, wenn es für das gesamte Universum gilt, während ötman das Abso lute bezeichnet, wenn das Individuum gemeint ist.
Die upödhis sind das, was das Bewusstsein verhüllt. Körper und Geist sind die upädhis. Möyö manifestiert sich im Individuum in der Form von avidyä (Unwissenheit). Avidyä lässt uns verges sen, dass wir der ätman (das Selbst) sind, und uns mit den upädhis identifizieren. Wenn sich das Selbst mit den upädhis identifiziert, wird es ji'va genannt. Ji'va hält sich für gebunden und begrenzt durch die upödhis und leidet daher. Der ji'va wird immer wiedergeboren werden müssen, bis er seine wahre Natur - ätmon - wiedererkennt.
Ji'va ist die individuelle Seele. Ji'va ist ätman, der sich mit den
upödhis (den begrenzenden Hüllen) identifiziert.
-
Tsvara = sagur:ia-brahman
Brahmon verbunden mit mäyö wird i'svaro oder saguf,)a-broh man genannt. Das entspricht dem persönlichen Gott der ver schiedenen Religionen. Der nondualistische vedänta sagt, dass i'svara eine Stufe unter brahman steht. Er ist trotzdem das höchste Symbol oder die höchste Manifestation von brahman in der endlichen Welt.
(Der große yogi' Swami Vivekananda sagte einmal, dass i'svara den höchsten Begriff verkörpert, den der menschliche Geist erfassen und das menschliche Herz lieben kann.)
Tsvaro ist mit solchen Eigenschaften wie Allmächtigkeit, Allge genwart, universeller Herrschaft oder unbegrenzter Macht aus gestattet. Brahman kann nicht durch irgendeine bestimmte Eigenschaft beschrieben werden. Es ist daher i'svara und nicht brahman, der in seinen vielen Gottesaspekten als Brahmä (Schöpfer), Vi�r:iu (Erhalter) und Siva (Zerstörer) des Univer sums benannt wird. Vom Standpunkt des reinen brahman aus gibt es keine Schöpfung, da keine der i'svoro zugeteilten Eigen schaften für brahmon Gültigkeit hat. So wie formloses, unbear
19
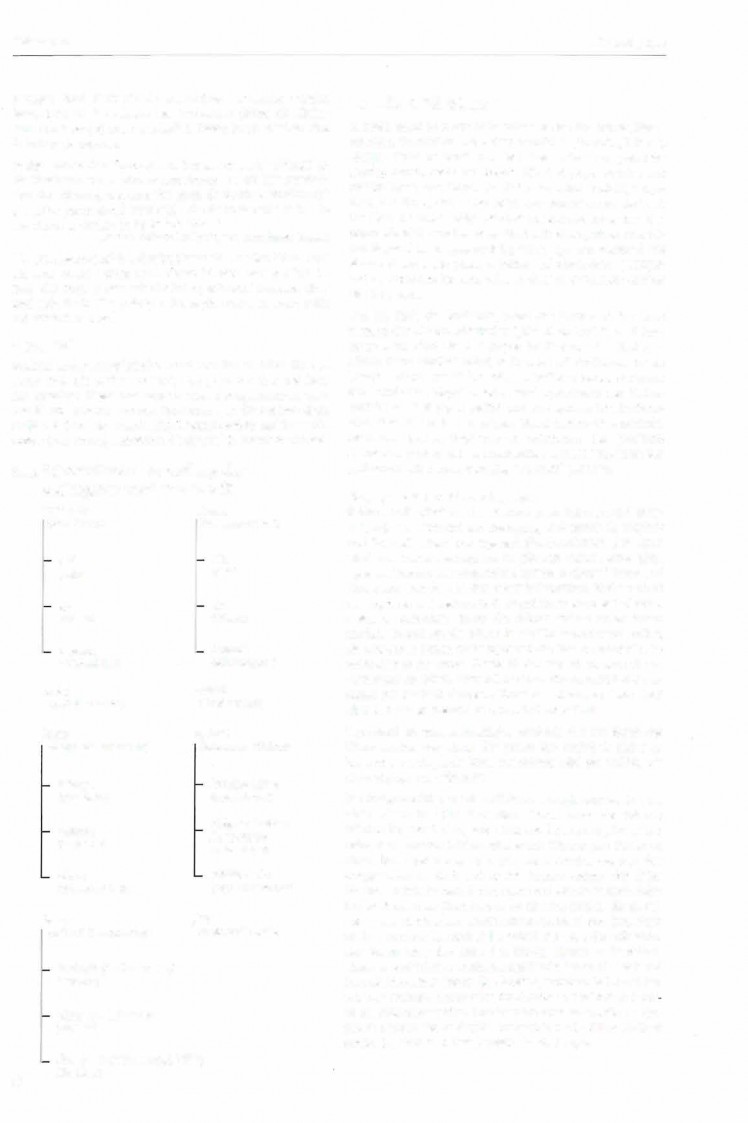
Jfiäna-yoga
beitetes Gold nicht für Schmuckstücke verwendet werden kann, kann auch brahman das Universum (ohne die Einfas sung durch mäyä) nicht erschaffen. Tsvara ist so gesehen eine Entartung brahmans.
In den Lehren des Christentums finden wir auch Anklänge an die Verehrung von brahman und Tsvara: ,,Da ist [der persönli che] Gott (Tsvara), und über ihm steht die Gottheit (brahman)." [ ... ] ,,[Der persönliche] Gott wirkt, die Gottheit wirkt nicht, sie
hat nichts zu wirken, in ihr ist kein Werk."
[Meister Eckhart: Predigt 11, Von unsagbaren Dingen]
Die „Bhagavad-gTtä" beschreibt Tsvara als „in allen Wesen auf dieselbe Weise vorhanden". Tsvara ist also der persönliche Gott, der Gott, zu dem wir alle beten, während brahman über und außerhalb aller geistigen Konzepte steht. Es kann nicht objektiviert werden.·
-
Brahma
Brahmä ist der schöpferische Aspekt der Hindutrinität. Die an deren sind, wie vorher erwähnt, Vi�r:,u, der Erhalter, und Siva, der Zerstörer. Diese drei Aspekte zusammengenommen wer den ,svara genannt. Andere Bezeichnungen für Brahmä sind: Prajä-pati (Herr der Geschöpfe), hira{)ya-garbha (goldenes Ei), mahat (das Große), siJträtman (Fadenseele), kosmischer Geist.
-
-
-
Schematische Darstellung der wichtigsten vedänta-Begriffe
-
-
Die drei gur:ias
-
-
Die drei gur:,as
Es heißt, mäyä oder prakrti bestehe aus den drei gu{)as (Eigen schaften, Grundsätze der Natur; ursprüngl. ,,Faden", ,,Schnur",
„Sehne eines Bogens" aus dem das Universum gewoben wurde): sattva, rajas und tamas. Die drei gu{)as wurden mit drei Strängen, aus denen der Strick der mäyä besteht, vergli chen, der Strick, durch den mäyä den Menschen an die Welt der Illusion bindet. Mäyä existiert nicht unabhängig von den gu{)as. Sie ist in verschiedenen Graden in allen groben oder fei nen Gegenständen gegenwärtig; Geist, Ego und Verstand mit eingeschlossen. Die gu{)as arbeiten auf physischen, geistigen und emotionalen Ebenen. Alles in diesem Universum enthält die drei gu{)as.
Und am Ende des Kreislaufs, wenn das Universum in einem Zustand der Nichtmanifestation (,,Nacht Brahmas") zurückge zogen wird, sind die drei gu{)as im Zustand des Gleichge wichts. Dann existiert mäyä, verbunden mit brahman, nur als Ursache, ohne irgendeine seiner Manifestationen. Aufgrund von karmischen Gegebenheiten wird irgendwann das Gleich gewicht der drei gu{)as gestört und sie beginnen ihre individu ellen Charakteristiken zu zeigen. Verschiedene Gegenstände, feine und grobe, beginnen zu existieren. Das greifbare Universum beginnt sich zu manifestieren. Diese Projektion des greifbaren Universums wird „Tag Brahmäs" genannt.
Die gur:,as drücken sich wie folgt aus:
brahman
(das Absolute)
sat
{Sein)
c(Witissen)
änanda
(Glückseligkeit)
mäyä
(Kraft der Illusion)
jagat
(manifestes Universum)
kära{)a
(Kausalwelt)
sük$ma
(Astralwelt)
sthüfa
(physische Welt)
Tsvara
(Gott mit Eigenschaften)
Brahmä r3 - SarasvatT c;> (Schöpfer)
Vi�r:,u r3 - Lak�mT (j) (Erhalter)
ätman
(das wahre Selbst)
sat
{Sein)
cit
(Wissen)
änanda
(Glückseligkeit)
avidyä
(Unwissenheit)
upädhi
(begrenztes Attribut)
kära{)a-sar,ra
(Kausalkörper)
sük$ma-sarira = linga-sarira (Astralkörper)
sthüla-sarira
(physischer Körper)
jTva
(individuelle Seele)
Sattva manifestiert sich im Menschen als Reinheit und Weis heit, rajas als Aktivität und Bewegung und tamas als Trägheit und Faulheit. Diese drei Eigenschaften/Qualitäten der Natur existieren immer gemeinsam. Es gibt kein reines sattva ohne rajas und tamas. Der Unterschied zwischen einem Wesen und einem anderen liegt in der verschiedenartigen Vorherrschaft der gu{)as. Solange ein Mensch irgendeinem gu{)a verhaftet ist, bleibt er gefangen. Sogar die Götter stehen unter ihrem Einfluss. In und um die Götter ist ein Übergewicht von sattva, die Menschen haben mehr rajas und die Wesen unterhalb des Menschen mehr tamas. Sattva bindet den Menschen mit der Verhaftung an Glück, rajas mit der Verhaftung an Aktivität und tamas mit der Verhaftung an Täuschung. Brahman allein steht über den drei gu{)as und ist von mäyä unberührt.
Yoga stellt die wissenschaftliche Methode dar, um durch das Überschreiten der Natur der gu{)as der Wahrheit näher zu kommen. Die folgende kurze Geschichte wird oft erzählt, um die drei gu{)as zu erläutern:
Die drei gu{)as können mit drei Räubern verglichen werden, die einen Mann im Wald überfallen. Tamas, einer der Räuber, möchte ihn vernichten, aber dank der Überredungskunst von rajas, dem zweiten Räuber, wird er mit Händen und Füßen an einen Baum gebunden, und alle seine Schätze werden ihm weggenommen. Nach einiger Zeit kommt sattva, der dritte Räuber, zurück. Er befreit den Mann von seinen Fesseln, führt ihn sanft aus dem Wald heraus bis zu einer Straße, die zu sei nem Haus führt. Dann nimmt sattva Abschied von ihm, denn auch er fürchtet als Räuber die Polizei und wagt deshalb nicht, den Mann über das Ende des Waldes hinaus zu begleiten. Tamas zerstört den Menschen, rajas bindet ihn an die Welt und beraubt ihn seiner spirituellen Schätze, sattva stellt ihn auf den Weg zur Freiheit. Tamas muss durch rajas und rajas durch satt va überwunden werden. Aber letztlich muss auch sattva aufge geben werden, wenn der/die Aspirant/in nach völliger Freiheit strebt. Die Wahrheit liegt jenseits der drei gu{)as.
Siva r3 - PärvatT, Durgä, Käli (j)
20 (Zerstörer)
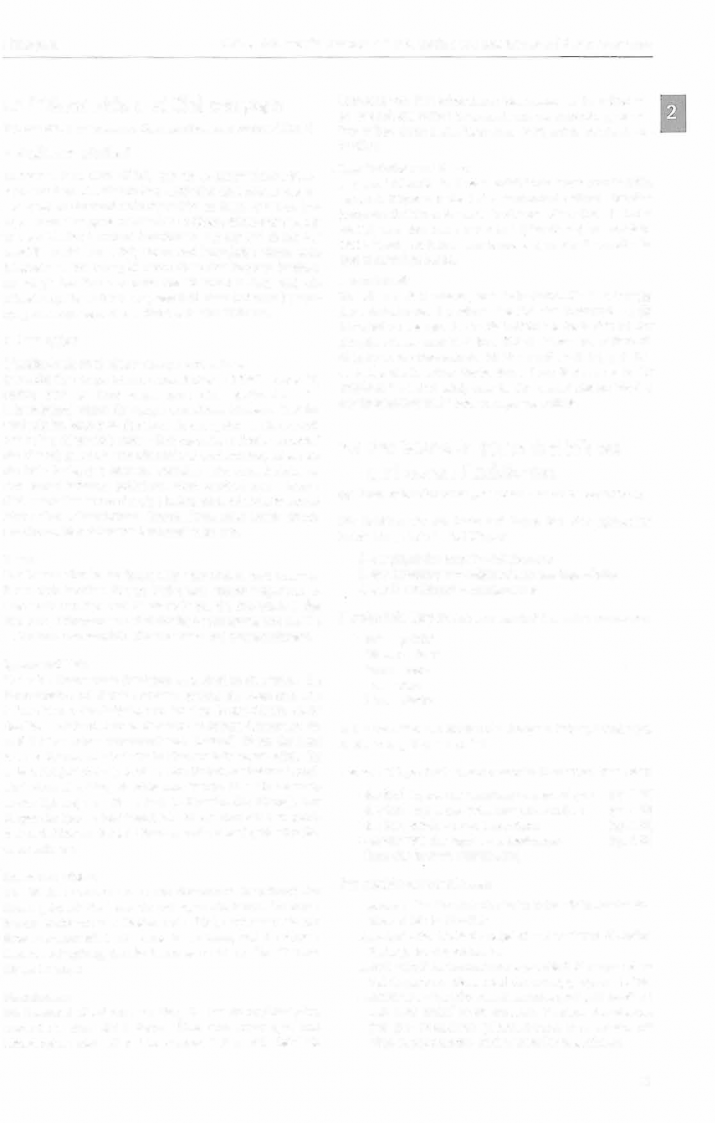
Jiiäna-yoga Philosophie und Ziel des yoga • Der Mensch: seine drei Körper und deren Funktionen
-
Philosophie und Ziel des yoga
(vgl. Swami Vishnu-devananda, ,,Das große illustrierte Yogabuch", Kap. 1)
-
Endlicher Intellekt
Immanuel Kant (1724-1804), der große ostpreußische Philo soph aus dem 18. Jahrhundert, entdeckte eine Mauer, die der menschliche Verstand nicht durchdringen kann. Er wiederhol te, was von allen großen indischen vedänta-Philosophen gesagt worden ist: Der Verstand funktioniert nur auf der Ebene der Realität und ist durch Zeit, Raum und Kausalität bedingt. Jede intellektuelle Erfahrung ist durch diese drei Faktoren bedingt. So bringt das Transzendieren des Verstandes dem yogT die höchste mystische Erfahrung, samädhi. Geist bedeutet Begren zung, die Abwesenheit von Geist bedeutet Erlösung.
-
Analogien
Dieselbe Seele ist in allem - Lampe und Schleier
Das Licht der Lampe ist von einem äußeren Schleier verdeckt, sodass man es nicht sehen kann (das repräsentiert das Mineralreich). Wenn die Lampe von einem dünneren Schleier verdeckt ist, kann man das Licht ein wenig stärker durchschei nen sehen (Tierreich). Hinter dem dünnsten Schleier erscheint die Menschenwelt. Wenn alle Schleier entfernt sind, sehen wir die freie Seele, den Weisen. Dasselbe Licht scheint hinter all den verschiedenen Schleiern, vom Groben zum Feinen. Gleichermaßen ist nur das eine Selbst, Gott, oder die Wahrheit hinter allen Lebensformen. Entschleiertes Bewusstsein ist rei ner ätman. Verschleiertes Bewusstsein ist Ego.
Raum
Der Raum selbst ist ein Zeuge aller Phänomene, wird aber von ihnen nicht berührt. Ebenso bleibt auch ätman ewiger Zeuge, außerhalb von Zeit und Raum stehend, die drei Stadien des Wachens, Träumens und Tiefschlafes beobachtend und sie alle im Zustand von samädhi (Oberbewusstsein) transzendierend.
Spinne und Netz
Das reine Bewusstsein (brahman oder siva) ist die Spinne, die Bewusstsein und Materie erzeugt, welche das Netz sind. Die Spinne ist nun das Subjekt, und das Netz ist das Objekt. Bevor das Netz entstand, war es eins mit der Spinne (Universum im ursächlichen oder unmanifestierten Zustand). Wenn das Netz von der Spinne selbst wieder in diese zurückgezogen wird, gibt es kein Subjekt-Objekt, sondern eine Einheit der beiden (yoga).
Leinwand von dem scheinbaren Geschehen auf ihr unberührt. So ist auch das reine Bewusstsein von der Schöpfung, die aus ihm selbst, durch seine handelnde Kraft, mäyä, entstand, un berührt.
. Glas (Behälter) und Raum
Die verschleiernde Kraft wird upädhi oder begrenzende Hülle genannt. Körper und Geist sind begrenzende Hüllen. Das Glas (upädhi) scheint den Raum in den inneren Raum (innerhalb des Glases) und den Raum außerhalb (des Glases) zu zerteilen. Diese Teilung ist jedoch nur illusorisch, da der Raum eins ist und unzertrennt bleibt.
Unendlichkeit
Wir können nicht wissen, was sie bedeutet. Sie liegt jenseits des intellektuellen Begreifens. Das Ziel aller Yogapraxis ist, die Wahrheit zu erlangen, in der die individuelle Seele sich mit der höchsten Seele oder Gott identifiziert. Hinter der veränderli chen Form des Bewusstseins ist die unveränderliche, gestaltlo se Seele, die in keiner Weise durch ihren Ausdruck oder ihr Empfinden berührt wird, aber in den verschiedenen Stadien der Entwicklung mehr oder weniger verhüllt ist.
-
-
Der Mensch: seine drei Körper und deren Funktionen
(vgl. Swami Vishnu-devananda, ,,Das große illustrierte Yogabuch", Kap. 2)
Die Behälter für die Seele auf ihrem Weg der spirituellen Entwicklung sind die drei Körper:
-
der physische Körper - sthüla-sarTra
-
der Astralkörper - sük�ma-sarTra bzw. linga-sarTra
-
der Kausalkörper - kärar:,a-sarTra
-
-
Der physische Körper setzt sich aus fünf Elementen zusammen:
-
Erde - prthivT
-
Wasser - äpas
-
Feuer - agni
-
Luft-väyu
-
Äther - äkäsa
Er hat verschiedene Stadien der Existenz: Geburt, Wachstum, Veränderung, Verfall und Tod.
Der Astralkörper besteht aus neunzehn Elementen, diese sind:
Die Spinne ist beides, die wirkende Ursache (das Lebensprinzip in der Spinne) und die materielle Ursache (ihr Körper). Der Körper der Spinne liefert das Material, aus dem das Netz gebil det wird. Aber es gibt kein Netz ohne die Energie, die nötig ist, es zu spinnen.
Sonne und Wolken
Die Wolken werden durch die Gegenwart (Handlung) der
-
die fünf Organe der Handlung - karmendriyas
-
die fünf Organe des Wissens -jiiänendriyas
-
die fünf Winde - väyus bzw. prär:,as
-
die vier Teile der Psyche - antaf:,karar:,a
(bzw. des inneren Instruments)
Das antaf:,karar:,a besteht aus:
(vgl. S. 22)
(vgl. S. 22)
(vgl. S. 22)
(vgl. S. 22)
Sonne geformt. Sie ihrerseits verbergen die Sonne. Die Sonne jedoch bleibt von den Wolken unberührt, auch wenn sie von ihnen verdeckt wird. Die Sonne ist brahman, und die Wolken sind die Schöpfung, die die Sonne verschleiern. Die Hitze der Sonne ist mäyä.
Filmleinwand
Die Leinwand bleibt von dem Film, der auf sie projiziert wird, unberührt. Man sieht Feuer, Überschwemmun-gen · und Katastrophen aller Art auf der Leinwand. Dennoch bleibt die
-
manas- Das Denkprinzip denkt und zweifelt: ,,Ist das eine Blume? Ist das Plastik?"
-
buddhi- Der Intellekt analysiert und bestimmt die wahre Natur jedes Gegenstandes.
-
citta - Im Unterbewusstsein liegen alle Erfahrungen eines Individuums aus diesem und den vorangegangenen Leben.
-
ahaf]1kära- Das Ichbewusstsein behauptet: ,,Ich weiß" od.
,,Ich weiß nicht." Es ist die letzte Funktion des Geistes. Das Ego ist dadurch gekennzeichnet, dass es sich mit allen auftauchenden Gedankenwellen identifiziert.
21
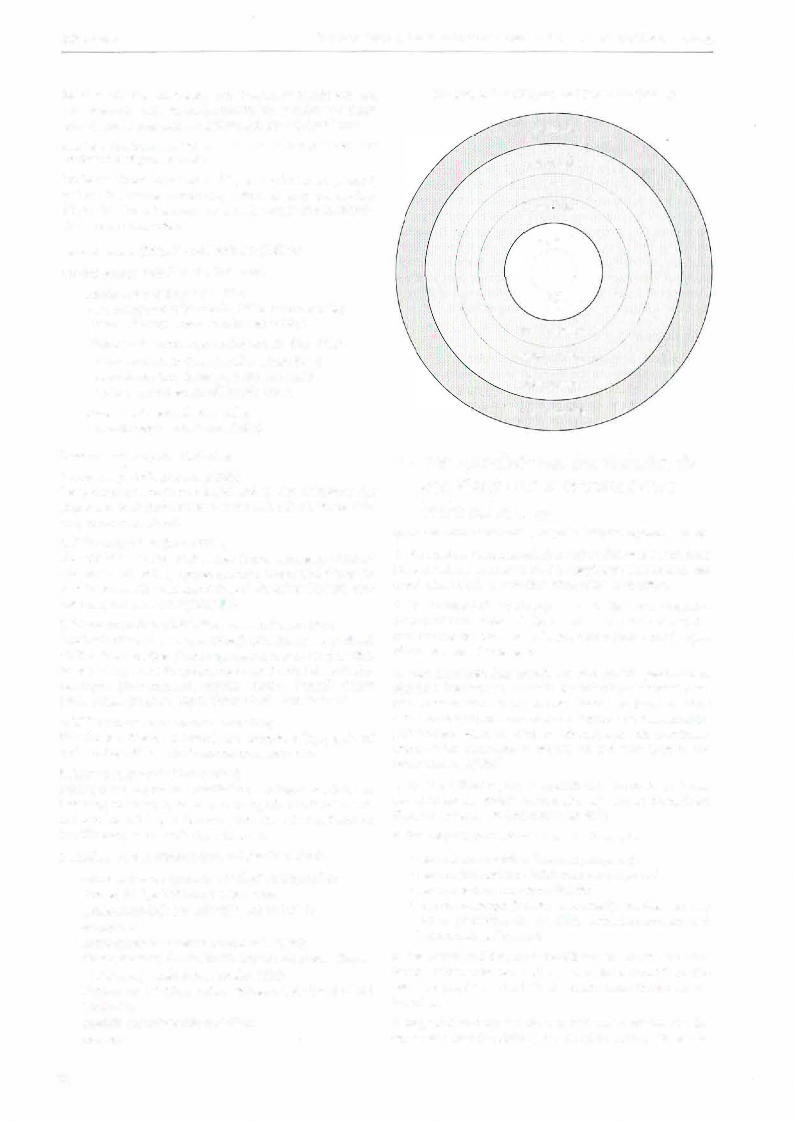
Jfiäna-yoga Der Astralkörper, das Geheimnis von Geist und außersinnlicher Wahrnehmung
Beispiel: Die Gedankenwelle von Traurigkeit taucht auf, das Ichbewusstsein schließt: ,,Ich bin traurig." Ein glücklicher Gedanke kommt, das Ichbewusstsein erklärt: ,,Ich bin glücklich" usw.
Anm.: Die Funktionen des Geistes werden im Teil vier, ,,Rojo-yoga und Meditation'; noch genauer erklärt.
Der Kausalkörper ist der Samenkörper. Er wird kausal genannt, weil er die Ursache sowohl des groben als auch des subtilen Körpers ist. Der astrale und der kausale Körper sind bleibend - sie gehören zusammen.
Die drei sariras (Körper) und fünf kosas (Hüllen)
Die drei sarTras enthalten die fünf kosas:
-
-
sthiJ/a-sarTra enthält eine Hülle:
-
anna-maya-kosa (physische Hülle/Nahrungshülle)
(anno - Nahrung; -maya - gemacht; kosa - Hülle)
-
-
siJk�ma-sarTra (bzw. liriga-sarTra) enthält drei Hüllen:
-
prar:,a-moya-kofo (Energiehülle, Lebenshülle)
-
mano-maya-kofo (geistig-emotionale Hülle)
-
vijnana-maya-kosa (intellektuelle Hülle)
-
-
käraQa-sarTra enthält eine Hülle:
-
änanda-maya-kofo (Wonnehülle)
-
Zusam mensetzung der fünf kosas:
-
Anna-maya-kosa (Nahrungshülle)
Der grobe physische Körper, bestehend aus den Elementen der physischen Welt (Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther), ist aus Nah rung zusammengesetzt.
-
Prä,:,a-maya-kosa (vitale Hülle)
Sie setzt sich aus den fünf prär:,as (Lebensenergien; Winden) zusammen, die präf')a, apäna, samäna, udäna und vyäna ge nannt werden. Hier befinden sich auch die cakras (Energie-zen tren) und die nädTs (Energiekanäle).
-
Mano-maya-kosa (Geisthülle bzw. emot ionale Hülle)
Ihre Bestandteile sind: manas (Geist), citta (Gedanke, Denken), die fünf karmendriyas (Handlungsorgane: Mund, Hände, Füße, Ausscheidungs- und Fortpflanzungsorgane) sowie die fünf jnä nendriyas (Wahrnehmungsorgane: Augen [Sehen], Ohren [Hören], Nase [Riechen], Zunge [Schmecken], Haut [Tasten]).
-
Vijfiana-maya-kosa (intellektuelle Hülle)
Sie wird von buddhi (Intellekt) und ahaf"(1kära (Ego) geformt und arbeitet mit den fünf Wahrnehmungsorganen.
-
Änanda-maya-kosa (Wonnehülle)
Erfahrung von Wonne im Tiefschlaf und savikalpa-samädhi. Um Befreiung zu erlangen, ist es notwendig, die Identifikation mit den upädhis (Hüllen) zu beenden, und sich mit dem Selbst zu identifizieren, das jenseits aller Hüllen ist.
Die Hüllen werden transzendiert und gereinigt durch:
-
anna-maya-kosa (physische Hülle/Nahrungshülle):
asanas, richtige Ernährung, Entspannung
-
prä,:,a-maya-kosa (Energiehülle, Lebenshülle):
prcif')ayäma
-
mano-maya-kosa (geistig-emotionale Hülle):
Singen, mantras, Rituale, Meditation und selbstloses Dienen
-
vijfiäna-maya-kosa (intellektuelle Hülle):
Studium der Schriften, rechtes Befragen (Wer bin ich?) und Meditation
-
änanda-maya-kosa (Wonnehülle):
-
samädhi
Die drei sarTras (Körper) und fünf kosas (Hüllen)
sthüla-sarira
sük$ma-sar,ra
bzw.
linga sar,ra
8
käraoa-sadra
'
1
\ änanda-maya
' kasa
vljnäna-maya-ka§a /
mano-maya-kosa präoa-maya-kosa
,.
anna-maya-kosa
2.s Der Astralkörper, das Geheimnis von Geist und außersinnlicher Wahrnehmung
(vgl. Swami Vishnu-devananda, ,,Das große illustrierte Yogabuch", Kap. 9)
-
Die meisten Menschen glauben nur an das, was sie mit ihren Sinnen wahrnehmen können. Sie akzeptieren alles Wissen, das durch diese Quellen erworben wird, ohne zu zweifeln.
-
Die vedanta-P.hilosophie sagt, dass die Welt vom absoluten Standpunkt aus unreal ist. Sie hat keine von Verstand und Sin nen des Beobachters unabhängige Wirklichkeit und ist daher nur im relativen Sinne wahr.
-
Vom absoluten Standpunkt aus sind sowohl gewöhnliche, sinnliche Erfahrungen als auch außersinnliche Wahrnehmun gen begrenzt und unvollkommen, denn ihre Kenntnis hängt vom Verstand ab, der seinerseits aber selber unvollkommen ist.
,,Die höchste Wahrheit wird nur erkannt, wenn die dreidimen sionale Welt transzendiert worden ist und man jenseits von Raum und Zeit geht."
-
Gedankenübertragung, Telepathie und alle anderen Dinge, die nicht genau erklärt werden können, sind in Wirklichkeit Phänomene einer vierdimensionalen Welt.
-
Der Astralkörper umfasst neunzehn Elemente:
-
die fünf karmendriyas (Handlungsorganen)
-
die fünf jnanendriyas (Wahrnehmungsorganen)
-
die fünf prar:,as bzw. vayus (Winde)
-
das antaf:,karar:,a (inneren Instrument), welches aus vier Teilen (Geist/Gemüt, Intellekt, Unterbewusstsein und Ichbewusstsein) besteht.
-
-
Der Astral- und der physische Körper sind durch eine feine Schnur miteinander verbunden, durch die Lebensströme flie ßen. Der physische Tod tritt ein, wenn diese Schnur durch trennt ist.
-
Geist und Materie sind die verschleiernden Mächte des Be wusstseins oder des Geistes, der die Welt erschafft. Diese ver-
22
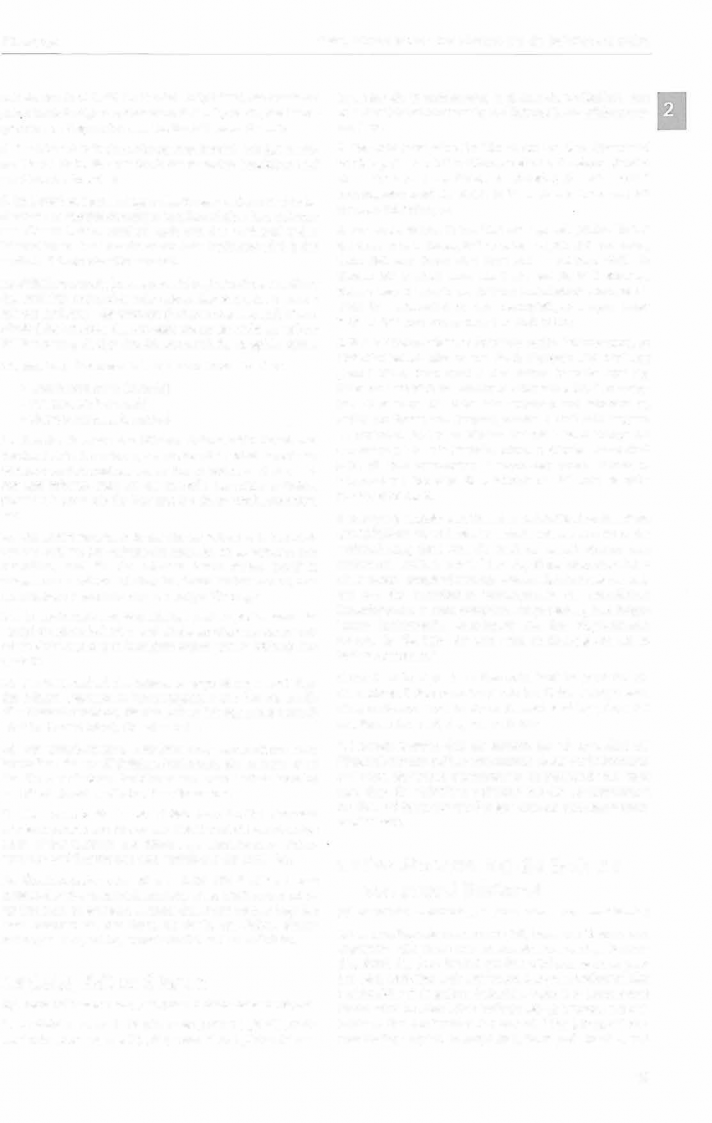
Jiiäna-yoga Geist, Zeit und Raum • Das Absolute und die Evolution von prakrti
schleiernde Kraft heißt im Sanskrit mäyä-sakti, die scheinbar pürna (vollständig) zu apürr:10 (unvollständig) macht, das Unbe grenzte zum Begrenzten und das Gestaltlose zu Formen.
-
Der Mensch teilt den unbewussten Bereich mit den niede ren Tieren. Es ist die erste Stufe der mentalen Entwicklung auf der Skala der Evolution.
-
Im Unterbewusstsein liegen alles Wissen und alle Eindrücke, die man aus verschiedenartigen Quellen erhalten hat, nicht nur aus diesem Leben, sondern auch von den vorhergehenden Inkarnationen. Das Unterbewusste oder Instinktive wird in der vedänta-Philosophie citta genannt.
-
Selbstbewusstsein (Ichbewusstsein) beginnt mit der Entfaltung des Intellekts. Kosmisches oder universelles Bewusstsein kommt mit der Entfaltung der Intuition (höheres Bewusstsein). Dieses allmähliche Wachsen des Bewusstseins ist ein wichtiger Teil der Erklärung menschlicher Entwicklung durch die Yogaphilosophie.
-
Man kann Bewusstsein in drei Funktionen einteilen:
-
Unterbewusstsein (Instinkt)
-
Bewusstsein (Vernunft)
-
Überbewusstsein (Intuition)
-
-
Das Aufdämmern des höheren Geistes wirkt darauf, den Verstand auf sich zu ziehen, der niedere Geist wirkt darauf, den Verstand zurückzuziehen. Dieser Kampf zwischen dem niede ren und höheren Geist um die Kontrolle des mittleren Geistes (Intellekt) begann, als der Verstand in seinem Kindheitsstadium war.
-
Das Unterbewusstsein ist der Sitz der Wünsche, Leidenschaf ten und Gelüste. Die Aufgabe des Intellekts ist es, Vernunft aus zustrahlen, und die des höheren Bewusstseins, intuitives Wissen auszustrahlen. Intuition ist direkte Wahrnehmung oder unmittelbare Erkenntnis ohne vorheriges Überlegen.
-
In mythologischen Geschichten und Legenden wird der Kampf zwischen höherem und niederem Geist als Kampf zwi schen devas und asuras (positiven und negativen Kräften) dar gestellt.
-
Die Wissenschaft des Geistes im yogo ist sogar noch über das höhere Bewusstsein hinausgegangen und hat die Quelle aller Weisheit entdeckt, die den ewigen Frieden und die unauf hörliche Freude bringt, die jeder sucht.
-
Der unterbewusste, instinktive oder automatische Geist kontrolliert die unwillkürlichen Funktionen des Körpers. Er ist der Sitz der niederen Emotionen und animalischen Instinkte und führt die automatischen Funktionen aus.
-
Der bewusste Geist oder Intellekt kann das Unterbewusst sein kontrollieren und führen und dient hauptsächlich dem Ego oder Ichbewusstsein als Werkzeug. Nachdenken, Unter scheiden und Entscheiden sind Funktionen des Intellekts.
-
Überbewusster oder höherer Geist: Die Funktion dieses Geistes, der über dem Intellekt steht, ist es, Intuition und höhe res Erkennen zu erlangen. Jenseits dieser drei Stadien liegt das reine Bewusstsein, der Geist, die Seele, das Selbst, dessen Natur gestaltlos, zeitlos, unveränderlich und unendlich ist.
-
-
Geist, Zeit und Raum
(vgl. Swami Vishnu-devananda, ,,Das große illustrierte Yogabuch", Kap. 9)
-
Der Geist kann nur in Begriffen wie „vorher", ,,jetzt", ,,nach her" oder „Vergangenheit", ,,Gegenwart" und „Zukunft" den-
ken. Aber die Yogaphilosophie sagt, dass die Wirklichkeit, Gott oder die Wahrheit nur jenseits von Zeit und Raum erfahren wer den kann.
-
Der Geist kann seine Funktionen nur vor dem Hintergrund von Kategorien von Zeit und Raum ausführen. So wie der Künstler eine Leinwand (oder ähnliches Material) für seine Arbeit braucht, verwendet der Geist die Elemente von Raum und Zeit für seine Schöpfungen.
-
Der große Meister Eckhart hat auch gesagt: ,,Nichts hindert die Seele so sehr daran, Gott zu erkennen, wie Zeit und Raum, denn Zeit und Raum sind Bruchstücke, während Gott ein Ganzes ist." Deshalb muss die Seele, will sie Gott erfahren, wissen, dass Er jenseits der Zeit und außerhalb des Raumes ist. Denn im Unterschied zu den mannigfaltigen Dingen dieser Welt ist Gott weder dies noch das. Gott ist Eins.
-
Zeit und Raum existieren im Wach- und im Traumzustand. Im Tiefschlaf jedoch gibt es nur die Erfahrungen „ Ich bin" und
„Jetzt". Wenn Konzentration des Geistes herrscht oder der Geist sehr glücklich ist, scheint die Zeit sehr schnell zu verge hen. Aber wenn der Geist sehr aufgeregt und zerstreut ist, erfüllt von Sorgen und Ängsten, scheint die Zeit sehr langsam zu verrinnen. Im Traum können Ereignisse einer Zeitspanne von zwanzig Jahren in fünfzehn Minuten ablaufen. Diese fünf zehn Minuten entsprechen dennoch den zwanzig Jahren im Wachzustand. Das zeigt die Relativität der Zeit oder vielmehr ihre Unwirklichkeit.
-
Der große Einstein weist in seiner Relativitätstheorie auf die Unwirklichkeit der Zeit hin. Er erklärte Zeit als eine Form der Wahrnehmung (eine Art, die Welt zu sehen), ähnlich dem Farbensinn. Einstein verwarf den Begriff der absoluten Zeit - eines steten, unveränderlichen, universellen Stromes der Zeit, der von der unendlichen Vergangenheit zur unendlichen Zukunft strömt. Er sagte weiterhin: ,,Es gibt keine genau festge legten Zeitintervalle, unabhängig von dem zugeordneten System. Es gibt kein Hier und Jetzt, unabhängig von einem Beziehungssystem."
-
Der Geist ist nicht durch Geschwindigkeit begrenzt (so wie alle anderen Phänomene des physischen Universums); er kann einen entfernten Stern in einem Moment erreichen, denn Zeit und Raum sind Schöpfungen des Geistes.
-
Die yogTs erklären, dass der Mensch, der sich entwickelt, die Fähigkeitbekommt, auf höheren geistigen Ebenen zu funktionieren und seine physischen Begrenzungen zu transzendieren. Yoga sagt, dass die endgültige Befreiung aus der Umklammerung von Zeit und Raum nur möglich ist, wenn der Geist selbst trans zendiert wird.
-
-
Das Absolute und die Evolution von prakrti {Materie}
(vgl. Swami Vishnu-devananda, ,,Das große illustrierte Yogabuch", Kap. 10)
-
Das eine Absolute wurde durch Zeit, Raum und Ursache zum Universum. Zeit, Raum und Ursache sind wie farbiges Fenster glas, durch das das Absolute gesehen wird und wenn es gese hen wird, erscheint es als Universum. Der große Dichter Shelley bezieht sich auf denselben Gedanken, wenn er in einem seiner Werke schreibt: ,,Das Leben befleckt wie eine Kuppel aus viel farbigem Glas das Strahlen der Ewigkeit." Das Leben, auf wel ches Shelley anspielt, ist mäyä (Zeit, Raum _und Ursache), und
23
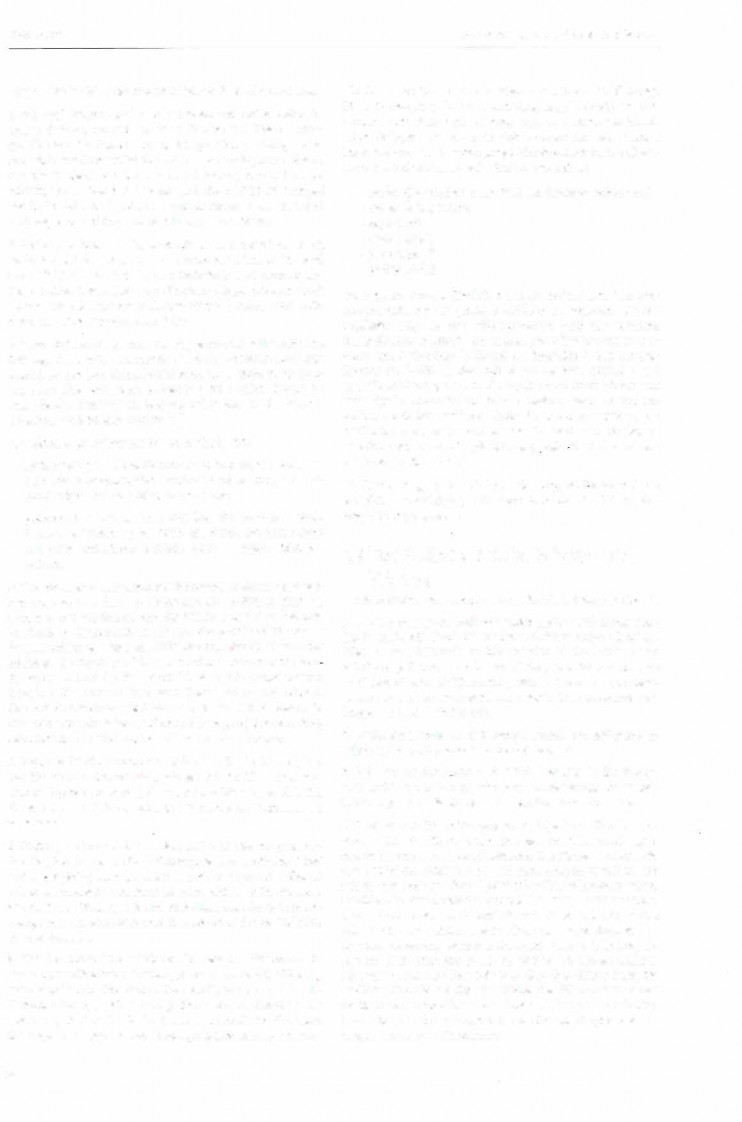
JF\äna-yoga
,,das weiße Strahlen der Ewigkeit" ist das Absolute, brahman.
-
Die Seele ist ganz und unteilbar. Geist und Materie sind Teil dieses Ganzen, das sich in vielen Graden und Eigenschaften manifestiert. Die Seele ist unendlich, gestaltlos, untätig, unver änderlich und Beobachter des Geistes. Die Analogie vom Raum, der gleich bleibt, als Beobachter all dessen, was in ihm ge schieht, veranschaulicht dies sehr gut. Die sakti (Kraft, Energie) der Seele - die sich in fein- und grobstofflicher Form ausdrückt
- ist begrenzt und befindet sich im stetigen Wandel.
-
Seele oder Bewusstsein, einerseits unveränderlich (als siva), verändert sich in einem anderen Aspekt als aktive Kraft (sakti) und drückt sich aus in Geist und Materie. Der Mensch ist also Seele, reines Bewusstsein, das Absolute, eingeschlossen durch die verhüllende Kraft von Geist und Körper (Analogie von Lein wand und darauf projiziertem Film).
-
Wenn Erkenntnis jenseits der Begrenzungen von Raum und Zeit liegt, ist es keine Erkenntnis. Wenn das Absolute durch den Geist begrenzt (von ihm erkannt) wird, ist es nicht mehr abso lut, denn alles vom Geist Begrenzte wird endlich. Darum ist
„das Absolute kennen" ein Widerspruch in sich von der Art „ein erkannter Gott ist kein Gott mehr".
-
Vedänta sagt, Erkenntnis ist von zweierlei Art:
jfiäna-svarüpa - die vollkommene Erfahrung von Bewusst sein (die in asal)1prajfiäta-samädhi erreicht wird), auch als parä-vidyä (höchstes Wissen) bezeichnet
jfiäna-v.rtti - Wissen über Objekte, die normale unvoll kommene Erfahrung der Welt, die durch die Verbindung mit Geist und Sinnen entsteht, auch als aparä vidyä be zeichnet
-
Vivarta-väda - Sankaräcäryas berühmte Erklärung der Ver bindung zwischen dem Absoluten und der endlichen Welt. Sie kommt in der Geschichte von der Schlange und dem Seil zum Ausdruck. In der Dunkelheit hält man das Seil fälschlicherweise für eine Schlange. Wenn das Licht kommt, wird die Illusion der Schlange, die durch das Fehlen des Lichtes hervorgerufen wur de, zerstreut und das Seil erscheint wieder in seiner wahren Gestalt. infolge unserer Unwissenheit erscheint uns die Existenz der endlichen Welt wie die Schlange in der Dunkelheit. Wenn die Erkenntnis des Einsseins aufdämmert (asal)1prajfiäta-samädhi) verschwindet die Welt und es existiert nur das Absolute.
-
Kury;ialinT ist die Summe aller Kräfte in allen Universen, den manifesten und den astralen, wie sie sich im Menschen aus drückt. Ku()<;ia!a bedeutet „Ring", ,,aufgerollt". Aufgerollt heißt, sie wartet darauf, das vollständige Potenzial im Menschen zu erwecken.
-
Tantra-yoga befasst sich mit siva und sakti. Die entsprechen den Begriffe in der vedänta-Philosophie sind brahman (siva) und mäyä (sakti). Siva und sakti sind ein und dasselbe. Siva ist reines Bewusstsein und sakti ist seine aktive Kraft. Genauso wie Milch aus Wasser, Fett und Mineralien besteht, die zusam mengenommen eben Milch ergeben, so ist auch siva und sakti ein und dasselbe.
-
Vor der Schöpfung existierte das gesamte Universum in einem unmanifestierten Zustand, genannt pra!aya (Auflösung, kosmische Nacht). Dies kann mit einem Ei, in dem sich ein pul sierender Embryo befindet, verglichen werden. Obwohl keine Bewegung sichtbar ist, ist im Inneren Aktivität. Es gibt keine Störungen, so lange bis eine Schwingung (spandana) entsteht,
24
Das Selbst als Sein, Wissen und Wonne
die Schale zerbirst und das Küken ausschlüpft (Schöpfung). Diese Schwingung, die die Erschaffung (sr�ti, Srishti) des Uni versums herbeiführt (kosmischer Tag), wird durch die karmi schen Anlagen verursacht, die sich in einem kausalen Zustand befinden. Aus der Urschwingung (näda-brahman bzw. 01)1) ent steht das Universum in sechs Stufen. Diese sind:
-
mahat (kosmischer Geist, Brahma, hira()ya-garbha etc. )
-
äkäsa (Äther, Raum)
-
väyu (Luft)
-
tejas (Feuer)
-
ja!a (Wasser)
-
P(thivT(Erde)
-
-
Derselbe Prozess (Evolution und Involution) findet im Indi viduum statt, das ein genaues Abbild des Universums ist. Die ku()<;ialinT steigt ab vom sahasrära-cakra (höchsten Zentrum, tausendblättrigen Lotos) zum mO!ädhära-cakra (untersten Zen trum) und bleibt dort. Während die ku()<;ia!inT in den unteren Zentren ist, heißt es, das Individuum genieße sinnliche und sexuelle Erfahrungen. Wenn die ku()<;ia!inTauf ihrem Rückweg zu ihrer Quelle sahasrära zu steigen beginnt, wird Schicht um Schicht des Geistes erfahren. Große Freude wird erfahren, die schließlich zum ewig wonnevollen Zustand von nirvika/pa samädhi wird, wenn die göttliche ku()da!inT Kraft Vereinigung mit ihrer Quelle erreicht.
-
Dieser Vorgang des Steigens der ku()<;ia!inT sakti und die endgültige Vereinigung mit dem Bewusstsein (siva) wird ku()<;ialinT-yoga genannt.
-
-
Das Selbst als Sein, Wissen und Wonne
(vgl. Swami Vishnu-devananda, ,,Das große illustrierte Yogabuch", Kap. 11)
-
Die verschleiernde Kraft von mäyä (sakti) wird immer stär ker, je mehr wir durch die niederen Existenzstufen absteigen (Tier, Pflanze, Mineral). Im Mineralreich ist der Schleier von mäyä am gröbsten - es ist der niedrigste Seinszustand. Das Licht (Selbst oder Gott) scheint gleichermaßen in allen Lebe wesen, aber ist in einem größeren oder kleineren Ausmaß ver borgen, je nach dem Bereich.
-
,, Selbsterkenntnis ist das einzige Mittel, um Befreiung zu erlangen." (vgl. ,,Ätmabodha" von Ädi Sarikaräcärya)
-
Jeder ist auf der Suche nach Glück. Kein Objekt der Sinnes weit und keine Erfahrung wird jemals vollständige Zufrieden heit bringen und die Suche nach dem Ersehnten beenden.
-
Parabel: Zehn Menschen gingen auf Pilgerfahrt. Sie kamen zu einem reißenden Strom und hatten kein Boot, ihn zu überque ren. So beschlossen sie zu schwimmen. Der Führer erreichte die ferne Küste als Erster und begann seine Gruppe zu zählen, um sich zu vergewissern, dass alle sicher herübergekommen waren. Er zählte die Gruppe wieder und wieder, aber er fand nur neun seiner Kameraden vor. Verzweifelt forderte er jeden Pilger der Reihe nach auf zu zählen. Das Ergebnis war immer das gleiche - nur neun waren angekommen. Nun setzten sich alle und began nen um ihren toten Kameraden zu weinen. Da kam ein anderer Pilger des Weges und fragte sie nach dem Grund ihrer Klage. Sie erzählten ihm die traurige Geschichte. Der Pilger erkannte das Problem sofort und klärte sie darüber auf: ,,Jeder von euch zähl te der Reihe nach die anderen Mitglieder der Gruppe, aber er vergaß, sich selbst mitzuzählen."
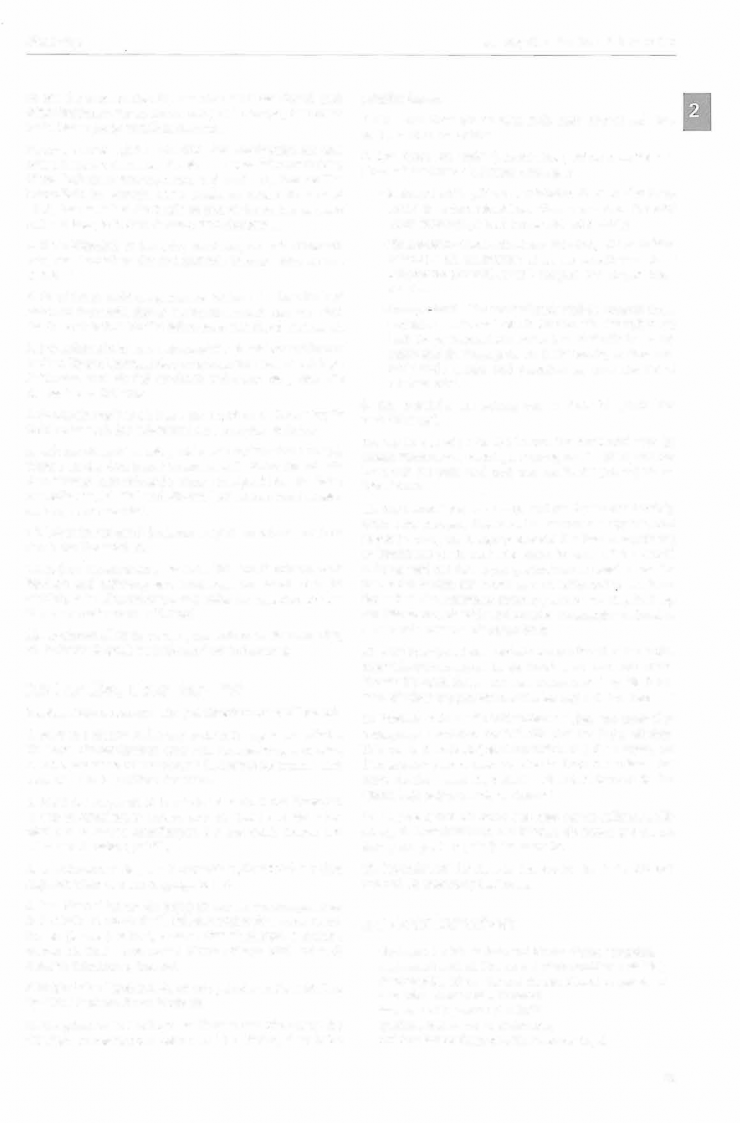
Jnäna-yoga
So wie die unwissenden Pilger suchen auch wir überall nach Glück (Reichtum, Ruhm, Macht usw.) und beklagen, dass etwas fehlt. Dieses Etwas ist Selbsterkenntnis.
Parabel: In Indien gibt es ein Wild, das Moschustier, das eine Drüse in seinem Nabel hat, die einen starken Duft ausscheidet. Dieser Duft ist so intensiv, schön und betörend, dass das Tier herumläuft im Versuch, seine Quelle zu finden. Es erkennt nicht, dass es selbst die Quelle ist und verbraucht so all seine Zeit und Energie in dem Versuch, sie aufzuspüren.
-
Die Wirklichkeit ist das „Ich", das Selbst, das reine Bewusst sein, der Beobachter der drei Zustände Wachen, Träumen und Tiefschlaf.
-
So wie man nicht die getrennte Existenz des Tons im Topf sieht und doch weiß, dass er aus Ton ist, so sieht man auch nicht den Zustand des individuellen Selbst, wenn man das Absolute kennt.
-
Das Selbst scheint stets unbedingt für die Weisen und immer bedingt für den Unwissenden, so wie das Seil durch die richtige Sichtweise auch als Seil erscheint und durch die getäuschte Sichtweise als Schlange.
-
So wie ein Topf nur ein Name für Ton ist oder ein Ohrring für Gold, so ist auch das Individuum ein Name des Höchsten.
-
,,Ich bin Wonne" ist kein geliehener vergänglicher Zustand. Wonne ist die dem Selbst innewohnende Natur (so wie die dem Wasser innewohnende Natur Flüssigkeit ist). Die Natur des Selbst ist „Ich bin" und „Wonne". Sie können nicht vonein ander getrennt werden.
-
Leben ist nur durch brahman möglich, so wie der Topf nur durch den Ton existiert.
-
Jegliche Einschränkung des Selbst ist eine Täuschung. Auch Bindung und Befreiung sind Illusionen. Das Selbst, Gott, ist wirklich, es ist allgegenwärtig. Wie sollte also irgendetwas exis tieren, das es begrenzen könnte?
-
,,Brahman allein ist wirklich, das Universum ist unwirklich, die individuelle Seele ist brahman." (Ädi Sarikaräcärya)
-
-
Der Sieg über den Tod
(vgl. Swami Vishnu-devananda, ,,Das große illustrierte Yogabuch", Kap. 11)
-
Sterben bedeutet Auflösung, und Auflösung ist nur möglich für Dinge, die das Ergebnis einer Zusammensetzung sind; alles, was sich aus einem oder mehreren Elementen zusammensetzt, muss sich wieder auflösen (sterben).
-
Wenn der Körper stirbt, kehrt die Lebenskraft des Menschen in seinen Astralkörper zurück, und die Seele des Menschen wird nun in seinen Astralkörper, der aus Geist, Sinnen und Lebenskraft besteht, gehüllt.
-
Im Astralkörper liegen alle saf'!)skaras (Eindrücke) aus dem gegenwärtigen und aus vergangenen Leben.
-
Der Himmel (sagen die yagi's) ist nur ein vorübergehender Aufenthaltsort, wo die Seele sich der Früchte ihrer guten Hand lungen (karmas) erfreut, solange ihre Verdienste andauern, worauf die Seele einen neuen Körper anlegen wird und nach weiterer Entwicklung trachtet.
-
Es gibt keine Handlung, die an sich gut oder schlecht ist: Ihre Qualität hängt von ihrem Motiv ab.
-
Alle guten und schlechten Handlungen sind wie Ketten, die die Seele an das Rad von Geburt und Tod binden, denn beide
Der Sieg über den Tod • Reinkarnation
schaffen karma.
-
Ohne den Geist gibt es keine Welt, auch Himmel und Hölle sind Produkte des Geistes.
-
Drei Arten von malas (Unreinheiten) stehen dem Versuch einer erfolgreichen Meditation entgegen:
-
Selbstsucht (die gröbste Unreinheit)- Sie ist in allen Men schen in unterschiedlichem Grad vorhanden. Sie wird durch karma-yoga (selbstloses Dienen) beseitigt.
-
vik�epa-sakti - Zerstreutheit und Ruhelosigkeit des Geistes behindert die Meditation. Diese Unreinheit wird durch prar,ayama (Atemübungen), Hingabe und Singen über wunden.
-
avarar,a sakti - Die verschleiernde Kraft des Geistes ist die subtilste und sie verbirgt die Wirklichkeit, das Selbst. Sie läs�t Körperbewusstsein entstehen. Vedantische Medi tation und die Frage „Wer bin ich?" beseitigen diese ver schleiernde Macht und gestatten es, dass das Selbst erfahren wird.
-
-
Die wörtliche Bedeutung von vedänta ist „Ende des veda/Wissens".
-
01?1 ist das Wort der Schöpfung. Das Wort wird auch im Neuen Testament erwähnt: ,,Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort." [Joh 1:1] Dieses Wort ist Of'!).
-
01?1 besteht aus a - u - f'!), und die Regeln der Sanskrit Grammatik besagen, dass a und u zusammen o ergeben, und so aus a- u - f'!) der Klang Of'!1 entsteht. Der Klang a ist guttural; er kommt aus der Kehle. In der Mitte der Mundhöhle entsteht
u. Das f'!1 wird mit den Lippen gebildet und ist nasal. So verkör pert a den Beginn der Tonreihe, u die Mitte und m das Ende. 01?1 erfasst den gesamten Stimmapparat. So repräsentiert Of'!) alle Klänge und, da Welt und Sprache miteinander verbunden sind, repräsentiert es die ganze Welt.
-
Vom Standpunkt des vedänta aus verkörpert a das grobe, materielle Universum, das im Wachzustand erfahren wird, u ver körpert die Astralebene und den Traumzustand, f'!1 die Erfah rung, die über und jenseits des Geistes liegt und den Tiefschlaf.
-
Vedänta definiert die Wirklichkeit als „das, was unter allen Bedingungen bestehen bleibt". Alle drei Zustände, Wachen, Träumen und Tiefschlaf, sind unwirklich, da jeder vergeht, um dem anderen Platz zu machen. Nur der Beobachter dieser drei Zustände, das wahre Ich, verändert sich nicht. Jenseits der Zu stände liegt turi'yä, der vierte Zustand.
-
Im yoga gehen wir davon aus, dass nur die Selbstverwirkli chung, Gottverwirklichung, den Frieden, die Freude und die Be freiung bringen kann, die jeder anstrebt.
-
Gebundensein der Seele ist Tod. Freiheit der Seele ist Befrei ung und Überwindung des Todes.
-
-
Reinkarnation
Gestorben bin ich als Stein und bin zur Pflanze geworden; gestorben bin ich als Pflanze und wiedererschienen als Tier; gestorben bin ich als Tier und bin zum Menschen geworden; was sollte ich denn also fürchten?
Wen verlor ich je durch den Tod? Nächstes Mal sterbe ich als Mensch,
auf dass ihm wachsen die Schwingen der Engel.
25
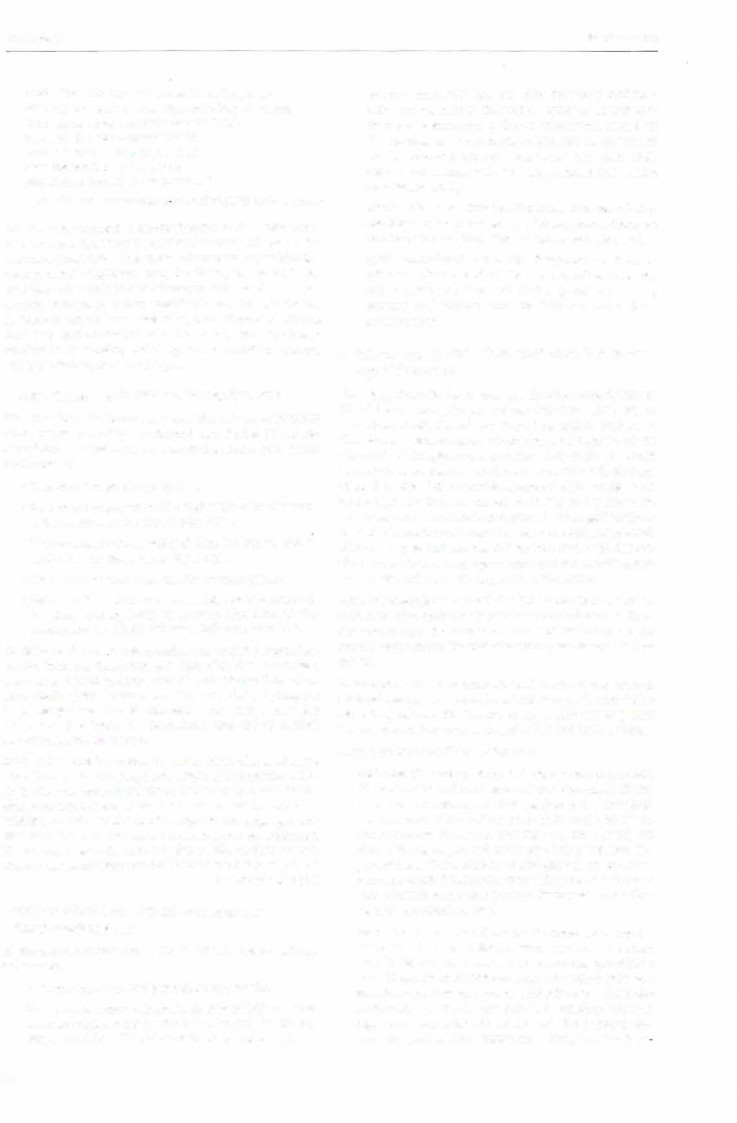
Jfiäna-yoga
-
Doch selbst vom Engel noch muss ich weitergehen;
alle Dinge werden vergehen, doch nicht Sein Angesicht. Noch einmal erhebe ich mich über die Engel;
ich werde das, was unvorstellbar ist. Dann lass mich werden nichts, nichts, denn Harfenklänge riefen mir zu:
,,Wahrlich zu Ihm gehen wir zurück ... "
- Dscha/ä/ ad-DTn Muhammad ar Rüm, (1207-1273), Sufi und Dichter
Mit den oben stehenden Worten beschreibt der große mysti sche Poet und Sufi RümT in wundervoller Weise die Essenz der Reinkarnationslehre. Der Sinn des Lebens ist es, sagen Mystiker verschiedener Religionen, Gott, das Selbst, zu verwirklichen. Dies kann aber nicht in der Zeitspanne eines einzigen Lebens erreicht werden. Es dauert unzählige Leben, bis das Ziel der spirituellen Entwicklung erreicht ist, vom Mineral zur Pflanze zum T ier und schließlich zum Menschen. Nur in diesem Stadium ist es möglich, Befreiung vom Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt zu erlangen.
-
Geschichte des Reinkarnationsgedankens
Die Frage über das Leben nach dem Tod hat die Menschheit schon immer beschäftigt. Die Antwort darauf prägt die Lebens einstellung entscheidend. Die populärsten Antworten darauf sind gewesen:
, Nach dem Tod ist alles zu Ende.
-
Nach dem Tod kommt man je nach eigenen Verdiensten in immerwährenden Himmel oder Hölle.
-
Man kann nicht wissen, was nach dem Tod kommt, und es spielt auch für dieses Leben keine Rolle.
-
Nach dem Tod führt man eine Art Schattendasein.
-
Nach dem Tod geht man in eine subtile Welt (Astralwelt), um dann wiedergeboren zu werden. Man wird solange wiedergeboren, bis die Erlösung, Befreiung erreicht ist.
Der letzte Gedanke, die Reinkarnation, war und ist der populärs te. Alle östlichen Religionen, wie auch viele der Naturvölker, glaubten und glauben daran. Auch die griechischen Mysterien kulte sowie einige Philosophen (Sokrates, Plato, Pythagoras
-
a.) gingen von der Reinkarnation aus. Einige Teile des Judentums (bis heute die Kabbalisten und die Chassidim) glaub(t)en an Reinkarnation.
Auch in der christlichen Religion finden wir Anklänge an diese alten Lehren der Wiedergeburt. Origenes Adamantius (185- 254), einer der größten Gelehrten und Theologen des christli chen Altertums, sagte: ,,Jede Seele hat von allem Anfang an existiert, ist daher schon durch einige Welten gegangen und wird noch durch weitere gehen müssen, bevor sie endgültige Vollendung erreicht. Sie kommt in diese Welt, gestärkt von den Siegen oder geschwächt von den Niederlagen früherer Leben."
[De Principiis 3.1,20,21]
-
-
-
Wissenschaftliche Untersuchungen zur Reinkarnationslehre
Es gibt mehrere Gründe für die Popularität des Reinkarnations gedankens:
-
Er ist der logischste und befriedigendste Glaube.
, Es gab immer schon Menschen, die sich an frühere Leben erinnert haben. In der heutigen Zeit hat Prof. lan Steven son viele solcher Fälle dokumentiert und untersucht.
Reinkarnation
-
Manche Menschen sind aus dem Scheintod zurückge kehrt und berichteten über astrale Erfahrungen und veri fizierbare Wahrnehmung, die ein Weiterleben nach dem Tod nahelegen. In der heutigen Zeit gibt es, beginnend mit Dr. Raymond Moodys „Das Leben nach dem Tod", viele Untersuchungen über die sogenannten Near Death Experiences (NDE).
-
Manche Menschen (Medien, Hellseher, Schamanen) kön nen Kontakt zu Astralwesen und Astralwelten aufnehmen und berichten so direkt über das Leben nach dem Tod.
-
Spirituelle Meister/innen in allen Religionen und Kulturen erinnern sich in der Meditation an ihre früheren Leben, haben Zugang zu allen drei Welten (physische, astrale, kausale) und können auch die früheren Leben ihrer Schüler sehen.
-
-
Reinkarnation und Leben nach dem Tod in der Yogaphilosophie
Die Yogaphilosophie lehrt, dass uns die sarr,skaras (geistigen Eindrücke aus dem jetzigen und den früheren Leben, die im Unterbewusstsein liegen) von Geburt zu Geburt treiben, in dem Versuch, diese unzähligen Wünsche zu befriedigen. So wie eine starke Abhängigkeit den Süchtigen dazu treibt, die Droge immer wieder zu nehmen, auch wenn er es nicht will, ist unser Wunsch, in einen Körper zurückzukehren und uns wieder in die Erfahrungen der Sinne zu stürzen, viel tiefer, als wir erkennen, und daher muss unser sadhana (spirituelle Übungen) regelmä ßig und ununterbrochen sein. Nur wenn die sarr,skaras durch sadhana ausgerottet und zerstört worden sind, wird das Sta dium des vollkommenen yoga erreicht und die Notwendigkeit und der Wunsch nach Wiedergeburt zu Ende sein.
Wünschenswert ist es, sich auf den Tod vorbereiten zu können. Viele Menschen erahnen ein paar Tage oder mindestens Stun den vorher, dass sie sterben werden. Vor der Erfindung von Intensivstationen und künstlicher Beatmung war dies viel häufiger der Fall.
Im Moment des Todes (oder danach) durchlebt der Mensch nochmals sein ganzes Leben (eventuell auch die letzten frühe ren Leben), erkennt die zusammenhänge, auch was er gelernt hat und welche Lektionen er begriffen hat und welche nicht.
Dann kann er in drei Ebenen eingehen:
Bhür-loka (Erdebene) entspricht dem prana-maya-kosa. Die Seele hört und sieht alles auf der physischen Ebene, kann aber normalerweise nicht gesehen und gehört wer den und kann nichts auf der physischen Ebene bewirken. Dieser Zustand dauert ca. drei Tage an. Ein Mensch mit starken Verhaftungen und einem plötzlichen Tod kann län ger auf dieser Ebene bleiben. Er wird dann als preta (erdge bundener Geist) bezeichnet. Pretas können sich manchmal auch physisch bemerkbar machen (Poltergeist, oder über Medien, Besessenheit usw.).
Bhuvar-loka (Astralebene) entspricht mano-maya-kosa. Die Seele lebt in einer geistigen Welt, die aus Gedanken besteht. Woran auch immer man denkt, das verwirklicht sich. Oft geschieht ein Wiedersehen mit verstorbenen Ver wandten oder Freunden (daher auch pitr-laka - Ebene der Vorfahren). Die Seele hält sich hier zwischen wenigen Tagen und Hunderten von Jahren auf. Hier herrscht aber auch ein ganz anderes Zeitgefühl. Normalerweise inkar
26
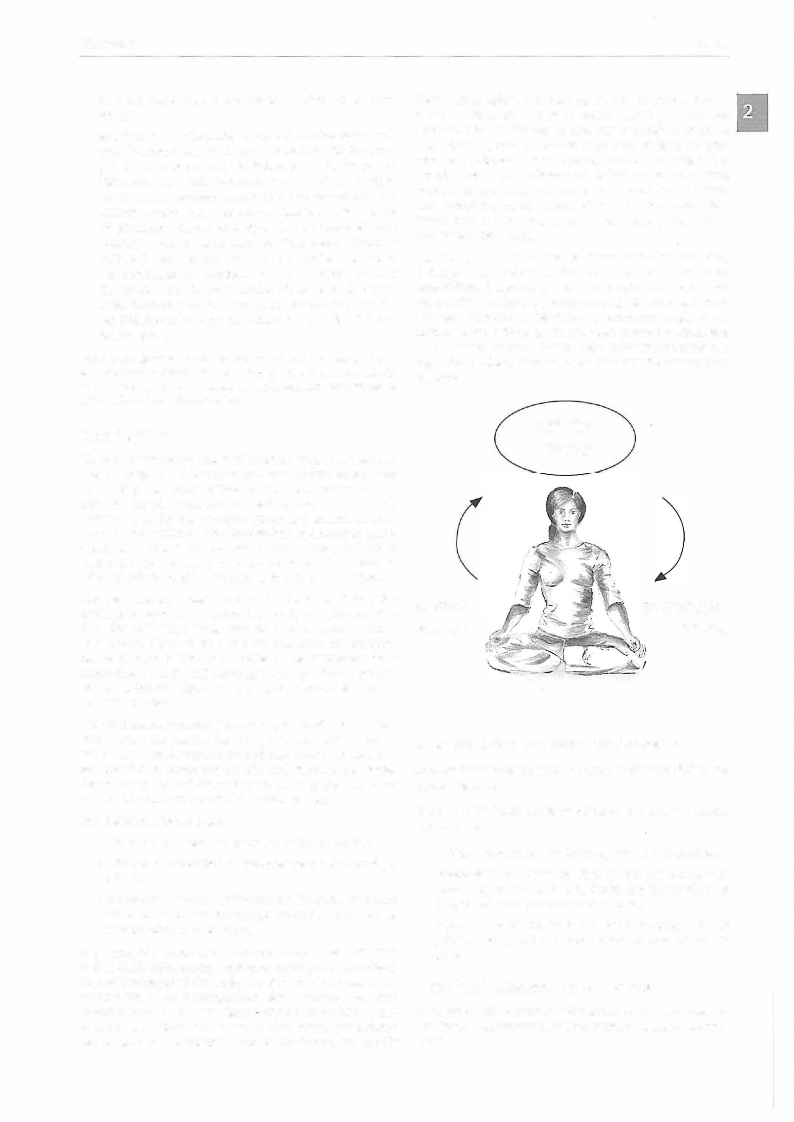
Jnäna-yoga
niert sich die Seele von hier wieder im Moment der Emp fängnis.
Svar-loka (Himmelsebene) entspricht vijfiäna-maya- und änanda-maya-kosa. Die Seele transzendiert die Erfahrun gen der fünf Sinne und die Ebene von Zeit, Raum und Kausalität. Nur große Meister/innen, die schon im physi schen Leben savikalpa-samädhi (Überbewusstsein mit Dualität) erreicht haben, erreichen diese Ebene. Wer schon im physischen Leben nirvika/pa-samädhi (samadhi ohne Dualität) erreicht hatte, also ein j'ivan-mukta (lebendig Befreiter) war, kommt von hier aus weiter zur vollen Verschmelzung mit brahman. Ansonsten folgt entweder die Reinkarnation im menschlichen Körper oder die schritt weise Befreiung von einer Ebene der Kausalwelt zur nächs ten (videha-mukti) oder die Inkarnation als ein göttliches Wesen (deva).
Anm.: In der Sanskrit-Literatur werden die Ausdrücke bhür-loka, bhuvar laka und svar-loka manchmal auch anders als oben beschrieben, nämlich als nur die ersten drei von insgesamt sieben Ebenen. Hier haben wir uns an die populärere Verwendung gehalten.
-
-
Karma
Die Lehren von karma und Reinkarnation bilden die Basis der meisten Religionen in der Welt, und man schätzt, dass sie von zwei Dritteln der Weltbevölkerung akzeptiert werden. Sie ge ben eine logische Erklärung der Welt, die wir um uns sehen, einer Welt, in der der gerechte, gütige und wirklich fromme Mensch schmerzlichen und widerwärtigen Bedingungen ausge liefert ist, während die anscheinend ungerechten und bösen Menschen sich an allem, was das Leben zu bieten hat, zu erfreuen scheinen, ohne irgendein Leid erfahren zu müssen.
Karma
dieses Leben auferlegt worden ist, die Früchte unserer vergan genen Handlungen werden in diesem Leben geerntet. Das prärabdha ist ein Teil des saficita, der Unterschied zwischen den beiden ist, dass das saficita noch nicht wirksam ist, wäh rend das prärabdha nun beginnt, Früchte zu tragen. Die
Früchte aller karmas müssen vom Individuum selbst geerntet werden, da sein Charakter und seine Lebensumstände durch sein prärabdha-karma bestimmt werden. Das prärabdha karma kann in keiner Weise vermieden werden, nicht einmal vom Weisen (vgl. 2.13).
Das Erlangen von Selbsterkenntnis mag den Menschen dazu befähigen, von künftigen Früchte tragenden Handlungen (ägämT-karma) abzusehen oder die Auswirkungen der ange sammelten Handlungen (saficita-karma), die noch nicht wirk sam geworden sind, zu händeln. Das prärabdha hingegen, das begonnen hat, Früchte zu tragen, muss geerntet werden. Wer jedoch Selbsterkenntnis besitzt, wird nicht wirklich unter den Ergebnissen leiden, denn er ist von Körper und Sinnesorganen losgelöst.
sancita karma
Die Frage, die sich angesichts dieser Ungerechtigkeit für jeden denkenden Menschen automatisch stellt, ist: ,,Warum lässt Gott das zu?" Diese Frage wird durch diese beiden Lehren beantwortet. Ohne sie ist man dazu gezwungen zu schließen, dass Gott (wenn Er überhaupt existiert), eine Gruppe von Men schen (denen es gut geht) bevorzugt und gegen eine andere (die leidet) negativ eingestellt ist. Diese Idee ist sowohl ein Sakrileg als auch unlogisch.
Das Wort karma bedeutet „Handlung"; es bezieht sich auf jede
- - -
agam,-
karma
prärabdha
karma
körperliche oder geistige Handlung und auch auf die Ergeb nisse dieser Handlungen. Es ist gleichbedeutend mit dem wis senschaftlichen Gesetz von Ursache und Wirkung. Der Heilige Paulus bezog sich auf dieses Gesetz, als er sagte: ,,[...] Denn was der Mensch sät, das wird er ernten." [Gai 6:7]
Das Gesetz des karma besagt:
-
-
Wir haben· das, was uns geschieht,' selbst geschaffen.
-
Wir sind verantwortlich für das, was uns in der Zukunft ge schieht.
-
Wir wachsen anhand der Erfahrungen. Ereignisse sind nicht als Belohnung oder Bestrafung anzusehen, sondern als Möglichkeiten zum Wachsen.
Die Hinduphilosophen unterteilen das karma eines Menschen in drei Abschnit�e: saficita, prärabdha, ägämT(oder krTyamär:w). Das saficita-karma ist der große gespeicherte Vorrat aller ange häuften Werke der Vergangenheit, deren Früchte noch nicht geerntet worden sind. Das ägämT karma wird laufend in die sem Leben gebildet und kommt zu dem Vorrat von saficita karma dazu. Das prärabdha-karma ist das karma, das uns für
-
-
Die drei Arten von karma mit Analogien
ANALOGIE 1: Ein Bogenschütze hat einen Köcher mit Pfeilen und schießt diese los.
ANALOGIE 2: Ein Bauer hat einen Vorrat an Getreide und sät das Getreide aus.
saficita-karma ist wie der Vorrat an Pfeilen und Getreide.
prärabdha-karma ist wie der Pfeil, der den Bogen schon ver lassen hat, und ein Maß Korn, das für den Tagesbedarf aus dem Vorratsraum genommen worden ist.
ägämT-karma ist wie der Bogen, der zum Abschuss bereit gehalten wird, und der Anbau neuer Saaten für die Zu kunft.
-
Die fünf Untergesetze des karma
In einem weiten Verständnis von karma werden alle Ursache und Wirkungszusammenhänge mit Zeitverzögerung zusammen gefasst:
27
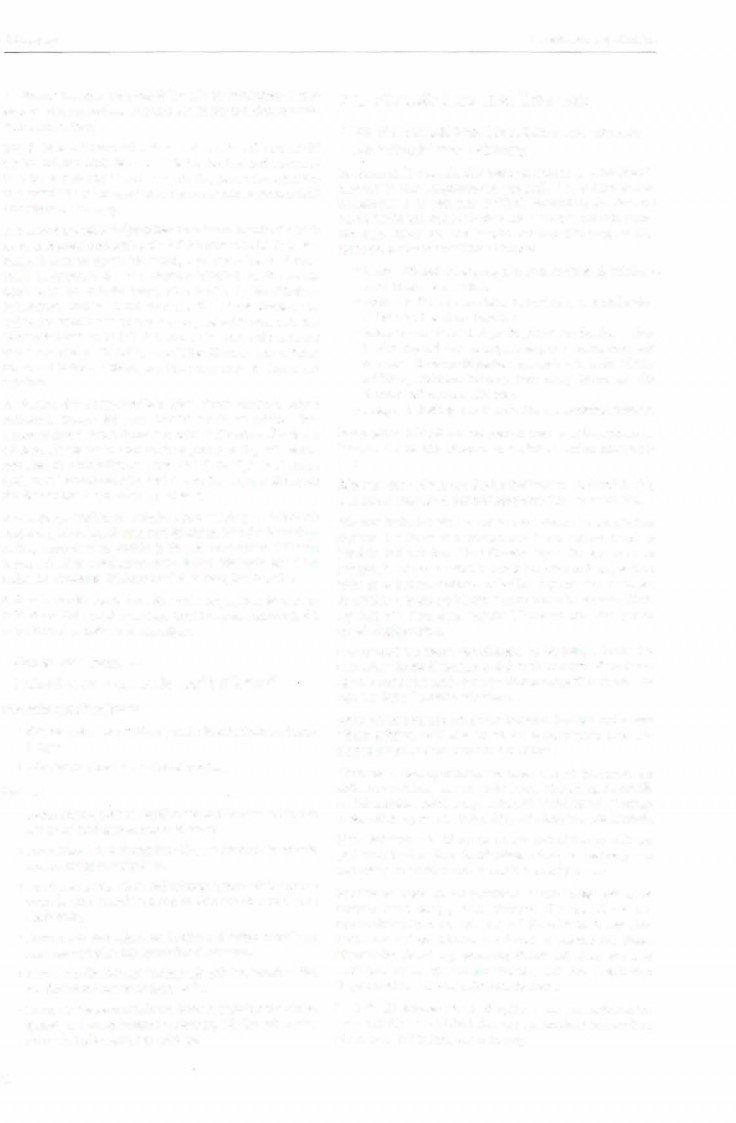
Jfiäna-yoga
-
-
Direkte Gesetze: Darunter fallen alle physikalischen Natur gesetze, Gesundheitsgesetze und Regeln der zwischenmensch lichen Interaktion.
Drei Beispiele: Jemand wirft einen Stein in die Luft, und er fällt einem auf den Kopf; jemand ist Kettenraucher und bekommt im Alter von vierzig Jahren Lungenkrebs; jemand reagiert im mer mürrisch und wundert sich, warum er sich so einsam fühlt und niemand ihn mag.
-
Gesetz der Gedankenkraft: Was man denkt, manifestiert sich auch. Gedanken sind Kräfte, die auf die physische Welt wirken. Beispiel: Man ist davon überzeugt, dass man eine bestimmte Stelle bekommt. Wider alle Wahrscheinlichkeit erhält man sie auch. Man hat ständig Angst, eine bestimmte Krankheit zu bekommen, und bekommt sie auch. Ein schwer Kranker, der unbedingt wieder gesund werden will, hat dafür eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit als jemand, der nicht mehr an seine Genesung glaubt. Es heißt, dass jeder Wunsch sich erfüllen muss. Bei kleineren Wünschen kann dies auch im Traum ge schehen.
-
Gesetz der Kompensation: Wer einem anderen etwas Schlechtes antut, wird etwas Ähnliches erleben müssen. Wer einem anderen etwas Gutes tut, wird dafür etwas Ähnliches erleben. Dieses Gesetz wird auch als „Goldene Regel" bezeich net: ,,Was du nicht willst, dass man dir tu', das füg' auch keinem andern zu." Manchmal wird auch karma (im engeren Sinne) als das Gesetz der Kompensation definiert.
-
Gesetz der Evolution: Manche Dinge geschehen einfach als Aufgaben, als Gelegenheiten zum Wachsen. Manche Menschen leiden, ohne dass sie vorher in diesem oder einem früheren Leben schlechte Handlungen getan haben. Vielmehr ist Leiden selbst eine wichtige Erfahrung auf dem Weg der Evolution.
-
Gesetz der Gnade Gottes: Wer Gott hingegeben ist und in brünstig zu Gott betet, dem kann Gott Ereignisse schicken, die seine Evolution weiter beschleunigen.
-
-
-
Gesetz des karma -
Freiheit oder Determinismus/Fatalismus?
Determinismus/Fatalismus:
-
Was wir momentan erfahren, ist das Resultat früherer Hand lungen.
-
Alles karma muss abgearbeitet werden.
Freiheit:
-
Durch unsere jetzigen Handlungen und Gedanken können wir unser künftiges karma bestimmen.
-
Durch Setzen neuer Ursachen können wir auch kurzfristig unsere Situation verändern.
-
Durch bewusstes Leben und Erleben lernen wir Lektionen schneller und manches karma braucht nur abgemildert zu erscheinen.
-
Durch bewusstes Leben, Meditation und präl)a-maya kann man das Ablaufen des karma beschleunigen.
-
Durch Entscheidungen können wir wählen, welchen Teil des karma wir zuerst erleben wollen.
-
Durch nirvika/pa-samädhi (Selbstverwirklichung) werden ägämi- und saficita-karma verbrannt. Wir brauchen also doch nicht alles karma zu erleben.
Puru�ärthas und äsramas
-
-
-
Puru�ärthas und äsramas
-
Die vier puru�ärthas (Hauptziele und -zwecke der menschlichen Existenz)
Die Hauptziele menschlicher Existenz werden u. a. im „Mahä bhärata" in vier Hauptgruppen eingeteilt. Mit einigen Anpas sungen lassen sie sich auch auf Ziele anwenden, die hier und heute gelebt und den Menschen zur Harmonie mit sich, ande ren, dem Universum, und letztlich zur Verwirklichung der Ein heit bzw. zur Befreiung führen können:
-
käma - Sinnesbefriedigung (auf ethische Weise), Erfüllung emotionaler Bedürfnisse
-
artha - Erfüllung materieller Bedürfnisse, finanzielle Ab sicherung, Reichtum, Ansehen
-
dharma - ein vielschichtiger Begriff, der sowohl ein Leben in Einklang mit den Naturgesetzen, den kosmischen uni versellen Gesetzmäßigkeiten umfasst, wie auch Pflicht erfüllung, Selbstentfaltung, Harmonie, Dienst an der Gesellschaft und am Nächsten
-
mok$a- Befreiung, das höchste Ziel menschlicher Existenz.
Das yogische Modell der vier puru$ärthas ist insbesondere im Rahmen der Evolutionstheorie zu verstehen und zu interpretie ren:
Dharma, das Wissen um Rechtschaffenheit, ist letztlich das, was den Menschen in der Evolution vom Tier unterscheidet.
Dharma bedeutet ein harmonisches Leben: die kosmischen Gesetze der Natur zu verstehen und ihnen entsprechend zu handeln und zu leben. Diese Gesetze sind z. B.: andere so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte, andere nicht zu verletzen, anderen zu helfen, mit anderen zu teilen. So erfüllen wir unsere Pflicht, was zu unserem eigenen Wohl ergehen wie auch dem anderer Menschen und der ganzen Gesellschaft beiträgt.
Eine weitere Definition von dharma ist: Verhalten, das in die sem Leben zu Wohlergehen und danach zu spirituellem Segen führt. Swami Sivananda hat den dharma-Begriff kurz mit „Sei gut. Tue Gutes" zusammengefasst.
Wenn wir im Einklang mit diesen Gesetzen handeln und unsere Pflicht erfüllen, wird dies zu einem harmonischen Leben in Zufriedenheit und innerem Frieden führen.
Wenn wir so leben, erhalten wir alles, was wir brauchen, um artha zu erreichen, also die notwendige Sicherheit, materielle und finanzielle Absicherung, materiellen Wohlstand, gesicher te Verhältnisse, positive Entwicklung in Beruf und Gesellschaft.
Dies wiederum erlaubt es uns, unsere natürlichen materiellen und emotionalen Grundbedürfnisse, käma, auf sattwige Art und Weise zu erfüllen und sie letztlich zu sublimieren.
So entwickeln wir uns auf natürliche Art und Weise weiter. Der Wunsch nach mok$a, dem höchsten Ziel und Zweck der menschlichen Existenz, wird auf natürliche Weise immer stär ker in uns und wir können uns darauf zu entwickeln. Dieses höchste Ziel, Befreiung, Harmonie, Einheit mit allem, ist nur zu erreichen, wenn wir uns im Einklang mit den kosmischen Gegebenheiten, also dem dharma, befinden.
Deshalb gilt dharma als die Grundlage des menschlichen Le bens und führt uns letztlich über die menschliche Existenzform hinaus zum Göttlichen, zur Befreiung.
28
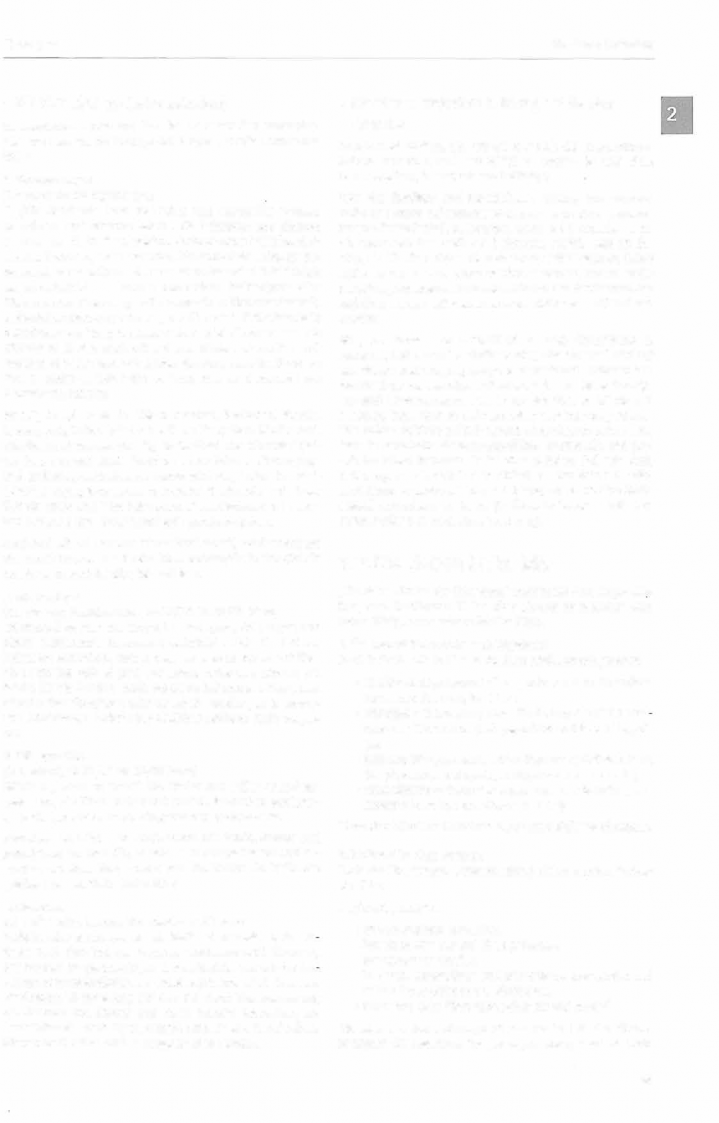
Jf\äna-yoga
-
Die vier äsramas (Lebensstadien)
Im klassischen Indien werden vier Lebensstadien unterschie den, die man für die heutige Zeit folgendermaßen anwenden kann:
-
Brahma-carya
{Lernperiode bis 20/25 Jahre)
Der/die Schüler/in lernt weltliches und spirituelles Wissen. Moralische und ethische Werte, die Prinzipien von dharma werden von Kindheit an gelehrt. Brahma-carya heißt wörtlich
,,sich zu brahman, dem Absoluten, hin entwickeln", also das Be wusstsein zu erweitern, sich zur allumfassenden Wirklichkeit hin zu entwickeln. Da eine unkontrollierte Befriedigung aller Wünsche eine Bewegung in die umgekehrte Richtung darstellt, bedeutet brahma-carya im engeren Sinn auch Enthaltsamkeit; Bewahrung von Energie. Kindererziehung ist nichts anderes, als dharma zu lehren: nicht mit anderen Kindern zu streiten, mit anderen zu teilen usw. Wir lehren das Kind, nicht ins Feuer zu fassen, damit es sich nicht verletzt, weil es unbewusst ein Naturgesetz verletzt.
Wichtigste spirituelle Praktiken: mantras, Rezitation, Rituale, äsanas, prär:,äyäma (als Vorbereitung für spätere Meditation). Meditation ist weniger wichtig, da der Geist meist Schwierigkei ten hat, sich auf einen Punkt zu konzentrieren. Karma-yoga und einfaches, enthaltsames Leben wird empfohlen. Im tradi tionellen Yogasystem verließ der/die Schüler/in während dieser Zeit die Eltern und lebte beim guru. Dieses System des Lernens und Lebens beim Lehrer nennt sich gurukula-System.
Der/die Schüler/in lernt nicht nur intellektuell, sondern stimmt sich durch Dienen und Beobachten auf den/die Meister/in ein und lernt so auch intuitiv, telepathisch.
-
Gärhasthya
(Berufs- und Familienleben, ab 20/25 bis 50/60 Jahre) Traditionell werden die Ehepartner von guru, Astrologen und Eltern ausgesucht. Zusammen entwickeln sich die Partner, indem sie versuchen, Gott in dem anderen zu sehen und über eine sattwige Befriedigung von käma, artha und dharma die Stärke für ein Streben nach mok�a zu bekommen. Besonders wichtig: Transformieren aller täglichen Handlungen in karma und bhakti-yoga. Dabei aber tägliches sädhana nicht verges sen.
-
Vänaprastha
(Ruhestand, ab 50/60 bis 70/75 Jahre)
Wörtlich „Leben im Wald". Die Kinder sind selbst erwachsen geworden, die Eltern ziehen sich zurück. Besonders verdienst volle vänaprasthis werden die gurus von brahma-caris.
Besonders wichtig: etwas hatha-yoga mit kriyäs, äsanas und prär:,äyäma, um den Körper wieder zu energetisieren und ge sund zu erhalten. Hauptpraxis: viel Meditation. So bleibt die geistige Klarheit bis ins hohe Alter.
4.Sannyäsa
(ab 70/75 Jahre bis zum Verlassen des Körpers)
Aufgabe aller Bindungen an die Welt. Leben allein, typischer weise nach dem Tod des Partners, manchmal auch Trennung der Partner im gegenseitigen Einverständnis, um alle Verhaf tungen zu transzendieren. Der Geist ist jetzt bereit für intensive Meditation. Vorbereitung auf den Tod durch Transzendierung der Grenzen von Körper und Geist. Manche Menschen, die keine Wünsche nach Partnerschaft, Kindern und Beruf haben, können auch schon vorher entsagen (siehe unten).
Die sieben bhümikäs
-
-
-
Die vier puru�ärthas in Bezug auf die vier äsramas
Es gibt zwei Weisen, wie wir die vier Ziele des menschlichen Lebens umsetzen und verwirklichen können, je nach dem Lebensstadium, in dem wir uns befinden:
Weg des Familien- und Berufslebens: Erfüllung von dharma, artha und käma auf sattwige Weise, um so zu einer gewissen inneren Zufriedenheit zu kommen. Dann ist der Geist bereit für ein systematisches sädhana {spirituelle Praxis). Dies ist der Weg, der für die meisten Menschen am geeignetsten ist. Dabei sollte ab und zu auf etwas verzichtet werden, um zu starke Anhaftung abzubauen. Außerdem können alle Handlungen des täglichen Lebens mit verschiedenen Methoden spiritualisiert werden.
Weg der Entsagung: Formell (d. h. nach Einweihung in sannyäsa, Mönchsweihe, Gelübde etc.) oder informell wird auf alle Wunschbefriedigung weitgehend verzichtet. Insbesondere das Gelübde der sexuellen Enthaltsamkeit und der Besitzlosig keit sind hervorzuheben. Dies ist für eine kleinere Minderheit geeignet, kann aber zu sehr schneller Verwirklichung führen. Wer solche Gelübde auf sich nimmt, ohne dafür bereit zu sein, kann in ernsthafte Gewissenskonflikte, emotionelle und psy chische Krisen kommen. Es ist aber in jedem Fall eine gute Erfahrung, mal eine Weile sehr einfach zu leben (wie z. B. wäh rend dieser Yogalehrer/innenausbildung) und auch eine Weile sexuell enthaltsam zu leben (in Übereinstimmung mit dem Partner oder z. B. nach einer Trennung).
-
-
Die sieben bhümikäs
,,Die sieben Stufen der Erkenntnis" stammt aus dem „Yoga-väsis tha", dem berühmten Dialog über Jfiäna-yoga zwischen dem Lehrer Väsi�tha und seinem Schüler Räma.
-
Subhecchä {Sehnsucht nach Wahrheit)
Der/die Suchende in diesem Stadium wird Aspirant genannt.
, viveka- richtige Unterscheidung zwischen dem Unvergäng lichen und dem Vergänglichen
, vairägya - Entwicklung einer Einstellung des Nichtanhaf tens, der Wunschlosigkeit gegenüber weltlichen Vergnü gen
, �atsampat - ,,die sechs edlen Tugenden"; Beherrschung der physischen und geistigen Organe (siehe dazu 2.14)
, mumuk�utva - tiefes Verlangen nach der Befreiung aus
sarr,sära (dem Rad von Geburt und Tod)
Diese vier Mittel zur Befreiung nennt man sädhana ciitu�_taya.
-
Vicärar:iä (rechtes Streben)
Stufe der Überlegung, Unterscheidung, die zu rechtem Verhal ten führt.
Der/die Aspirant/in:
, ist zum sädhaka geworden.
-
hat einen Weg zur Wahrheit gefunden.
, praktiziert regelmäßig.
, ist bereit, seinen/ihren niederen Geist zu überwinden und seinen/ihren Geist zu transformieren.
, fragt sich: ,,Was führt mich näher zur Wahrheit?"
Die eigene Unterscheidungskraft verbunden mit den Grund prinzipien des gewählten Weges zeigen einem, was man prak-
29
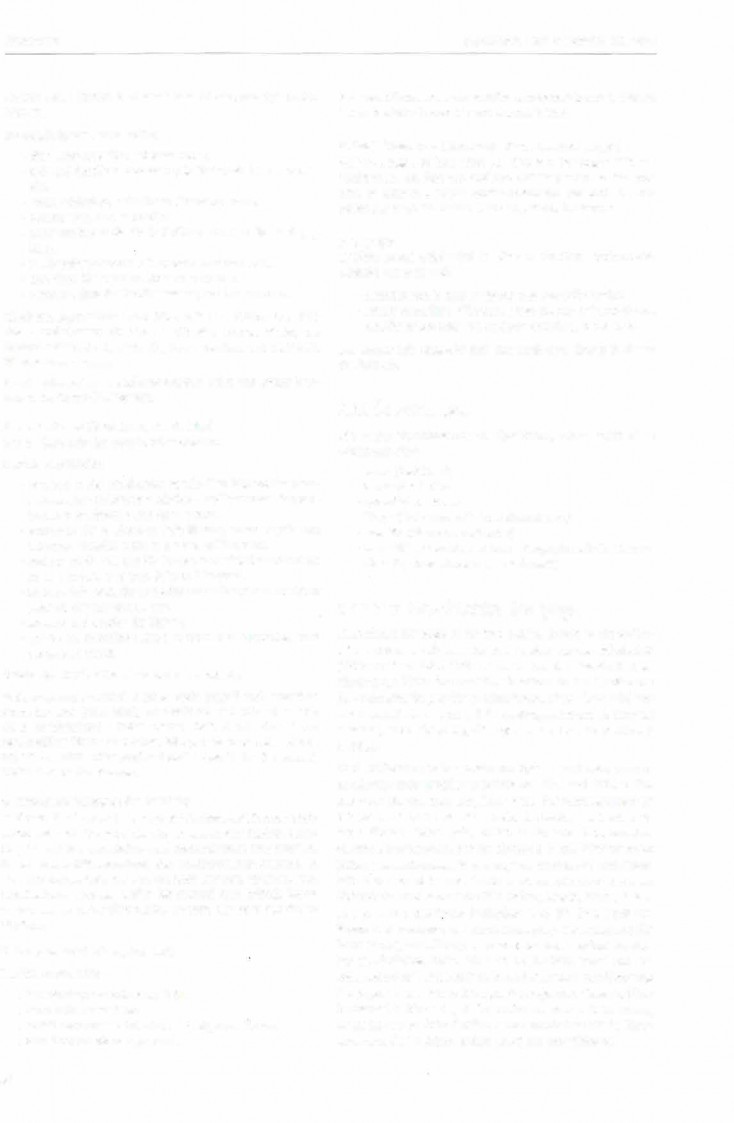
Jfiäna-yoga
tizieren soll. Hilfreich in dieser Phase ist ein guru {spiritueller Lehrer).
Ein qualifizierter Lehrer sollte:
, die Wahrheit selbst erfahren haben.
, sich auf Schriften beziehen (die Wahrheit ist schon sehr alt).
, einen ethischen, selbstlosen Charakter haben.
, praktizieren, was er predigt.
, seine Schüler in die Freiheit führen (nicht in die Abhängig- keit).
, in Übereinstimmung mit anderen Meistern sein.
, sich nicht über andere Menschen stellen.
, betonen, dass der Schüler selbst praktizieren muss.
Charisma, Ausstrahlung und übernatürliche Kräfte sind nicht das Hauptkriterium für einen spirituellen Lehrer. Viveka, die Unterscheidungskraft, ist wichtig, bevor das Herz und die innere Stimme einen lenken.
Durch systematisches sädhana werden Geist und präf)a lang sam unter Kontrolle gebracht.
-
-
Tanu-mänasä (Ausdünnen des Geistes) Der niedere Geist ist transformiert worden.
Der/die Aspirant/in:
-
erreicht in der Meditation regelmäßig höhere Bewusst seinsebenen (dharana + dhyana = vollkommene Konzen tration + Meditation und Absorption).
, erfährt in der Meditation tiefe Wonne, sodass er/sie von irdischen Freuden nicht in die Irre geführt wird.
, will nur noch, was gut für ihn/sie ist (er/sie braucht nicht mehr mit dem niederen Geist zu kämpfen).
, ist innerlich erwacht und wird von seiner/ihrer Intuition geleitet, das Richtige zu tun.
-
erkennt und erfühlt die Einheit.
, spürt eine natürliche Liebe zu Gott, den Menschen und zur ganzen Natur.
Gefahr: Spirituelles Ego, Stolz auf das Erreichte!
Viele Yogaschüler erreichen schon recht schnell nach intensiver Praxis für eine kurze Weile tanu-mänasä und müssen es sich dann anschließend wieder systematisch durch viele Jahre regelmäßiger Übung erarbeiten. Wer ganz in tanu-mänasä ver ankert ist, wird sthita-prajfia (beständiger Weiser) genannt, bleibt aber weiter sädhaka.
-
-
Sattväpatti (Erlangen der Reinheit)
In diesem Stadium wird der Aspirant brahma-vid (Kennerbrah mans) genannt. Der yogT, der sich in diesen vier Stadien befin det, ist saficita-, prärabdha- und ägämT-karmas unterworfen. Er hat samprajfiäta-samädhi, den überbewussten Zustand, in dem das Bewusstsein der Dualität noch existiert, erfahren. Nun manifestieren sich die siddhis (übernatürlichen Kräfte). Wenn er von diesen unberührt bleibt, erreicht der yogT das fünfte Stadium.
-
Asaf"(lsakti (Anhaftungslosigkeit) Der/die Aspirant/in:
, hat nirvika/pa-samädhi erreicht.
, kann nicht mehr fallen.
, erfüllt notwendige Pflichten nach eigenem Willen.
, wird brahma-vidvara genannt.
?at-sampat • Zur Geschichte des yoga
In diesem Stadium werden saficita- und ägämT-karma verbrannt. Das prärabdha-karma ist noch auszuarbeiten.
-
PadärthäbhävanT (Abwesenheit von äußeren Dingen)
Äußere Dinge scheinen nicht zu existieren. Der yogTerfüllt nur Funktionen, die ihm von anderen auferlegt werden. Der yogT wird in diesem Stadium brahma-vidvarTya genannt. Es ver bleibt nur noch ein kleiner Rest von prärabdha-karma.
-
Turyagä
Der/die yogT/yoginT wird in diesem Stadium brahma-vid variJtha genannt und:
-
befindet sich in immerwährendem samödhi (turTyö).
-
erfüllt seine/ihre Pflichten, seien sie nun willentlich von ihm/ihr selbst oder von anderen auferlegt, nicht mehr.
Der Körper fällt ungefähr drei Tage nach dem Eintritt in dieses Stadium ab.
-
-
-
Sat-sampat
-
Die sechs Voraussetzungen, Qualitäten, eines spirituellen Aspiranten sind:
-
sama (Gleichmut)
, dama (Kontrolle)
-
uparati (Vermeiden)
-
titik$ä (Duldungskraft, Aushaltenkönnen)
-
-
sraddhä {Glauben, Vertrauen)
-
-
-
samädhäna (beständige Ruhe, Ausgeglichenheit, Harmo nie = Ergebnis, Zustand der Heiterkeit)
2.1s Zur Geschichte des yoga
Die Anfänge des yoga liegen im Dunkeln. Es sind wenig verläss liche Quellen erhalten. Unter den Funden aus der Induskultur (Höhepunkt ca. 2600-1900 v. Chr.) finden sich Siegel mit einer eingeritzten Figur, die aussieht, als würde sie das bhadrösana
{die Schmetterlingsstellung) einnehmen. Diese Figur wird von manchen mit dem Hindugott Siva gleichgesetzt und als Hinweis gesehen, dass einige Yogaübungen schon damals praktiziert wurden.
Nach Auffassung insbesondere von Sprach- und Genforschern wanderten Indoeuropäer zwischen ca. 1500 und 1000 v. Chr. aus dem Nordwesten, möglicherweise der zentralasiatischen Steppe, nach Indien ein. Ihre Texte, die vedas, beschreiben in ihren älteren Teilen gelegentlich veränderte Bewusstseins zustände und Visionen, hervorgebracht z.B. mit Hilfe von tapas (Hitze, Askeseübungen, Verehrung von Gottheiten) und soma saft. Ziele der spirituellen Praxis waren damals unter anderem dichterische und seherische Fähigkeiten, Macht, Ruhm, Reich tum u. ä. Die upanisads behandeln u. a. die Erkenntnis von ötman und brahman, die durch Entsagung, Beherrschung der Sinne (yoga), Atemübungen, Innenschau und samödhi erreich bar ist. Ähnliches findet sich auch im „Mahäbhärata" bzw. der
„Bhagavad-gTtä". Diese enthält in 4.1-3 Aussagen zum Ursprung
des yoga. Danach lehrte SrT-kr?i:ia den yoga dem Vivasvat (dem Sonnengott). Vivasvat gab ihn weiter an seine_n Sohn Manu, Manu an seinen Sohn lk?väku, einen mythischen König. Kr�i:ia erneuerte die Tradition, indem er Arjuna unterrichtete.
30
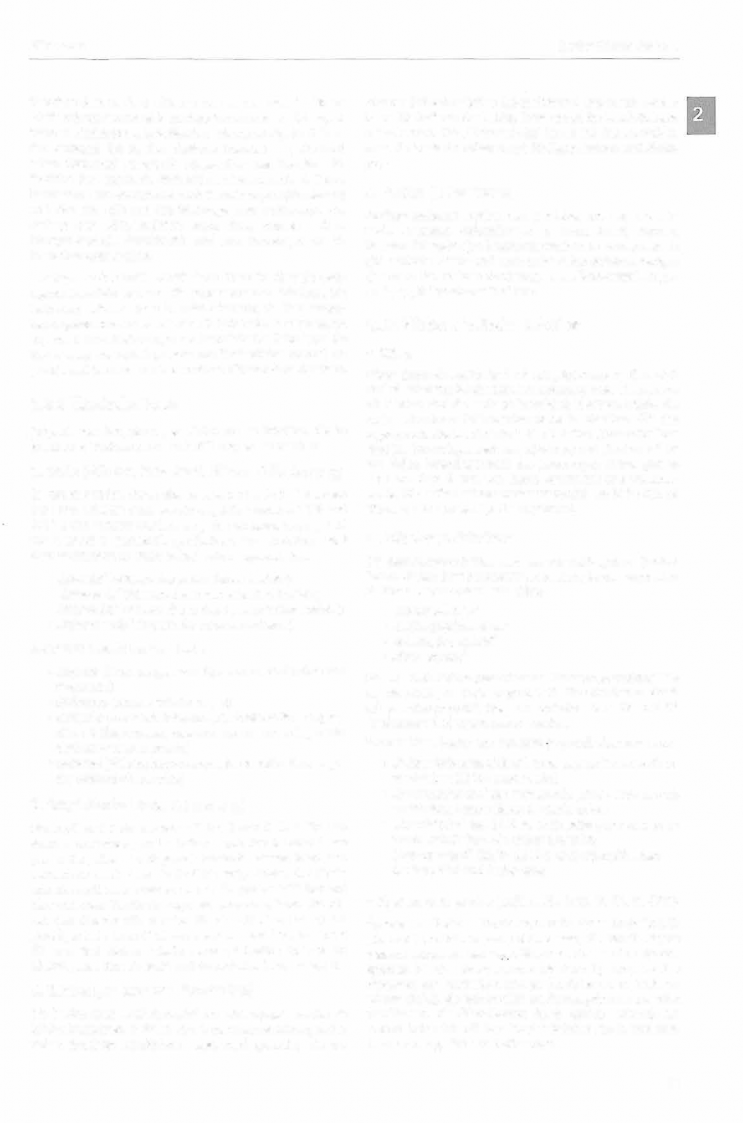
Jnäna-yoga
Zwischen dem 5. Jh. v. Chr. und den ersten nachchristlichen Jahrhunderten waren es besonders Buddhisten und Jainas, die Texte zu Meditation u. ä. verfassten. Wahrscheinlich im 4. Jh. n. Chr. entstand das zu den darsanas (klassischen philosophi schen Systemen) gehörende „Yoga-sütra" des Patanjali. Die Tradition der Näthas, die etwa seit dem 10. Jh. n. Chr. in Texten hervortritt, lehrt das Streben nach Einheit vonjTva (Einzelseele) und Siva mit Hilfe von ku(lr;ialinT-yaga bzw. hatha-yoga. Am Anfang der Näth-Tradition steht Siva, dessen Lehren Matsyendranäth, Gorakhnäth und ihre Nachfolger an die Menschen weitergaben.
Der folgende Abschnitt enthält einen Überblick über die wich tigsten hinduistischen und für yoga relevanten Schriften. Die Datierung indischer Texte ist meist schwierig, die hier genann ten Angaben entsprechen denen, die indologische Forschungen ergeben haben. Datierungen von hinduistischer Seite legen die Berechnung der episch-puranischen Weltzeitalter (yugas) zu grunde und kommen zu einem weitaus höheren Alter der Texte.
2.1s.1 Klassische Texte
. Folgende vier Gruppierungen zählen zu den Schriften, die im klassischen Hinduismus als Autorität angesehen werden:
-
Veda {Wissen, bzw. sruti, Hören, Offenbarung)
Es gibt vier vedas, deren älteste Teile bis heute in fast genau der Form erhalten sind, wie sie ungefähr zwischen 1500 und 1000 v. Chr. rezitiert wurden. Sie gelten als apauru$eya, ,,nicht von Menschen gemacht", geoffenbart. Ihre Einteilung wird dem mythischen ($i (Rishi, Seher) Vyäsa zugeschrieben:
-
,,�g-veda" (Wissen, das in den Versen besteht)
-
,,Säma-veda" (Wissen, das in den Melodien besteht)
-
,,Yajur-veda" (Wissen, das in den Opfersprüchen besteht)
-
,,Atharva-veda" (Wissen der Atharvan-Priester) Jeder veda besteht aus vier Teilen:
, saf!Jhita (Sammlungen von Hymnen an Gottheiten und Prosatexte)
-
brahma(la (rituelle Erläuterungen)
-
ara(lyaka (,,zur Wildnis Gehörige"; rituelle Erläuterungen, die so wirksam waren, dass man sie nur in der Abgeschie denheit rezitieren konnte)
-
upani$ad (philosophisch-metaphysische Texte, Grundlage der vedanta-Philosophie)
-
-
-
Smrti (Gedächtnis, Erinnerung)
Die smrtis sind Texte, die vermutlich seit dem 5. Jh. v. Chr. ent standen und vorwiegend Verhaltensregeln für alle Lebenslagen geben. Sie gelten - im Gegensatz zur sruti - als von Menschen verfasst. Es heißt, dass die sruti die ewige Wahrheit enthält, und die smrtis immer wieder neu an die gesellschaftlichen und ökonomischen Umstände angepasst werden müssen. Sie leh ren den dharma (die Gesetze für ein ethisches Leben) der jeweiligen Zeit. Swami Vishnu-devananda bezeichnete einmal die unveränderlichen Inhalte eines spirituellen Systems im übertragenen Sinn als sruti, und die veränderlichen als smrti.
-
ltihäsa {,,so war es"; Geschichte)
Die beiden Epen „Mahäbhärata" und „Rämäyar:ia" werden als itihasa bezeichnet. In ihnen wird in der Haupterzählung und in vielen einzelnen Geschichten verständlich gemacht, wie der
Zur Geschichte des yoga
dharma (ethisch-religiöse Lebensführung) umgesetzt werden kann. Die Anfänge der beiden Epen reichen ins 1. Jahrtausend
-
Chr. zurück. Die „Bhagavad-gTtä" ist ein Teil des „Mahäbhä rata". Sie ist ein Grundlagenwerk für jiiana-, karma- und bhakti yoga.
-
-
Puräi:ia (,, alte" Texte)
Pura(las enthalten Mythen zum Entstehen und Vergehen der Welt, Legenden, Abhandlungen zu Recht, Kunst, Medizin, Religion. Oft steht eine bestimmte Gottheit im Mittelpunkt. Es gibt achtzehn Haupt- und noch mehr Neben-pura(las. Pura(las gibt es zu den meisten Gottheiten, z. B. ,,Siva-purär:ia", ,,Vi�r:iu purär:ia", ,,Bhägavata-purär:ia" usw.
2.1s.2 Weitere indische Schriften
-
Sütra
Sütras (wörtlich „Leitfäden", oft mit „Aphorismen" übersetzt) sind die kürzestmögliche Zusammenfassung eines Themas. Am wichtigsten sind die sechs philosophischen sütras, welche die sechs orthodoxen Philosophiesysteme beschreiben. Für den yoga am wichtigsten sind die beiden Schriften „Yoga-sütra" von Patanjali (Grundlagenwerk des raja-yoga) und „Brahma-sütra" von Vyäsa (Grundlagenwerk des jiiana-yoga). Sütras gibt es auch auf dem Gebiet von Kunst, Grammatik und Gesetzes kunde. Die antiken sütras wurden vermutlich um 300 v. Chr. bis 450 n. Chr. in ihre heutige Form gebracht.
-
Hatha-yoga-Schriften
Die hatha-yoga-Schriften sind Teil der sakti-agamas (tantra Form). Wegen ihrer besonderen Bedeutung für den yoga seien sie hier aber gesondert aufgeführt:
-
,,Gorak$a-sataka"
-
,,Hatha(yoga)pradTpikä"
-
,,Gherar:i<;la-sarr,hitä"
-
,,Siva-sarr,hitä"
Die von Svätmäräma geschriebene „Hathayoga-pradipTkä" gilt als die wichtigste hatha-yoga-Schrift. Die wichtigsten klassi schen hatha-yoga-Schriften sind zwischen dem 13. und 17. Jahrhundert niedergeschrieben worden.
Weitere klass. hatha- und ku(lr;ialinT yoga-Schriften sind u. a.:
-
,,Siddhasiddhäntapaddhati", Gorak$anätha/Gorakhnäth zu geschrieben (1000 - 1250 n. Chr.)
-
,,$atcakranirupar:ia" von POrr:iänanda (1600 - 1700 n. Chr.), ausführliche Beschreibung der sechs cakras
-
,,Yogaväsi$tha" (ca. 1000 n. Chr.): jiiana-yoga und Yoga praxis, pra(layama, die sieben bhümikas
-
,,Yoga-upani�ad" (1200 - 1600 n. Chr.): Spezialthemen des ku(lr;ialinT- und hatha-yoga
-
-
Ägama und tantra (seit 3. Jh. bzw. 9. Jh. n. Chr.)
Agamas sind Texte zur Verehrung verschiedener Gottheiten. Es gibt drei hinduistische Hauptströmungen, die jeweils eigene agamas haben: bei den Visnu-Verehrern sind es die vai$(1ava agamas, bei den Siva-Verehrern die saiva-agamas, bei den Verehrern der kosmischen Energie (sakti) bzw. der göttlichen Mutter (Sakti), die sich in allen Erscheinungsformen der Welt manifestiert, die sakta-agamas (auch tantras genannt). Die tantras behandeln oft Aspekte persönlicher Praxis, insbeson dere auch ku(lr;ialinT- und hatha-yoga.
31
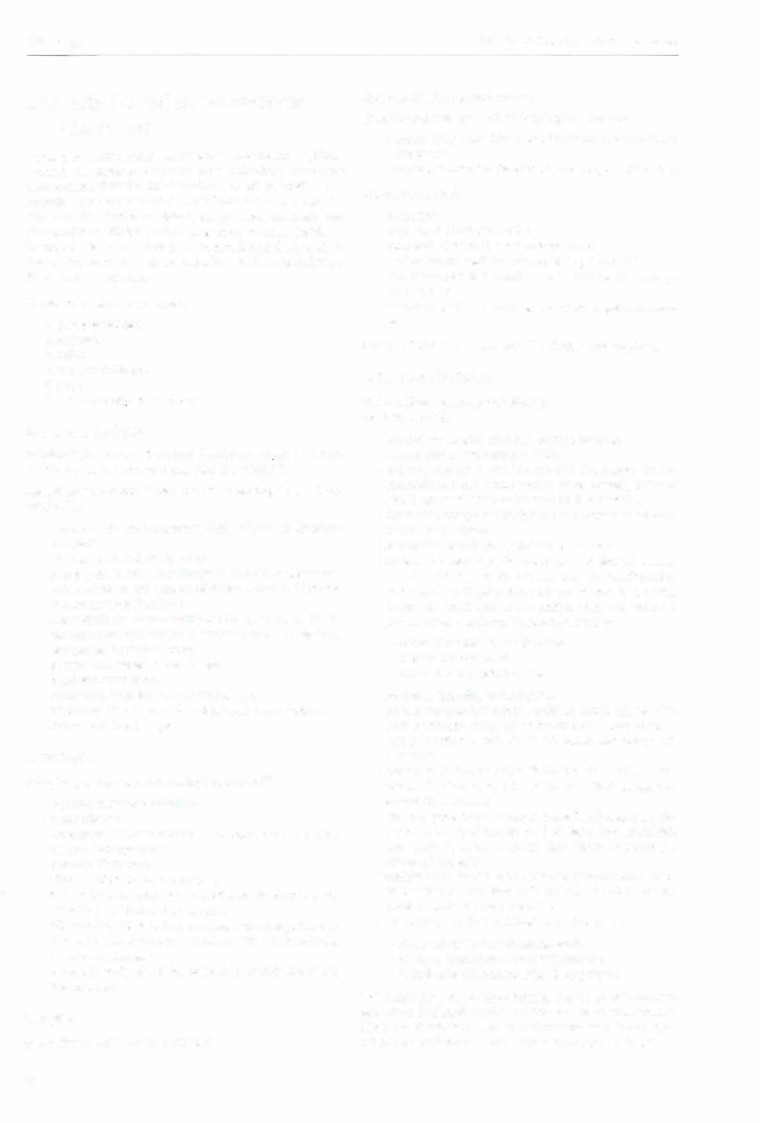
Jfiäna-yoga
2.16 Indische Philosophiesysteme (darsanas)
Darsana bedeutet „Sicht", ,, Sichtweise", ,, Anschauung", ,,Philo sophie". Die darsanas enthalten unterschiedliche, manchmal auch widersprüchliche Möglichkeiten, die Wirklichkeit zu be schreiben bzw. zur Erkenntnis der Wirklichkeit zu kommen. Es gibt zweierlei darsanas: diejenigen, in denen der veda und transzendente Wirklichkeiten anerkannt werden (ästika - besonders die sechs orthodoxen Systeme), und diejenigen, in denen das nicht der Fall ist (nästika - z. B. Materialismus, Buddhismus, Jainismus).
Die sechs klassischen darsanas:
l. pürva-mTmärnsä
-
vaise$ika
-
nyäya
-
särnkhya/sänkhya 5.yoga
6. uttara-mTmämsä = vedänta
-
Pürva-mTmärnsä
mTmärnsä (Erörterung, Reflexion) / pürva-m,mämsä (,, Erörter ung/Untersuchung des vorderen Teils [der vedas]")
Zusammengefasst von Jaimini, der daher als Begründer dieser Schule gilt:
-
vedas als höchste Autorität; vedische Klänge als Ursprung der Welt
-
Himmel- und Hölle-Philosophie
-
puf)ya (gute Taten)- man kommt in den Himmel, sammelt gutes karma an und wird im nächsten Leben in glückliche Verhältnisse hineingeboren
-
päpa (Sünden)- man kommt in die Hölle, sammelt schlech tes karma an und wird im nächsten Leben in schlechten Verhältnissen wiedergeboren
-
positive und negative Handlungen
-
-
Reinheitsvorschriften
, vorgeschriebene Rituale und Handlungen
-
bestimmte Rituale, um etwas Bestimmtes zu erreichen
, Sühne- und Bußübungen
-
-
-
Vaise�ika
vaise$ika (,,sich auf die Unterschiede beziehend")
-
logisch-naturwissenschaftlich
-
materialistisch
-
Universum als Zusammenspiel von ar:,us (Atomen), Kräf- ten und Naturgesetzen
-
mehrere Richtungen
-
alles nur Materie, selbst die Seele
-
Ziel des Lebens: Vergnügen, dabei aber die Rechte ande rer achten und ihnen nicht schaden
-
-
höheres Ziel gibt es keines, grundlegende Kategorien des Erkennens, um so zu einer geordneten Wahrnehmung des Kosmos zu gelangen
-
entspricht weitgehend der westlichen Grundhaltung und Wissenschaft
-
-
Nyäya
nyäya (Norm, Regel, Logik, Methode)
32
Indische Philosophiesysteme (darsanas)
Zwei verschiedene Ausprägungen:
-
Logik/Schlussfolgerung/Dialektik/logische Beweise:
-
Untersuchung von Objekt und Subjekt der menschlichen Erkenntnis
-
Zweig des vaise$ika (Begründer: Gotama, ca. 200 v. Chr.)
-
-
bhakti-orientiert:
-
dualistisch
-
Gott hat die Welt erschaffen
-
-
-
Gott und Mensch sind auf ewig getrennt
-
Leiden kommt, weil Mensch von Gott getrennt ist
-
Annäherung an Gott möglich durch absolute, bedingungs lose Hingabe
-
zahlreiche spirituelle Praktiken, um diese Hingabe zu erzeu gen
Ansatz b findet sich sehr selten. Die gängige Meinung ist a.
-
-
Särnkhya/Särikhya
sänkhya (Klassifizierung, Aufzählung) Begründer: Kapila
-
atheistisch; es wird nicht von Gott gesprochen
-
purU$O (reines Bewusstsein; Seele)
-
prakrti (Urnatur, bestehend aus den drei gur:,as, Grund eigenschaften der Natur: sattva, rajas, tamas), befindet sich in unmanifestiertem Zustand im Gleichgewicht
-
dualistisch: puru$O und prakrti sind von Anfang an getrennt und bleiben getrennt
-
-
purU$O hat den Wunsch, die Welt zu erleben
-
daraufhin bewegt sich die prakrti und manifestiert sich zu erst als mahat (,,das Große", aus dem die Manifestation hervorgeht) und geht dann immer weiter in die Welt hinein, als Manifestation von sattva, rajas und tamas in jeweils unterschiedlicher Zusammensetzung:
-
sattva überwiegt in der Kausalwelt
-
rajas in der Astralwelt
-
tamas in der physischen Welt
-
-
parir:,äma (ständige Veränderung)
-
puru$O manifestiert sich in zahllosen cittas, Einzelseelen oder Gemütern, durch die er die Welt sieht und erlebt
-
Leiden entsteht durch die Identifikation des purU$O mit dem citta
-
purU$O sucht das, was eigentlich in ihm ist: Existenz - Be wusstheit - Freude, jetzt in der äußeren Welt, infolge von avidyä (Nichtwissen)
-
die Welt (prakrti) ist für das Bewusstsein (puru$a) da, da mit es seine Erfahrungen machen kann und schließlich aber auch zu seiner Urnatur, dem reinen Bewusstsein, zurückkehren kann
-
-
umfasst auch eine Theorie der Wahrnehmung, eine Theo rie des Geistes und Beschreibung, wie die Welt und die individuelle Seele entstanden sind
-
Methoden, um die Identifikation zu überwinden:
-
viveka-khyäti (Unterscheidungskraft)
-
vairägya (Entsagung, Nichtverhaftetsein)
-
säk$1-bhäva (Einstellung eines Beobachters)
-
Eine Ausprägung des Särikhya besagt, dass es so viele purU$OS gibt, wie es Seelen/cittas gibt und dass jede Seele mit dem Auf hören der Identifikation und Verhaftung wieder zu ihrem eige nen purU$O zurückkehrt, ihrer eigenen Bewusstseinseinheit.
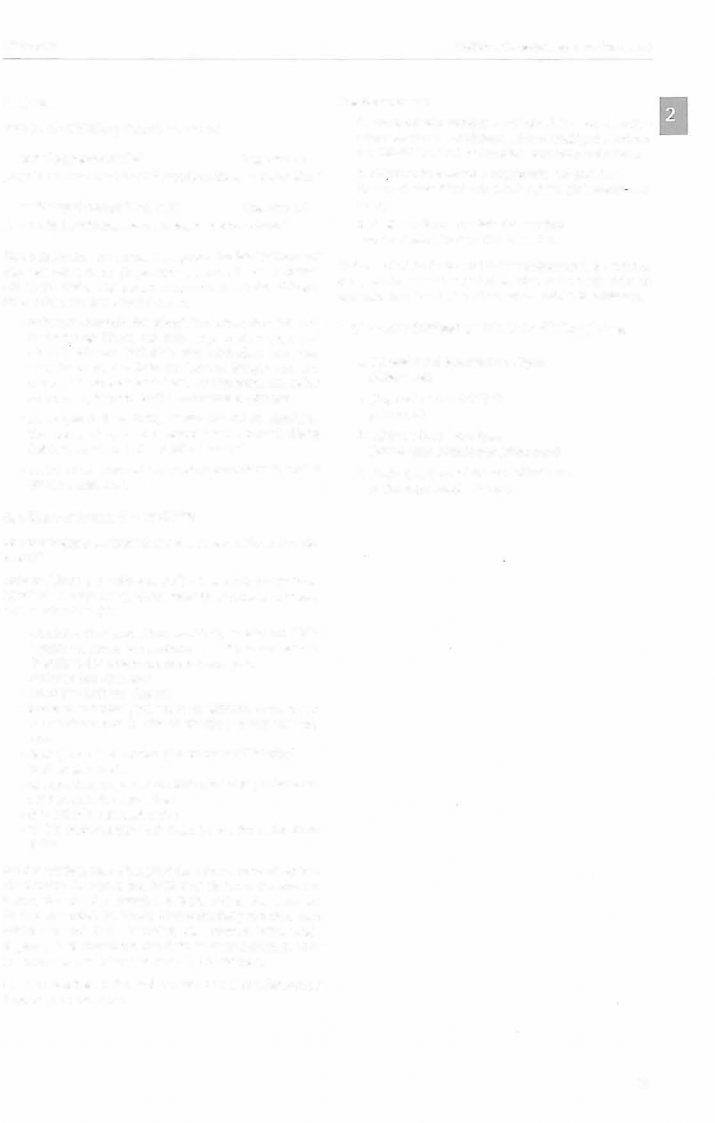
Jfiäna-yoga
-
-
-
Yoga
yoga (u. a. Verbindung, Einheit, Harmonie)
yogas citta-vrtti-nirodhab [Yoga-sütra 1.2]
,, Yoga ist das Zur-Ruhe-Bringen der Gedanken(wellen) des Geistes."
tadä dra$tub svarüpe'vasthänam [Yoga-sütra 1.3]
,,Dann ruht der Wahrnehmende in seinem wahren Wesen."
Yoga bezieht sich hier auf das Yogasystem des Patafijali bzw. auf das, was von ihm im „Yoga-sütra" gesammelt und niederge schrieben wurde. Dies beruht hauptsächlich auf der sarikhya Philosophie, mit drei Unterschieden:
-
nicht nur Unterscheidungskraft, Verhaftungslosigkeit und Beobachtung führen zur Befreiung, sondern yoga gibt eine Vielzahl von Techniken und Methoden. Alles, was dem Ziel dient, den Geist zur Ruhe zu bringen und zum wahren Wesen zurückzukehren, zur Erkenntnis des Selbst zu kommen, ist yoga. Breite Übungspraxis, abhycisa
-
Tsvara (persönlicher Gott), als eine besondere Manifesta tion des puru$O, ist von karma (Verhaftungen), k/esas (Leiden), Unwissenheit und Wünschen frei
-
es gibt nur ein Bewusstsein, einen purU$O, der sich in allen Wesen manifestiert
-
-
Uttara-mTmärnsä = vedänta
uttara-mTmcif!)sci {,,Untersuchung des hinteren Abschnitts [der
vedas]")
vedänta (,, Ende des veda/Wissens") - Erkenntnis der höchsten Wirklichkeit, nach der es nichts mehr zu erkennen, zu wissen und zu wünschen gibt.
-
,,Vedänta-sütra" (bzw. ,,Brahma-sütra"), verfasst von Bäda räya,:ia: Verhältnis von brahman und ätman zueinander; Grundlage der uttara-mTmäf!)sä-Philosophie
-
brahman (das Absolute)
-
mäyä (die Kraft der Illusion)
-
brahman und mäya sind jedoch nie getrennt, sondern sind nur scheinbar zwei. in Wirklichkeit gibt es immer nur brah man
-
-
-
Analogie von Wachzustand/Traumzustand/Tiefschlaf
-
Welt ist eine Illusion
-
es scheint nur so, als sei die Welt geschaffen, solange un ser Bewusstsein es so erfasst
-
in Wirklichkeit existiert nichts
-
ich bin weder Körper noch Geist, ich bin das unsterbliche Selbst
Auf der relativen Ebene integriert das uttara-mTmcif!)sä-System alle Aspekte der vorher beschriebenen Systeme: Gesetze des karma, Gesetze der materiellen Welt, "isvara, der auch ein Produkt der mäyä ist. Viveka (Unterscheidung zwischen dem Wirklichen und dem Unwirklichen), vairägya (Entsagung). Yogaweg als Vorbereitung, den Geist kennenzulernen, zu kon trollieren und zur Unterscheidung fähig zu machen.
All diese Praktiken helfen und bereiten darauf vor, jfiäna-yoga
überhaupt zu verstehen.
Indische Philosophiesysteme (darsanas)
Drei Hauptzweige:
l. kevala-advaita-vedanta = Nichtzweiheit = Nondualität = reiner Monismus. Wichtigste Lehrer: Gau<;lapäda, Sarikara (ca. 788-820 n. Chr.), Padmapäda, Suresvara, Vidyära,:iya
-
visistadvaita-vedanta = qualifizierte Nichtzweiheit Hauptvertreter: Rämänuja (1017-1137 n. Chr.), bhakti Strö mung
-
dvaita-vedänta = dualistischer vedänta
Hauptvertreter: Madhva (13. Jh. n. Chr.)
Weitere wichtige Denk- und Philosophiesysteme, die nicht zu den „klassischen sechs" gezählt werden, weil sie sich nicht auf die vedas berufen, sind der Tantrismus und der Buddhismus.
-
-
Die vier wichtigsten Schriften für Yogalehrer
-
Die vedas und upani$ads von Vyäsa
Uiiäna-yoga)
-
,,Yoga-sütra" von Patafijali
(räja-yoga)
-
,,Bhagavad-gTtä" von Vyäsa
(karma-yoga, bhokti-yoga, jfiäna-yoga)
-
,, Hatha(yoga)pradipikä" von Svätmäräma
(hatha-yoga, ku()r;ialinT-yoga)
33
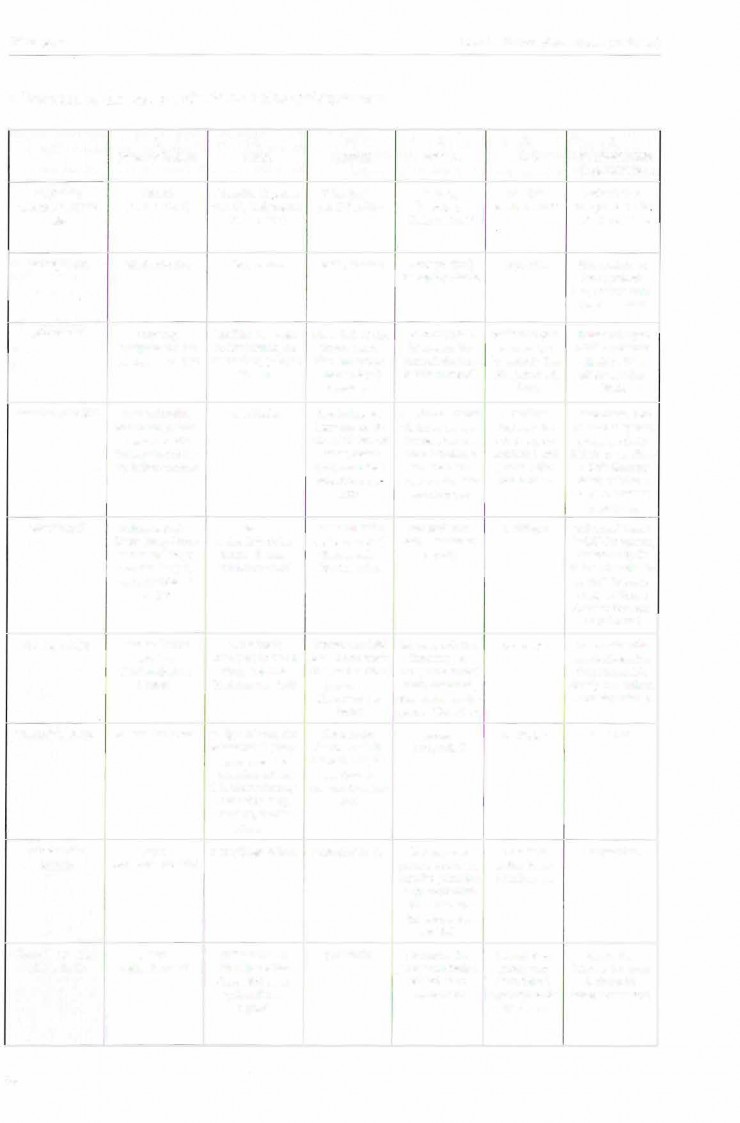
Jfiäna-yoga Indische Philosophiesysteme (darsanas)
-
-
Übersicht zu den sechs orthodoxen Philosophiesystemen
1. 2. 3. 4. 5. 6.
(PÜRVA-)MTMÄMSÄ NYÄYA VAISE$1KA SÄNKHYA YOGA UTTARA-MTMÄl'y1SÄ
bzw. VEDÄNTA
Begründer, Jaimini Aksapäda Gautama Ulüka Kal)äda [Kapila], Patafijali Sarikaräcärya
wichtige Vertreter (2. Jh. v. Chr. ?) (um 0), Uddyotakara (ca. 100 n. Chr.) Tsvarak,sl)a (4. Jh. n. Chr.?) ca. 7./8. Jh. n. Chr
etc. (7. Jh. n. Chr.) (4. Jh. n. Chr.?) (advaita-vedänta)
wichtige Texte Mimämsä-sütra Nyäya-sütra Vaisesika-sütra [Särikhya-sütra], Yoga-sütra Kommentare zu
die Särikhya-kärikä den upani�ads,
Gitä, Brahma-sütra, Upadesasähasri
Allgemeines Ursprung: Tradition der Logik, außer Zeit, Raum, Schöpfung (inkl. praktische Seite heute wichtigste Interpretation des Debattierkunst, zur ätman, manas Intelligenz, Ich- des särikhya, Schule; Evolution veda, karma-kät:,i;fa Feststellung gültigen alles aus ewigen bewusstsein, Den- Metaphysik ähn- ähnlich wie im
Wissens Atomen (a,:iu) ken) ist materiell lieh, jedoch mit särikhya, jiiäna-
bestehend isvara kä,:ic;la
Entstehung der Welt Welt anfangslos, s. vaise�ika Entwicklung der prakrti schafft Welt s. särikhya, anirvacaniyä sakti
Gott unnötig, unbe- Elemente ausein- für jeden puru�a/ Vorgang wird (mäyä) des aparam
weisbar, Macht ander, Wirken des ätman, wenn der von isvara be- brahman schafft
Gottes = Macht der karma, später seine Reflexion in aufsichtigt, weil Weltdurch verhüllen-
vedischen mantras Gottes, der Welt sie sendet und prakrti leblos de Kraft (ävarana- schafft und zer gunas ins Ungleich- und blind ist sakti); auf Ebene stört gewicht bringt des para-brahman
ist nichts real
Wer bin ich? Ichbewusstsein = ätman einer von vielen purusa/ätman s.särikhya anirvacanTyä sakti ätman (ewig, Verur- (seine Natur: ohne ewigen purusas/ (Sein, Bewusstsein, (mäyä) des aparam sacher und Träger Freude, Schmerz ätmans, seine sat, cit) brahman schafft
von Handlungen, und Bewusstsein) Natur: s. nyäya Welt durch verhüllen-
deren Früchte er de Kraft (ävarana-
erntet) sakti); auf Ebene
des para-brahman
ist nichts real
Ziel des Lebens vaidika-dharma s. mTmämsä; Freiheit von Leid kaivalya, Isolation, s.särikhya jTvan-mukti, Erlö- erfüllen, Erlangung höchsten bzw. moksa durch Trennung von sung bei Lebzeiten Wiedergeburt im Glücks (ab 7. Jh. Analyse der Natur, purusa und prakrti durch Erkenntnis
Himmel Erreichen von Gott) Trennung des durch Erkenntnis, der eigenen wahren
ätman von den dass man der reine Natur als brahman
Sinnen purusa (Zeuge) ist
Was ist Wahrheit? Gesetze des karma gültiges Wissen; vier Gesetze des purusa s. särikhya brahman
Beweismittel: praty- karma, Realität (und prakrti) aksa, anumäna, der Elemente, die
upamäna, sabda, aus Atomen
d. h. Wahrnehmung, zusammengesetzt Schlussfolgerung, sind Vergleich, verbale
Aussage
päpa
Ursachen des
nicht gültiges Wissen schlechte Werke Meinung des s. särikhya; Unwissenheit
Leidens (schlechtes Handeln) purusa, dass er an klesas, Beein- samsära gebunden trächtigungen ist (in Wirklichkeit
ist das nur seine Reflexion in der buddhi)
Überwindung des punya gültiges Wissen gute Werke Abwenden des Trennung von Gnade des Leidens durch (gutes Handeln) (erlangbar durch purusa von prakrti, puru�a und Wissens, dass man
Gnade Gottes, so die sich dann prakrti durch brahman ist
spätere Philo- zurückzieht Unterbinden der (aham brahmäsmi)
sophen} vrttis des citta
34
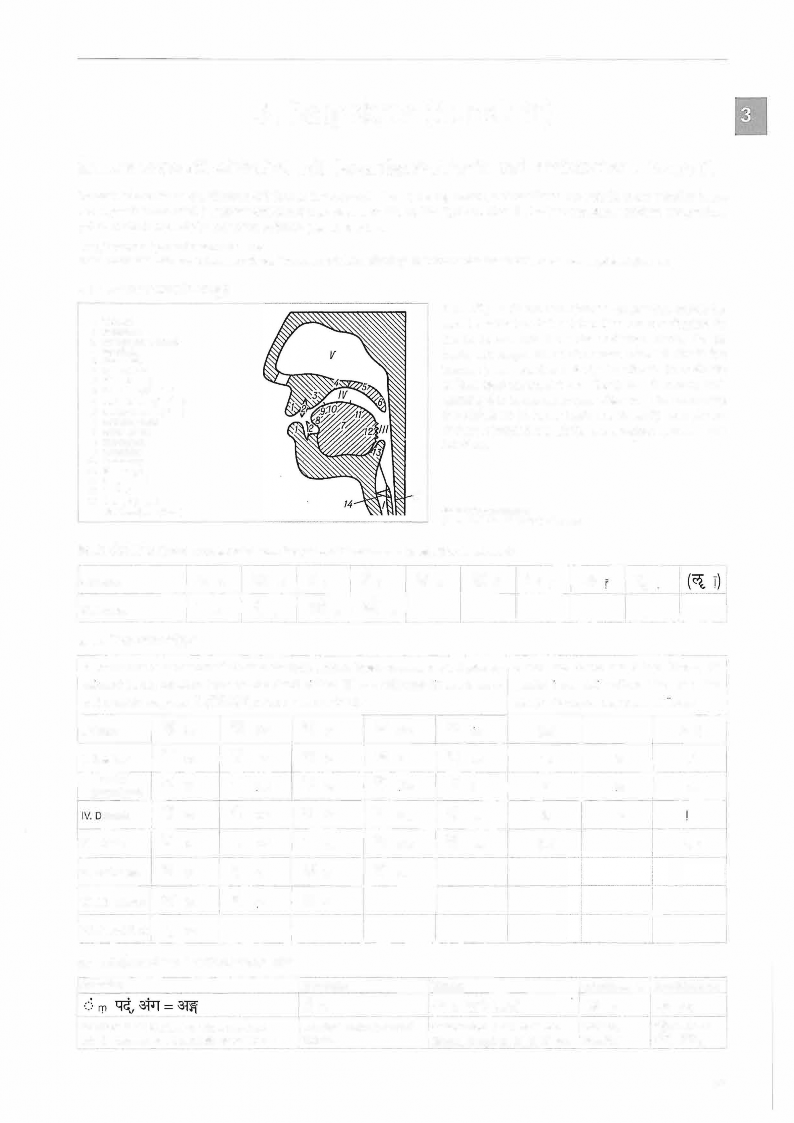
3. Sarpskrta (Sanskrit)
-
-
Das Sanskrit-Alphabet mit Devanägari-Schrift und lateinischer Umschrift
größtenteils denen, die in indischen Schulen gelehrt werden.
Smaenist rgitesiscthdrieerbNenamweird.eDr aänlteebsteennveerrhwaeltnedneetnminadnoseieuruo. paä. ifsücrhHenindSpT, rMacahreä,thdTevuanndaNgaerp,ädlTe.rDNieamhierdbeer nSucthzrtieftn, iZneidcehrenSaennstksrpitrehcehuetne
hDtietps:/e/Iwntwerwn.eatvsaesihtey.cisotme/mhpinfedhislcernipswttuetrat rf.ührtmdas Erlernen der Schrift, allerdings nicht immer der Aussprache, da sie v om Hindi beeinflusst ist.
V Nasenhöhle
II Speiseröhre
-
1LuSftrpöhrreechwerkzeuge
III Rachenhöhle (Pharynx) IV Mundhöhle
5 weicher Gaumen (Velum)
-
Lippen (Labia)
-
Zähne (Dentes)
8 Zungenspitze
-
Zahndamm (Alveolen)
-
harter Gaumen (Palatum)
1110 VHoinrdteerrzzuunnggee
,
-
Zäpfchen (Uvula)
-
Zunge (Lingual
9 Zungenblatt
rPehitosneintikv,eLdaisucthleehr reZebitzwge. lreichhrtti.geDiAesuswspar ucnher, läwsusrlidceh bfüer
heute mit einigen Einschränkungen mündlich überliefert
die fehlerlose Erhaltung der vedischen Texte, die bis
es kein Wort für Schrift oder Buch). Eine herausragende
werden (daher der Name sruti, 'das Hören' - im veda gibt
des Alphabets (d. h. der Laute des Sanskrit) nach phone
Leistung der indischen Grammatiker war die Anordnung SticshchrieftnenP.rinzipien. Sie gilt für alle indischen Sprachen und
3.1.2 Vokale ( T wird normalerweise nicht dazugerechnet und ist nur in Spezialfällen in Gebrauch)
12 Zungenwurzel
14 Kehlkopf (Larynx)
13 mKeiht lSdteimckmellippen {Voces) // G„LreahfirkbnuacchhdWes. SMaonrsgkerint"r,oLtheipzig 1989, S. 25
---K--o-n-so--n--a--nten ----- --------- ·-·· - ···-- --··· -··· -- ...------ -- -- -- '1
' einfache _ - 31 _a �--a
� i 1 � 1 '3" u � ü
··-5it !--1i-� -1 � 1
1 Diphtonge
I1 Q. e I'
Q..._
ai ___;_1
311.._ o
1_311�
au__ !'
- ' - - - _....!. ---
1 zKeoinchsonneat n(tse. nu.h),avboeknaalloutsoemKa�tnisscohnaeninteanadmurEcnhdve1.rAämndaercfj"e Vo=kka,leScwhewrduennd sepineeziseallngleakuetenn- gVeomkaäleß uihnrder LaAurtteikualautsionRessihtelnle VaI-uVcIhII, ddeien ,
3.1.3
�d�: �urch avagraha S (BIS� so'ham, von so aham). _ :
1 R�ihen 1-V zugeordnet werden konnen 11
= :,
1 ::: ::::::,, 1 ; ::.
' : :::
1 : �:
1. Velare I CO ka 1 � kha I Tf ga �-
�_a �-�- [ha] 1 I [a,_ _al
(Retroflexe)
ta � tha q da
1,- 'tf--
a 11 ;:i- na-- -1· -r� a
- sa
- --
��nta� T. ·,-a
1 -- !----- dha --�- --- a :
j ; :. a
'
ya
1
<a
�.-,Tr
l_i
1
V. Labiale q pa "Cn pha
; �:��alblaute � ya _ _j_ � ra
� ba � bha ll' ma
� la ---�- va i
[va] u, ü
11 I
1 VII. �s_c=hlaute : _ � sa l::f sa f ff sa [
.L.
: ���: �u- ������ l _!_ha l
_1_ , _ -- - - -
3Ä.1�-u.4-sv- Sarea-ku--nd--ä-- re -Lautzeichen etc. An�_nijj�� ---� Visarga ___ I retroflexes ja Jspezialzeichen
-- ---_--·--7 ;::, ri1 C-: h ffR: harih;
1 oo ja
,3il om
sotfet hfüt rfüKrlamssiemnnAaussallaiuntnveorhr aKlobnesionneasnWteonr,ts
1 nVaoskaallieert Halbvokale und jAS��t�zse�n�,aScthreo:p-hh;ean�: hE',�hd1e, hv"oentc.
ji MV�adriascthhI,·
Alt,e.rna't iv en:
�'-�
35
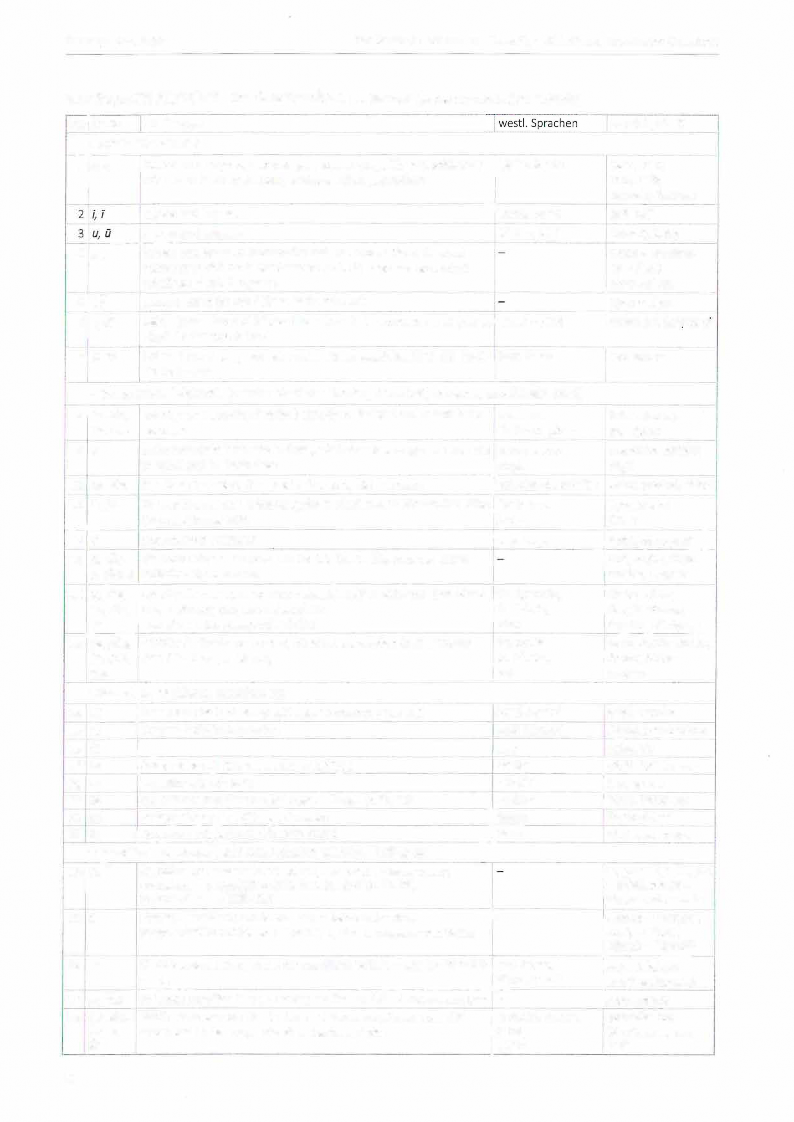
Sarnskrta (Sanskrit) Das Sanskrit-Alphabet mit DevanägarT-Schrift und lateinischer Umschrift
3.1.5 Sanskrit-Alphabet und Aussprache in der Reihenfolge des Alphabets (fett gedruckt)
Nr.' Laute Erklärungen
-
Vo-kale, 'Selbstlaute'
Sanskrit, HindT
„1T1 �, ö 1 koudrezre-seuinmd Hlaoncghedseau,tsecrhsteenr}e,slegtezstcehrelossoseffnen(ugnegsepfräohcrhwenie Schluss-er ! Maler, Made
hbalaa,, bhaa/raa, ,
-�·- -ku�rze-s· und langes u
n i
mitklingt: ri (mit Zungen-r).
4 r, f kriucrhzteest umnadnlasnicghens arc; hAudsesrpAraucshsperraecghioenimal uNnotredresnch, iwedoliecihn; imleeicishtt
-i Muitttee, rM, Mieutet
bkah!oi,rkacita/T, bharata K($1JO "' Krischna,
bhuvoh, bhüh
. ($ipitfnz r"'ischi,pitrrn
1 Narendra� La�smya�
1 • -
651!,/e, ai
7 o, au
kboemidme timnmureirnlkafnpgv; oori, iisktlignegstclheliochsstemneitr/amlsithochdeutsches ai (nur in · Meer, "' Neid bHinddeT äimodmerereyl,awngie; haeuy) ist meist etwas geschlossener als hoch- Brot, Braut
-----ikfpta "'k/1pta
am, agnau
8
-
Konsonanten, 'Mitlaute', (zu unterscheiden: stimmlos, stimmhaft, behaucht, unbehaucht, nasal)
deutsches au /
i ka, kha, ga, gha
wneichhmtiegnfür Deutsche: k nicht behauchen, Beispiel am Französischen
dfrtz.. Kchoinntdr,eg, h: -
gk äok, ov,igkhhneocarT,
-
i1
isnteEhntkneul ruvnodriVmelEanrgelniswchi enin Engel, wird aber separat gesprochen wielsuinncgllee, ankle,
oihlogialkara, oilkara,
-
ca, cha
bZueabce�atcehntebneiisctadkirea:VAeurbsisnpdruacnhgejfitosc: hinakHrian,dnT igcy�ot ,sicnhMakirtatelindien
_ j iDtaslc.hcuianog;edlt, . tschh üss
Jcaoykora, j, hpoolc/oarmT, i; chäya
-
Ja, Jha
-12 l_fi_
s(steohmt eniusrt vimorSPaanlasktarilte)n
dfiya.
-
engl. angel
. ---1 jPfioätonfiaJa!, Afil_c!na--�
jha: -
-
ta, tha, die Laute klingen dumpfer als Dentale (s. Nr. 14), kommen nur in Jota, hatho, tar;/a,
na
da, dha, I ausprobieren); tha, dho behauchen; 1 dt Th isch,
bh:-
-
<;lta, ,<;l-thha-;;,, fJ j i�nldcihstcihgefnürSpDr�aucthsecnhev:otra �icht beh�c-hen (mit K�r;e -vor d�m MuncJifrz.ty�annie, beachten: ddho Aussprache d-dho dha: -
1' tmimür;lirhaa, ,nGatahfa)e, sa
r Durga, dhormo,
matsyo
bu-ddha-, Naraya-f)a-
ba, bha, dem Mund ausprobieren)
ma
-
.-po, p-ha, wichtig für Deutsche: p nicht, bh leicht behauchen (mit Kerze vor
-
•yaHalbvoka/blee, aZcishctehlna:udter HLautchelnatuspt eritcch.t d�m deutschen j wie in ja
wuniegesfcähhmr witiezusmchGvaourmi en gebogener Zunge (s. Nr. 13)-
187 rJaa I Zung�n-r wie im Bayrischen
19
fdrtz.. pphautdriel,,
JRoasdeif,(RJuegtteicnhd) WLiloielke
1 pBoudhoo, k, oBphaimloo, ,kopho,
Lo-lita, IT/a
Ry-oag-moo, ,mpoayraü-r-barahmo
21 $0
va
sa
22 50
11' Au-ssprache m-it Zähnen an der Unterlip-pe
Aussp·r-·ache-an-d- en Zähne-n-, stimmlos
"'"'Sscchhoifnf
J�GHaussse
11 Sviavyaü, ,vvr'sifc)cii_l:, o;;o, evCJ
1 SVoi$rfa)Usv, oKt(T,$/)sOo,t$Ot
23 •hsaekundä1·reA-uLsa-huatzuecihchme-int-l(eni-icchhtt gzeuöm-ffAnelptheambeMt ug-nedhörig), HindHaute -
Hari, Hora, ohom
241 f"(J,-w Anunvääsrikaaf"(J�: A: unasssparliaecrht eVokftalwe,iebems,. ainnsHoinnsdtTe(ns.'KNlra. s2s6e)n, nasal';
1'1 =ofo"(lfigJoio/=iI opnimg••od,oo=f"(ljoli
25 h Visarga, Hauchlaut; am Schluss eines Satzes oder einer 1 -
in Sanskrit a. / (tal/okan)
Strophenhälfte mit leichtem Nachklang des vorangehenden Vokals
pif)r;/ af"(lta = ta
! Visnuh - Visnuh! .. ·• •
1 Harih - Harihi,
Ramah - Rämah0,
26 ~
-
ra, rha
HindT-Sonderzeichen, Tilde, für nasalierte Vokale - wie im Französi- , sang impur, im HindT: retroflexe Flaps, Anschlag der Zunge hinter d. Zahndamm (z r) -
u
1 paro, barhäeortes ä)
:! mmaeT, (hnua, sbaali_s__u.:....:.._ri,______
se-h-en - .. -· - ----- . -- ·- - --+-a-l-lons enfants
-
qa, ls!Ja,
HindT: Laute aus dem Arabischen und Persischen, Aussprache der f:z: Fsalgl,en, siegen,
qalandar, haq,
ga, za,
Ja
36
ersten drei im Rachen, z wie stimmhaftes s, f wie f 1 Rest: -
ffs!Jaqu'dr a, g_azal, zikr,
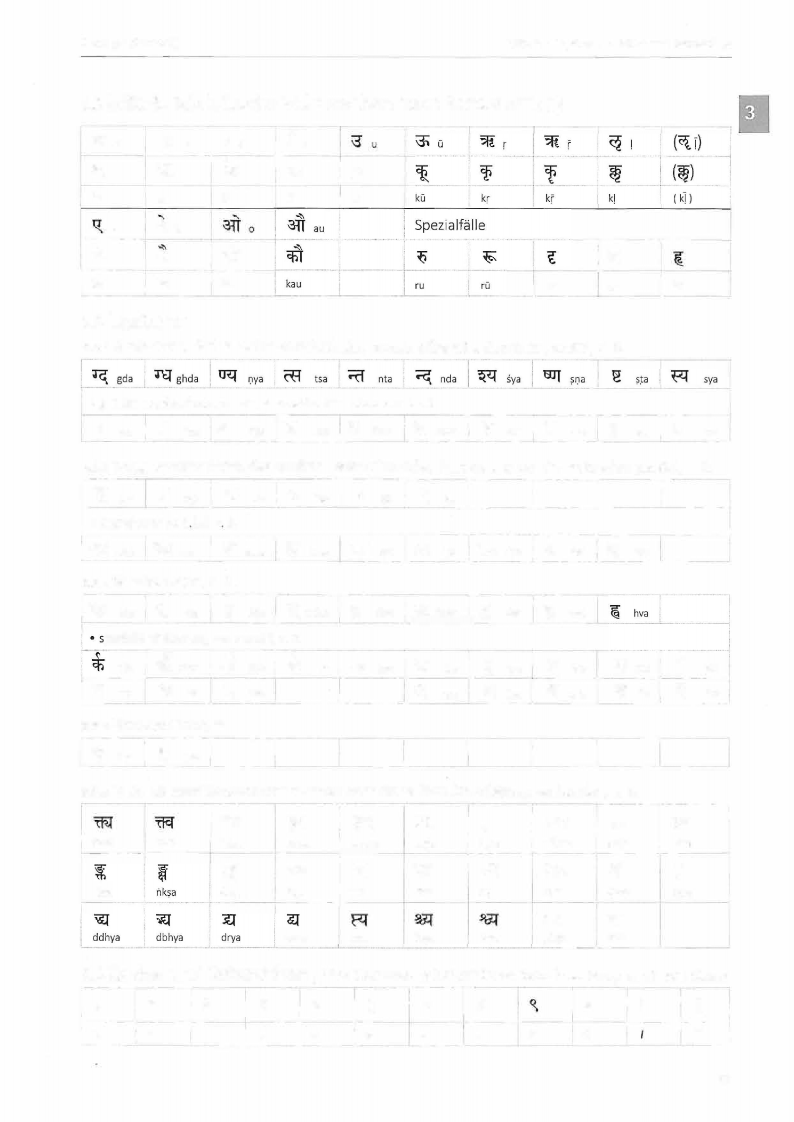
Saryiskrta (Sanskrit) Mäträs • Ligaturen • Zahlen und Satzzeichen
L1
�T
-
-
-
-
-
Mäträs {diakritische Vokalzeichen nach Konsonanten)
� a
cfi
� ä
kä
cfiT
-l�i
Ffi
� 1�
ka
-···-"
cfi
e --
� ai
cfi
ki kT
- 11-cfil-- ..
: ku
--L-, -9l --,---
1-�
1 .kai
1 ko
j dr
sr i hr
-
Ligaturen
-
Senkrechter Strich rechts verschwindet, zweite Silbe wird daneben gesetzt, z. B.
l
-
je nach drucktechnischen Gegebenheiten Ausnahmen zu 3.3.1
-
-
-
=er cca 1 "§;l iica � . ii_ja_ __(iJ_ tna L ff dh na . _� mn_a -i, -.ji_
3.3.2 Waagerechter Strich des zweiten Lauts schwindet, Rest wird unter die erste Silbe gesetzt, z. B.
r
--�na ! �_-__��a--_-g - �r-8 p_t_a_
l . ••-· J� T - �-
� kya j_�� �c;lya_t_�-� � _ hy_a_�-
t-�-t----
::hme-�- " ;':,, ;7 "' 1 �:rJ--"'
i ,::_[�
: � dma
� hma
j �_l<m� � nma
1 � kt� 1 -�--tta-
3.3.3 Verkürzungen, z. B.
-----. . . - - --- 1 --- 1 --- - -----1
:--- �-d-�- -� �_J_ -ä d��a-,T-i-
dna _ j _?:_db_h_a __-; a�_-dva_Li- hna
1 pez�(le Verkürzung von rund s� z� �-
rka 11 �'1'1 rkau i! :n't•tt rgo :j ::t.-'lc. r!__
-
I,,_
=��a _ J1
� jra 11
tra 11
dra ö;i{ nra 1
Q pra
� s a L ?;
�--·-
1 ---
; � tra � sra __ _!__h�
l _ _ __ � r
�---sca--1 � sna_J sg -� ij--_ s-va---- -
l3- .3-.4 -Versc-hm-e- l-zu-n-gTen - -
i l -,
L �- k�a I�_ jiia
,
--
_____ l
�k,ma
- 1 l 1
�I k,mva
�k,v,
1 � 1
I - -
__ 1 _gdh,a
3.3.S Mehr als zwei Konsonanten werden nach denselben Grundsätzen ve�rbunde1n-, �z. 1B.
�------1
- --
_ _ !
goy;
1
g,ya
i _k_>'_'
1 ktya ktva 1 �k,oa
nkta !., ··:_ J:: : . ,:
tct=Qsya
u
·-
ddya
dÄdra
3.4 Zahlen unid Satzzeichen (/bei kleineren,//bei-gi-rößeren Satz-bzw. Stropheneinschnitten)
dvya ptya scya svya
��thya---
�stra
1 � --�1� -- '
1! �
l
i � 11 �
--� - � -
1 0 1 1 , II
1
:1L-_ 1 -- -1 2 -\--3
--�--1 4-
•· --
r -·-
5 _ i_ 6
-
7-- - - 8
,- -1------
_J
9 0 // !
37
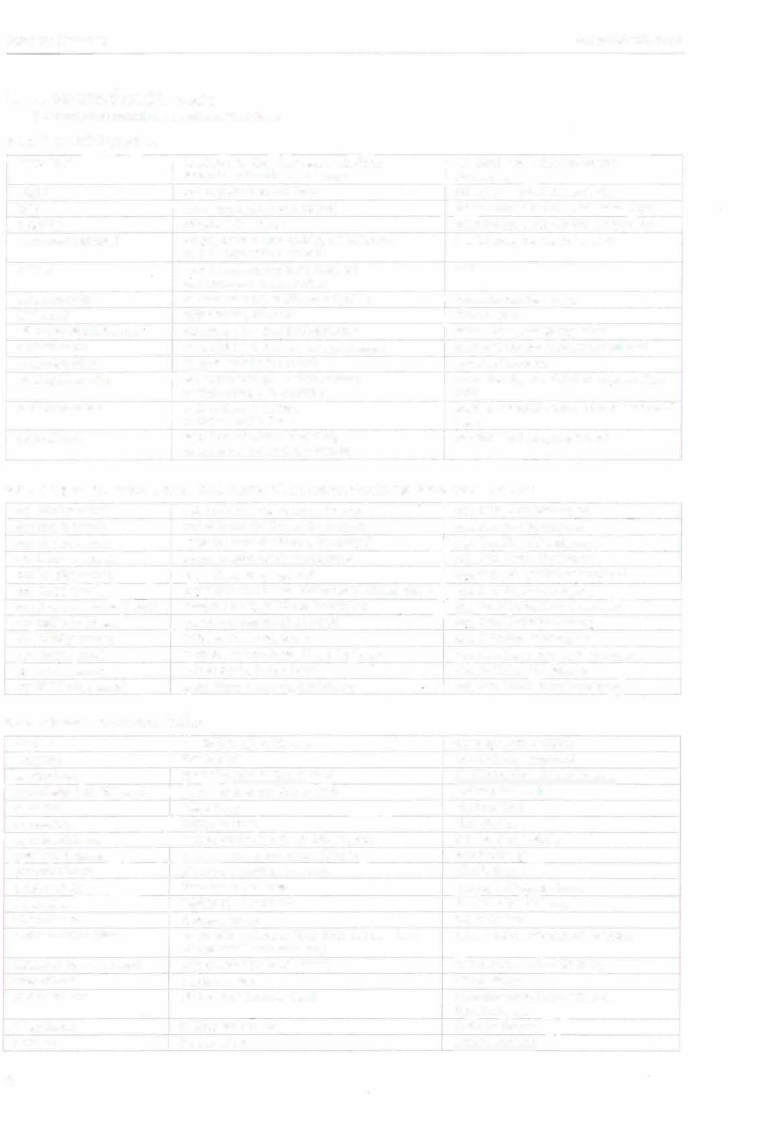
Sarpskrta (Sanskrit) Ausspracheübungen
-
-
Ausspracheübungen
{Abkürzungen: m maskulinum, n neutrum,ffemininum)
-··- - · ·
-
Kur:,c;lalinT-yoga m
1 kui:,c;!alinT J
näc;!Tf ic;!äf pirigaläf
su?umnä/su?umi:,äf cakra n
sahasrära-cakra äjFiä-cakra
visuddha/visuddhi-cakra anähata-cakra
mai:,i-püra-cakra
---- -·---- -- -- .
1
kui:,c;!ala m/n Ring; kui:,c;!alin mein durch Ringe Charakterisierter, Schlange
1
von nac;!a/nala mSchilfrohr Erde, Sprache, Labung, Spende pirigala rötlichbraun
su gut, wohl; sumna gnädig, n Wohlwollen, mein Hauptstrahl der Sonne
vom lntensivstamm der Wurzel car, sich bewegen, umherstreifen
sahasra tausend, ara/ära min Speiche äjFiä J Befehl, Erlaubnis
visuddha rein; visuddhi J Reinigung
an un-/nicht; ä hier: an; hata geschlagen mar:ii mJuwel; püra mFlut
1 die durch Ringe Charakterisierte, [_ Aufgerollte
Röhre, (u. a. feinstoffliche) Ader
- �Be-z·--eichnung einer der drei Haupt-n-·-äc;!Ts Bezeichnung einer der drei Haupt-näc;!Ts Bezeichnung der zentralen näc;!T
Rad
' tausendspeichiges cakra 1,_ Befehls-cakra
reines cakra, Reinigungs-cakra
cakra des un-an�ieschlägenen (Klangs-) Juwelen-Flut-cakra
svädhi?thäna-cakra mülädhära-cakra sakti-cälana n
1 sva eigen; adhi-?thäna (von sthäna)
n (Wohn-)Sitz, Ort, Autorität
müla n Wurzel; ä-dhära mStütze, Gefäß, Basis
sakti J Energie (hier: kur:ic;!alinT); cälana n das In-Bewegung-Setzen
-
cakra des eigenen Orts/der eigenen Auto rität
cakra der Wurzel-Stütze oder der Wurzel
Basis
das 'sakti-in-Bewegung-Setzen'
-
3.5.2 Sürya-namaskära-mantras (namas n Verneigung, Verehrung) Sonnengruß-mantras
OfT1 miträya namat:i mitra mName der Sonne, n Freund I OfT1, dem Mitra V�rneigung OfT1 ravaye namat:, ravi mName der Sonne, Sonnengott 1 �fT1, dem Ravi �rneigung
?f11, de127 Sürya Verneigung.
-1··
OfT1 süryäya namat:, sürya mNam_e_der Sonne, So�neri.�t!
OfT1 bhänave namat:, bhänu mLicht, Erscheinung, Strah! OfT1, dem Bhänu Verneigung
OfT1 khagäy-a n- a-m-a- t:,- - -
k-h--a n Himmel; -ga gehend
om, dem am Himmel Gehenden V.
.
0[11 pü?r:ie nama� _ püsan mName des ved. Gottes der Herden u. Wege . , _of11, dem P0?a� VerneJgung
_OfT1 hirai:,ya-gar��ä_ya_namat:, hirai:,ya n Gold; garbha m Embryo etc. j orp, d.em G_old�mbryo Verneigung
___<)__fT1_marTcaye namat:, . _ma.!"Tci mLichtstät,J.�chen, Strahl om, dem MarTci Verneigung
om ädityäya namat:, äditya m Name der Sonne om, der Sonne Verneigung
-OfT1 savitre n-amat:,
sa-vitr mHervorbringer, Name der-Sonne
O-f--T1-, dem Hervorbrin--ger Verneigung
om arkäya namat:i
arka mStrahl, Sonne, Feuer
om, der Sonne --Verneigung -
OfT1 bhäskaräya namat:,
b. -häs J Licht, Glanz. ; -k�a-ra machend
1 OfT1, dem Lichtbringer Verneigu'2!5
-
-
-
Yoga-vidyä-äsana-Reihe
-
äsana n
sT-r?äsana
[-von _äs (sitzen); s�!fix -ana
1 sTr?a n Kopf
das Sitzen, Sitz, Stellung Kopf-Stellung, Kopfstand
r- sarvärig-äsan-a
garbhäsana (od. bäläsana) haläsana
s-a-rv-a-a-ll---ariga n Körpe-r, Gli-ed
1 garbha m Embryo; bäla mKind
hala n Pflug
---- ---
All-Glieder/Ganz-Körper-Stellung Stellung des Kindes
Pflug-Stellung
matsyäsana
' setu-bandhäsana
_p�scimo_ ttänäsan..a pürvottänäsana_ bhujarigäsan_a salabhäsana dhanuräsana
ardha-matsyendräsana
käkäsana (lyengar: baka-) mayüräsana pädahastäsana
tri-koi:,äsana saväsana
38
1 - matsya ,Ti Fisch-
-, set� Brücke-; bandha mBinden, Bau
_____pascima hinte!2;_1Jt-�na Ausi�hnef!._ pü_rva vorn; ut-täna �usdehnen bhujariga mSchlange
salabha mHeuschrecke dhanus n Bogen
ardha halb; matsya m Fisch; indra m hier: Herr Matsyendra Name eines yogT
käka mKrähe (baka m Reiher) mayüra mPfau
päda m Fuß; hasta m Hand
tri drei; koi:,a m Ecke sava mLeiche
Fisch-Stellung
Brücken-Bau-Stellung
�r__wärtsbeu1;�-- schiefe Ebene
�Sch-la- ngen-Ste-··l·lu-·ng, Kobra Heuschrecken-StelIung
Bogen-Stellung
halbe 'Fisch-Herr'-Stellung, Drehsitz
. - ·-
Krähen-(oder Reiher-)Stellung
Pfau-Stellung
Hand-zu-Fuß-Stellung, stehende
-
Vo-rwärtsb-e-uge - ·-· Dreiecks-Stellung-- Leichen-Stellung
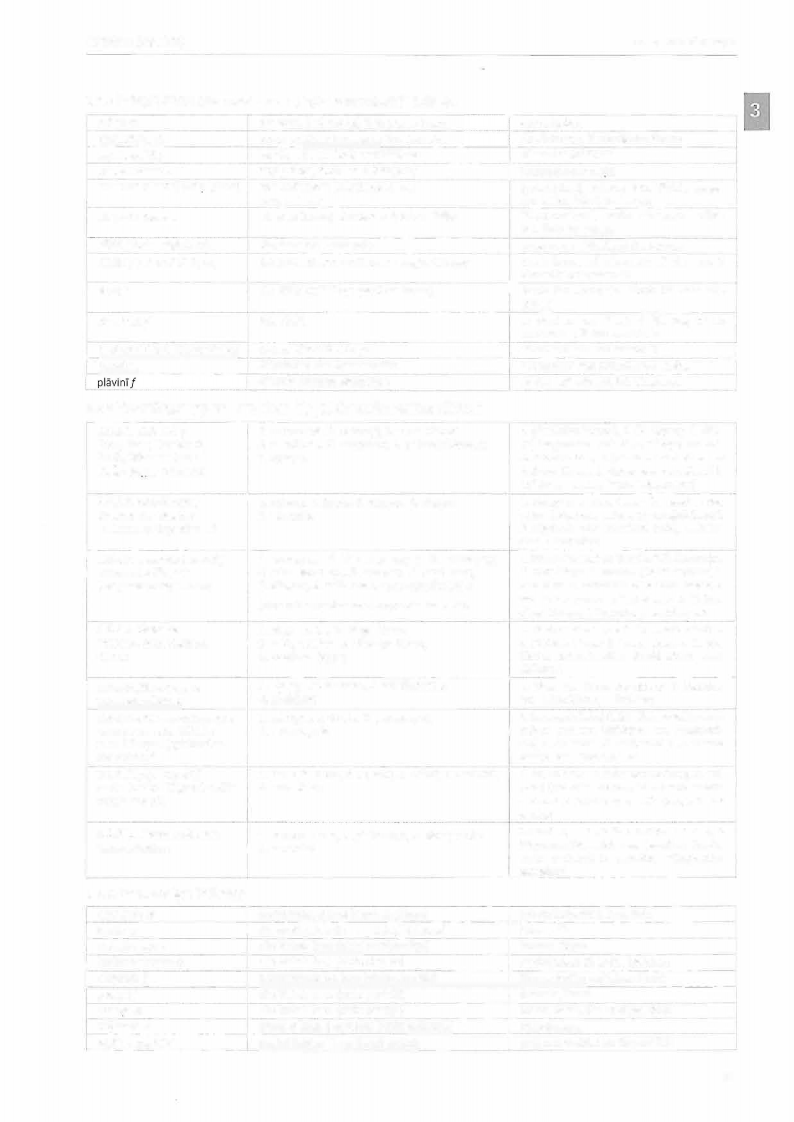
Sarriskrta (Sanskrit) Ausspracheübungen
-
Prär:iäyäma (das meiste nach „Hathayogapradipikä" 2.35, 44) -
prär:ia m
pra vorn, bedeutend, fort; äna m Atem
-
Atem, Leben
-p-rär:iäyä---m-a m--
prär:i-a--m- -A-t-em; ä-yäma m Strecken e•t..c.
_ _ _Ausdehnung, Eontrolle de� Atem�_
kapäla-bhätif näc;H-sodhana n
anuloma-viloma[-pränäyäma]
kapäla m/n Schädel; bhätif Glanz näc;JTf Ader; sodhana n Reinigung anu entlang; vi auseinander, weg;
loma---m Haa-r �
----
Glanz des Schädels
! - Reinigung der nädTs
[pränäyäma] entlang dem Strich,
- -- -
.
de--n Strich, Wechselatmung
gegen
sürya-bhedana n
ujjäyTf (oder ujjäyin m) sTtkärTf (oder sTtkärin m}
sTtalTf
sürya m Sonne; bhedana n Spalten, Teilen
-
die siegr-ei-c-h Ma--c-he-nde --- - - -
die sTt-Machende (mit quer gelegter Zunge)
-
die Kühle (mit längs gerollter Zunge)
'Sonnenteilung', rechts einatmen, anhal ten, links ausatmen
einatmen mit Geräusch im Rachen
durch Mund mit dem Laut sTt ein-, durch Nasenlöcher ausatmen
1- durch den Mund ein-, durch die Nase aus-
bhastrikäf
Blasebalg
- ---------------
-- --- -- - ---
atm-en..- --- --------- -
in bestimmtem Wechsel Atmung durch
·- -- -- -- -
rechtes und linkes Nasenloch
-- - - -- ---
i
, bhrämarTJ (od. bhrämarin m)
die zur Biene Gehörige
sum-mend--ein- und ausatmen J
mürchäf____ _ _
Schwinden des Bewusstseins die Schwimmen Machende
Ausatmung m- it jälan-dhara-bandha so viel Luft wie möglich einatmen
-- - -----
-
-
Begriffsgruppen aus dem Yogalehrer/innenhandbuch
-•-
-
-
-
-
bhümikäf 1. subhecchä, 2. vicärar:iä, 3. tanu-mänasä,
1. glückhafter Wunsch, 2. Überlegung, 3. (Ebe
Erde, Platz, Stockwerk, Stufe, Wissensebene [Yoga-väsistha 3.118.5,6]
-
citta-bhümif Ebenen des Geistes
-
-
-
[s. Komm. zu Yoga-s0tra 1.1]
J - - -
; 3.5.5.3. navavidhä bhaktif
, neunfache Hingabe [Bhägavata-puräoa 7.5.23]
3.5.5.4. bhäva m Werden, Sein, Zustand, Gefühl
4. sattväpatti, 5. asarrisakti, 6. padärthäbhävanT,
7. turyagä
i 1. müc;lha, 2. k�ipta, 3. vik�ipta, 4. ekägra,
5. niruddha
1. sravar:iafTl, 2. kTrtanafTl vi�r:iot:i, 3. smarar:iafTl,
-
päda-sevanafTl / 5. arcanar]1, 6. vandanafTl,
7. däsyafTl, 8. sakhyam 9. ätma-nivedanam // (ohne Zahlen ist dies eine Strophe aus 4x8 Silben)
1. sänta-bhäva, 2. däsya-bhäva,
' 3. sakhya-bhäva, 4. vätsalya-bhäva,
5. madhura-bhäva
ne) des geringen Denkens, 4. Gelangen zu sattva,
-
Nichtanhaften, 6. (die Ebene der) Abwesen heit von Dingen, 7. (Ebene des) Verweilen(s) in turiyä (dem vie-r·t· e,,_n_ Bewuss-ts-ein-sz-u---s-•tand) __..
1. dumpf (z. B. durch tamas), 2. geworfen (von
einem Objekt zum anderen durch rajas), instabil,
3. abgelenkt (aber manchmal stabil), 4. fokus
- -
-sier--t, 5.-kon-tr-o-ll-ie---rt---- -
1. Hören (Geschichten über Gott), 2. Preisen (mit
Liedern) Vi�i:ius, 3. Erinnern (Seines Namens), 4. Seinen Füßen (Seiner bildlichen Form) dienen, 5. rituelle Verehrung, 6. Verbeugung, 7. Haltung
eines Dieners, 8. Freundes, 9. Selbsthingabe
1. friedvolles/ruhiges Gefühl gegenüber Gott, 2. Gefühl, Sein Diener, 3. Freund zu sein, 4. Ihn zum Kind zu haben, 5. 'süßes' Gefühl, wie zu einem
- - ---·- -,
Geliebten - -
i 3.5.5.5. jf\äna-yoga m yoga des Wissens
-
-
-
-
sädhana-catu�taya n
1. sravar:ia, 2. manana, 3. nididhyäsana,
4. anubhava
-
vairägya, 2. viveka, 3. �at-sampad,
-
Hören (der Worte des Lehrers), 2. Nachden- ken, 3. Meditieren, 4. Erfahrung
-
1. Leidenschaftslosigkeit; 2. Unterscheidungsver-
Gruppe von vier Mitteln zum Erlangen (spirituellen Fortschritts}
4. mumuk�utva 1 mögen (zwischen Wirklichem und Unwirklich em), 3. die sechs Schätze/Tugenden, 4. Zustand dessen, der Befreiung sucht
-
-
�at-sampadf
sechs Schätze/Tugenden (für Schülerschaft)
-
äsrama min hier: Lebensstadium
-
-
-
1. sama, 2. dama, 3. uparati, 4. titik�ä, 5. sraddhä,
6. samädhäna
1. brahma-carya, 2. gärhasthya, 3. vänaprastha,
1 4. sannyäsa
-
innere Ruhe, 2. Selbstbeherrschung, 3. Auf hören (mit Sexualität und anderen Sinnesgenüs sen), 4. Geduld, 5. Vertrauen/Glauben, 6. Zufrie denheit
1. Schüler-, 2. Haushalter-, 3. Waldeinsiedler-, 4. Mönchtum (Angehörige des jeweiligen Standes sind: brahmacärin, grhastha, vänaprastha,
---�_s_an_ny��n) ·- _ _
-
-
Schwierige Wörter
-
-
- -·
aharikära m
.i zwe. itl�et·zt··-es--ä-lan·-g (nicht a-harikara} - - - -·--'.1 -·l-ch--/S-el-bst-ge-{Ühl,-Eg-O:--S·t··o-·l�· ---�
äkäsa m
i die zwei ersten- ä-s lang (nicht-akkasha}
-- • Raum, Äther
antat:ikarar:ia n
alle Vokale kurz (nicht antal:ikarär:ia)
_ i inneres Orga.'.1 _
----+
1
_ ___
/ ekägratäf prakrtif
1 brahma-cintana n
purusa m
alle Vokale kurz (nicht cintäna}
alle Vokale kurz (nicht purü?a}
! Nach-de-nk-en -übe-r d-a--s··brah-m-a-n------ -
zweitletzte Silbe kurz (nicht ekagrätä} 1 Konzent�tion �u!_ei��n �_nk!_ _ alle Vokale kurz (nicht prakrTti) [ Materie, Natur
_
Mann, Seele, das Höchs!e:<;�tt
� � r·
täc;l-ä-san·-a-n
-· -- ··-··-·
· ·- -
__erste� �a11g,j c�rebr� (ni�ht tadäsan_a) 1 Berg-Stellung
--yo-g-T m-, ·yog-inT··f-··--- -- -
yoginT: letztes T lang (nicht yogTni_) _ j yogT u11d w�i_ bJi0�s G��nstück:
39
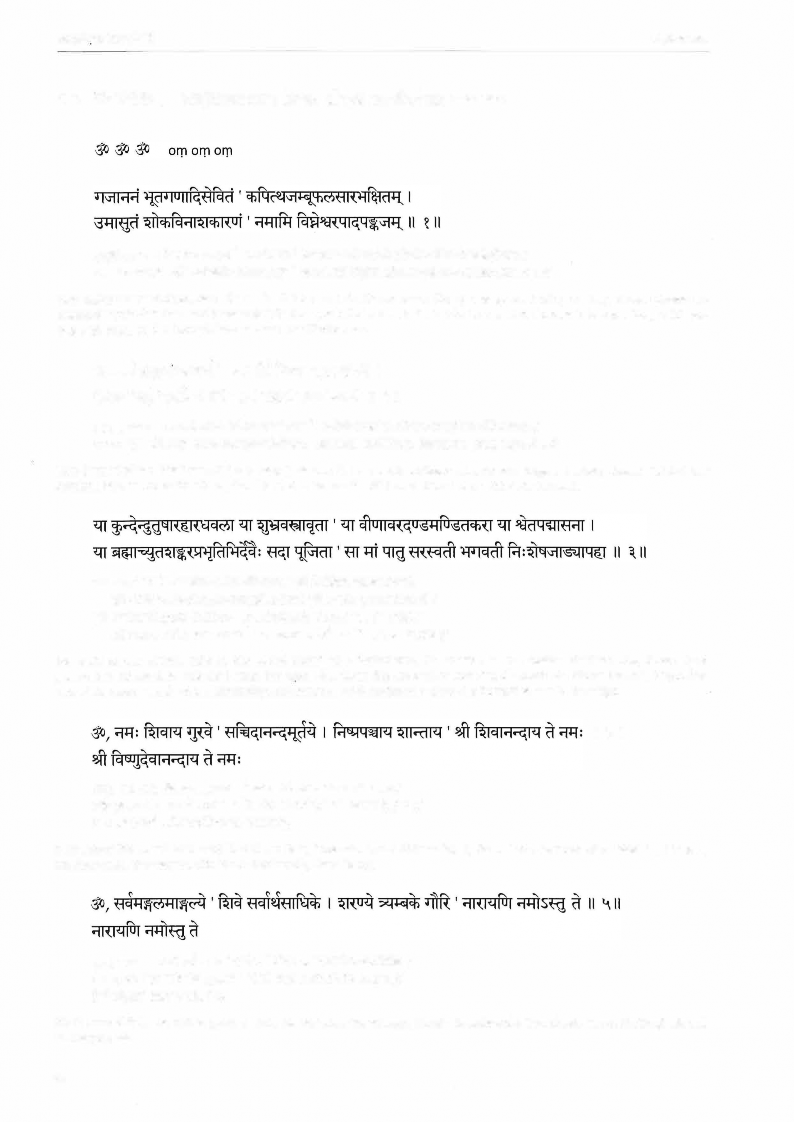
Sarnskrta (Sanskrit) Gajänanam
-
-
-
·IIZillrlrF4, Gajänanam bzw. dhyäna-slokas [Kirtana6o3J
gajänanarn bhüta-gar:,ädi-sevitarn 'kapittha-jambü-phala-sära-bhak�itam / umä-sutarn soka-vinäsa-kärar:iarn 'namämi vighnesvara-päda-parika-jam // 1 //
Zum Elefantengesichtigen, dem durch die Geister und die Heerscharen (Sivas) usw. gedient wird, zu dem, dessen Speise die Essenz/der Saft der Holz- und Rosenapfelfrüchte ist, zum Sohn der Umä, der die Ursache des Verschwindens von Sorgen ist, ver neige ich mich, zu den Lotosfüßen des Herrn der Hindernisse.
�t:i;s�1�r1-.r1 ��1-1{ffii:!a1 • 1-1€:l'-11a .....�.-oqTT"1-1r'T�TT"-r-c1TT1=r-€:rl--.-�rT
1
-
� "'' r::,.
� �. tj{fi�rllrll�. ' �. �. �. >fCfa'"' II � II
�ac;l-änanarn kurikuma-rakta-varr:iarn 'mahä-matirn divya-mayüra-vähanam / rudrasya sünurn sura-sainya-nätharn 'guharn sadäharn sarar:iarn prapadye // 2 //
Zum Sechsköpfigen (Kärttikeya/Subrahmar:iya), dessen Farbe rot wie kunkum ist, dem von klugem Denken, dessen Gefährt der göttliche Pfau ist, zu Rudras Sohn, dem Herrn des Heeres der Götter, zu Guha nehme ich stets Zuflucht.
yä kundendu-tu�ära-hära-dhavalä yä subhra-vasträvrtä
yä vTr:iä-vara-dar:ic;la-mar:,c;lita-karä yä sveta-padmäsanä / yä brahmäcyuta-sarikara-prabhrt:ibhir devaih sadä püjitä
sä märn pätu sarasvatT bhagavatT nibse�a-jäc;lyäpahä // 3 //
Die weiß ist wie Jasmin, Schnee, der Mond [oder) eine Perlenkette, die angetan ist mit weißer Kleidung, die, deren Hand geschmückt ist mit dem Hals der besten der vTnas, die, deren Sitz ein weißer Lotos ist, die durch die Götter Brahma, Vi$t:)U, Siva usw. stets verehrt wird - diese ehrwürdige SarasvatT soll mich schützen, welche die Dumpfheit restlos beseitigt.
II � II
orn, namah siväya gurave 'sac-cid-änanda-mürtaye /
ni�-prapaficäya säntäya ' srTsivänandäya te namah // 4 // (srT vi�r:iu-devänandäya te namah)
Dem Lehrer Siva, der (sichtbaren) Gestalt von Sein, Bewusstsein und Glückseligkeit, der frei von der illusionären Welt ist, friedvoll, Dir, Sivänanda, Verneigung, (Dir, Vi$r:iu-devänanda, Verneigung).
orn, sarva-marigala-märigalye 'sive sarvärtha-sädhike / sarar:iye tryambake gauri 'näräyar:,i namo'stu te // S // (näräyar:,i namo'stu te)
Die Du zum Glück allen Glücks gehörst, Sivä, die Du jedes Ziel erlangst, Schutz Gewährende, Tryambakä, GaurT, Näräyar:iT, Dir soll Verneigung sein.
40
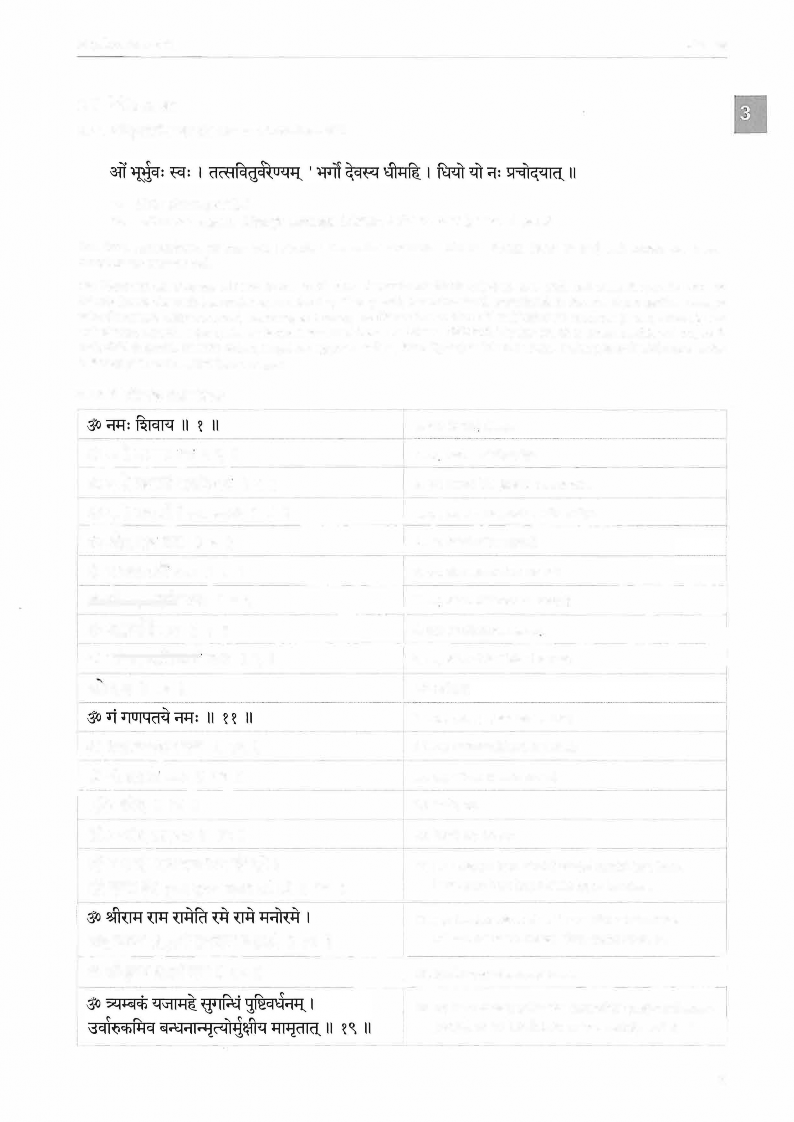
Saryiskrta (Sanskrit) Mantras
-
-
Mantras
-
GäyatrT-mantra [�gveda 3.62.10, KTrtana 610]
tat savitur varer:,yarri ' bhargo devasya dhTmahi / dhiyo yo nat:, pracodayät //
orri bhür bhuvat:, svat:, /
Eingebungen anregen soll.
Om, Erde, Atmosphäre, Himmel. Wir möchten dies erstrebenswerte Licht des Gottes Savitr [in uns] aufnehmen, der unsere
Zeit als Essenz des veda betrachtet wurde. tad das, dieses; savitr hervorbringend, antreibend, m Bez. des Sonnengottes; varer:,ya
wauüfnechhmenesnw, errte, iecrhsetrneb(iemnsswpäetret,rehnerSvaonrrsakgrietnwdu; rbdheargas n Glanz; deva m Gott; dhi'mahi (dha) wir möchten [in uns] setzen, in uns
Die Gäyatri ist ein Versmaß mit 3x8 Silben pro Strophe. Es wurde zur Göttin erhoben, u. a. wohl weil diese Strophe im Lauf der
yaf:,
innetB)e; wdhei'fguGngedsaentzkeen, ,Eainnstircehibt,eSnc,haanur,eEgienng.ebung (�gveddhai,mWahitizdele, rBWanudrz2e)l; dhi/dwheylac,h'edre; nnkaef:,nuanns,, üubneser re; tpwraas-cmodeadyitäiter(ceund',) zeurgmeoörgde
-
Weitere mantras
3-0-;,m .-!-Fll./..lO-W-1 II � -II
---· -··-
-3".-0 ;:J+TT"'\ �"'\ cll�"'\qcll./..1 II -a_ II '3,:.,:0 ;:J+TT"' +Flc@""'\ ri""l-:i-.--1cll'T'"l.-l......�......,1,...,..../..l II � II
-
orri namah siväya
-
om namo näräyar:iäya
-
oryi namo bhagavate väsudeväya
, 5. oryi sri-rämäya namal:i
-·---- ------ ·-1 4. o-ryi· namo-b·h-- a-gavate-s--i--v-änan-d--ä-·-ya - -
-3':o �(1�1./..l ;:n:r: II '"\ II
'3":o �,. {-F(f<:k�� ;:n:r: II � II
1 6. om airyi sarasvatyai namab
- --- --- - ·1
i��l�t[lci� ;:p:f�-11.� II ----- - --- 7. om sri-mahälak$myai namal:i - -
'3-:0 � ;:n:r: II � II
- - · - 1_
-
oryi srT-durgäyai namah
. � � -� ;:p:f-:- - ··------ --� . --· -1,-9.-orri-sri-mahäkälik-ä-yai n···a···m-
al:i ·-1
'3":o %�t[lchllcichl./..l II Q.. II
ms� 11 �o 11
1 '3":o � ;:n:r: II �� II
1-������-�:_u n_ II
-
so'ham
-
oryi garyi gar:iapataye namab
-
oryi saravar:iabhaväya namab
-
oryi sri-hanumate namab
:
�
"'
ffl
"'\
ffl
"' :
' II �� II
� mlBa_
'
"'\
II �'"\ II
-
harib om
-
harib oryi tat sat
"'
� {Jl=f � {Jl=f
m=r
""
{Jl=f � � 1
-
harre krär$mr:i(aa)hahraerekrr$är:ima(kar)$rr:iäamk(ra$)r:iraämha(rae) hharre hare,
-
�'"'\ ��"'\ ����"" �......
ftti�.-11� �• ("TTT1�T""'TT.-11�TT cfUrf.-1 II
'3":o � � lP1 II �� II
..,_
- ---- � ---- ..
II �� II
18. l
�\9 II
sahasra-näma tat tulyaryi räma-näma varänane
_orri srT-kr$r:ia sarar:iarri mama ---· _ _
--�=17. oryi sri-räma räma rämeti rame räme manorame,
19. ourryviätrruyakammbaivka rbyiaynadjähmanaähnemsurgtyaonrdmhiryiuk$piyua$tmi-vaamrdrhtäatnam_ , 1
41
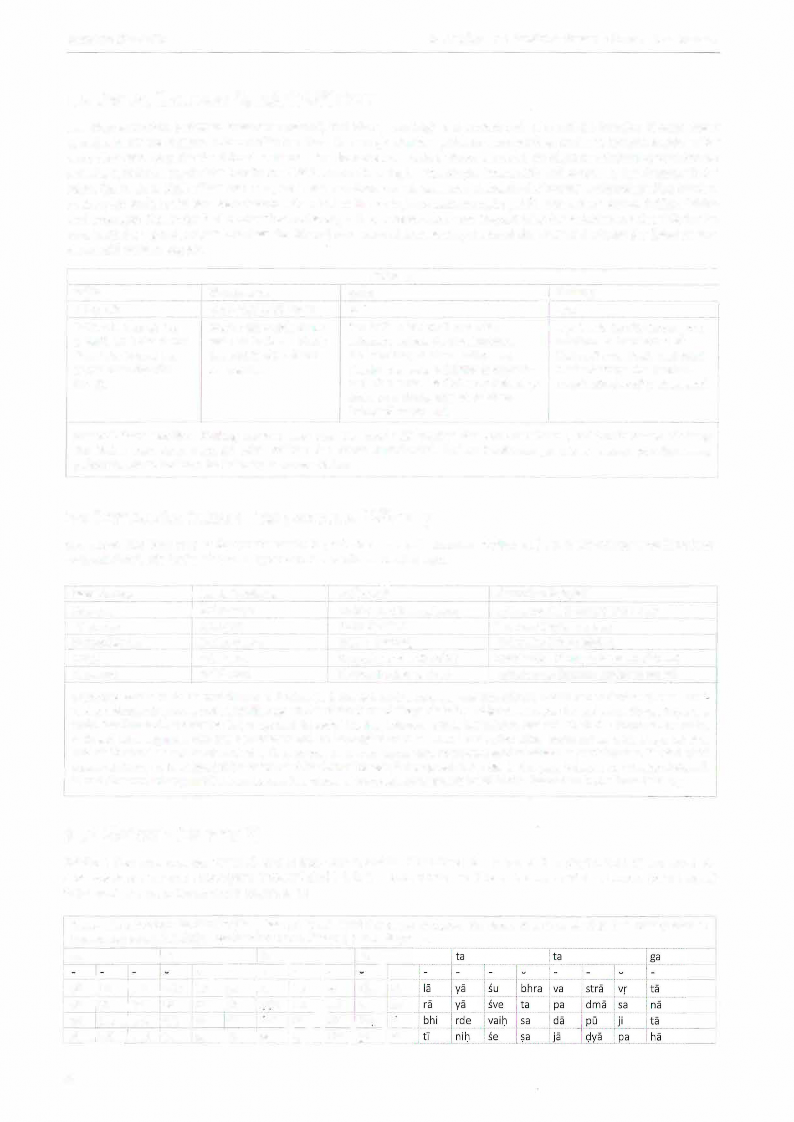
Sarnskrta(Sanskrit) Der Aufbau von Sanskrit-Wörtern • Komposita • Metrum
-
-
-
-
Der Aufbau von Sanskrit-Wörtern
veda) verfasst sind. Die Sprache wurde später
uIm ZeEntdrum stehte meist eine Verbalwudrzel, der nicht we. itBe.r zerleegbamrembedeutungstraagendde Kernr eines Wortes. Suffixeo, rPräfiixe
Pär:iini (ca. 5. Jh. v. Chr.) erfährt man u. a., nach welchen G etzen die nzelnen Elemente der Wört r aneinandergefügt werden.
SDparsacWhoer, tinsadrrier-sdkiretaälbteesdtentientd'ozeuusarompmäiesnchgenseTteztx't,e'(kudletrivaielsrtg',e'ogfefreeninbiagrtt' guenltdenbdeezieht sich u. a. auf die korrekte Bildung dieser ianudcihscdheevSap-vräac(lht,w'SispsreancshcehadfetrleGr öbtetreeri't, sgveonran3n0t0. 0UmJahdrieenvePhdoisnchoelongiTee, xEtetyminoilhorgeime, gGernamaumenatWik ourntdlauMt ezturiek.rhInaldteenr , Gurnatmermriacthiktedteens
verursacht werden,
Santdz. Lauutlnicgheen Vdei rännednedruenr gBeendeinuntuenrhgaslbifdfeerreWnzuierzreulnnge, nz nt mdaenr AB bslatiut, soulncghed,edrieWdourrtchrt doaseAr ndeeinaVnedraenrkfüegruen dernEeisnWzelemteesntme
sandhi.
Präfix
ud-(>ut)
tVaenr(b>alwtäunr)zaeul sdehnen Wurzel tan wurde zu tän,
Suffixuttänasya
D-aas Suffix-a bildet oft maskuline,
, Endung
a-Stämmen, bezeichnet oft
-1
-sya
verursacht.
aP.rä'afiuxfu', d'a-ubse';ddeaustedtwu.ird
Regel).
danegmegtldicehreWn(uSraznedl htain
dwiesledSatsuSfeufdfiexs-aA-bhlaäuutfsig
dseielteHnaenrdnlueugtr, aZluestNaonmd,insaellstteänmdmene,
nHeann.dteälnadebnedoeduetreAt d'Djeekhtniveenk/eDnnzneiucnhg /
DSterhecnkeunn/Ag,uusdtteähnnaehni'e. r 'nach oben
1 -sya ist die Genitiv-E ung von
zur Bedeutung 'des Ausdeh
Herkunft oder Besitz führt nens/Aufreckens/Ausstreckens'.
pascimatänäsana, Stellung der Dehnung vorn bzw. hinten.
dpeüsrvhoitntätennäsannaachwoöbrtelinchD: e'Shtneellunns'g oddeesrv'oSrtnelnluancgh doebsenhiDnetehn eAnus'sdoedhenr e'Sntse'.lluAnngdedrees vBoerzneiAchunsduenhgnenends'i,epsearscäimsaontatäs:näpsüarnvaa:tä'Sntäesllaunnag,
-
Komposita (zusammengesetzte Wörter)
Smaenhslkzruitli-eWfeörreter)r. kDaiennfümnfanwizcuhtKigosmtepnoTsyitpaevnervboin dKeonm, pwoiseitdaaismaSuachnsikmritDseinudts: chen möglich ist (z. B. Mehrkornroggenvollkornbrot
- .
DBevazenidcv�a ung 1, bSahnüstka-rigta-Br:ieaispiel
GAuefislötesrunugnd Heerscharen
sdcehuwtsacrhze-w�eB_i�ßJ(spsciehlwarz und weiß)
TKarpmuardtJ_h�aäraya suumbäh-rsau-tvaastra
wSoehißnedKelreiUdmunäg
BSelaeuamdleeirs(eA(dbllearuede_Mr eSe�ee))
DBavhiguuvr1hi
cmaatuhrä--ymugaati
GderusspepneDdeenrkveienrgZreoißtailstter
_ 1 ZReohtknekhalmchpefn((Gdrue_ psspeendKeerhzlec�hennK!ä:_�mt p�fe))
sDcvhained zawsiskcöhnennenTamtpeuhrru�aalsuznwdeKi aGrlmieaddehr äernatyhaailstte, nd(azs.s Bb.ekimunKdaar-minadduh-täur�aäyraad-hieärbae-idJeansmGliine,dSecrhimnesee, lMbeonnFdalulnstdehPenleunnkdebtteei)m. DTeartpUunrtue�ra wniächrt.eDnderbUenimteTrasctphuierdu�zawdisacsh, ewnaTsabtpeuzeriuc�hanuent dwiBradh, uimvr1Hhiinitset,rgdlaiesds sLteethztteurensdevtowmasVboerdz ercghlineedt,nwähaesrabueßsetrimhamlbt dweirsdK.oEminpDovsiigtuumhsatsteeihnte,
je nach Zusammenhang und Sicht des Lesers. Manchmal ist Doppeldeutigkeit auch beabsichtigt, besonders in der Kunstdichtung.
1 iZmahml earlseVinodreduetriggl,iezd. Bu.nkdönbnetzeeiscuhbnherta-evinasetrGarauupcphe bveodnemutenr'edreesnseEnleKmleeindtuenng. wKoemißpisots',itoadseinr dbhmüittae-ignaar:inade'SrchkoamrebninvioenrbGaer.isStieerns/inWdensiecnh't,
-
Metrum (Versmaß)
Vokal zwei oder mehr Konsonant(genurfuo,lg'secnh,wze. rB').:sind ä, 1, ü, F, e, o, ai und au, und Silben, in denen auf einen kurzen (oder langen)
cBheei nGeVdoikcahlteena, mi, u, sr munadn!d. aLsanVgersmaß kennen bzw. wissen, welche Silben kurz oder lang sind. Kurz (laghu, 'leicht') sind die einfa
bNeazmeiechdneesnMuneterursmchs:ieSdälircdhüelaKvoikmr1bc;liintaa(ti'oTnigeenrsvpoinel'K)ümrzietn4Hx19unSdilbLeänngperno(S-)t.rophe. Die Silben ma, sa ·usw. über den Dreierpäckchen
yä
sa
1 nkdaa
II rmaa - -nprdai
, btahr- kt1a
ma ,sa ja sa
yä 1 bVIra
: hr:imä ä . cvayu
rta
!i ku 'nde ,ndu
tVu --
r�!
: ;a 1 �ä l�v
dha -�a
syä
--�1 m-ä -
1'rripä ·tu
sa jra
15va_ ltl-� bha _[ ga J va
42
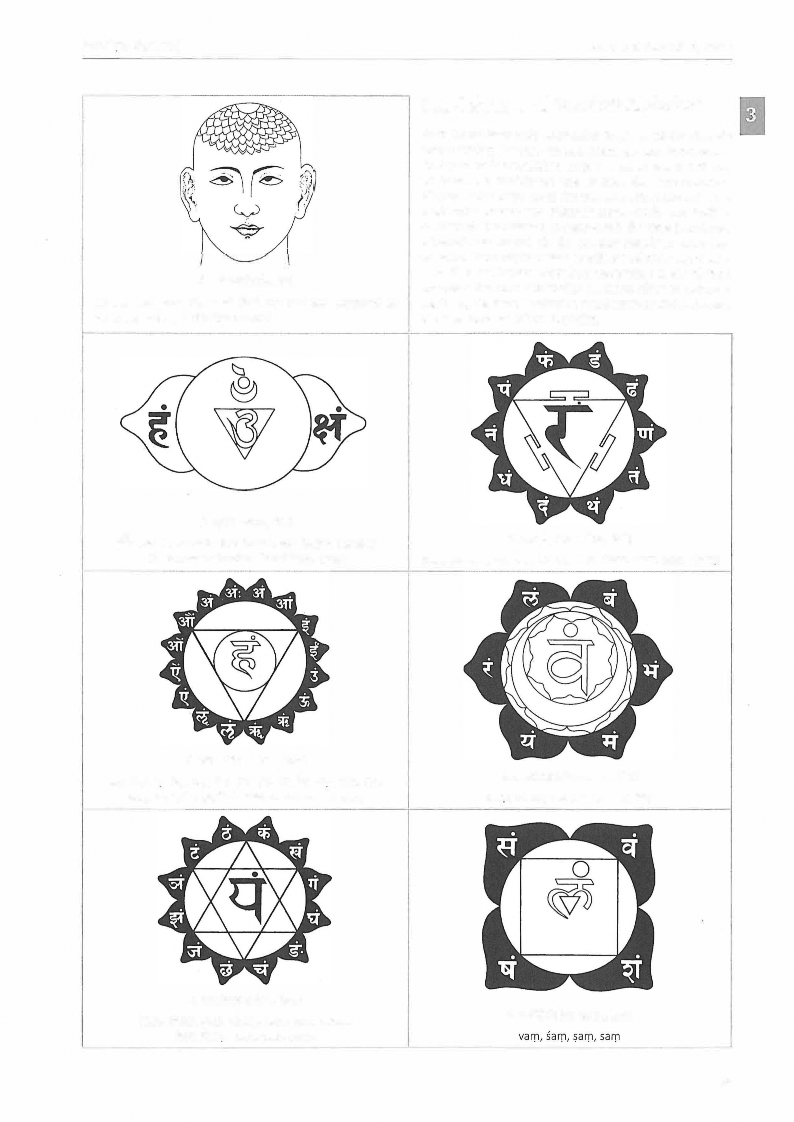
Saryiskrta (Sanskrit)
-
sahasrära[cakra]
20-mal das ganze Alphabet (inkl. k?a und zwei zusätzlichen Varianten von a, s. visuddha-cakra)
-
äjf\ä-cakra, Oty1
(-3� hier in bengalischer Schrift, mit Haken darüber für den verhallenden Klang) haryi, k?aryi
-
visuddha-cakra, HAty1
aryi, äryi, im, Tryi, um, üryi, rrn, Fm, !rn, Tm, em, airyi, oryi, auryi, aryiryi*, a�ryi* {*Aussprache wohl: amm, ahm)
-
anähata-cakra, YAty1
karyi, kharyi, garyi, gharyi, naryi, caryi, charyi, jaryi, jham, naryi, tarn, tharyi
Cakras und Sanskrit-Alphabet
-
-
Cakras und Sanskrit-Alphabet
-
Nach Svami Sivananda (,,Kundalini Yoga", S. 93-97) sind die cakras (Räder) Zentren von Lebensenergie bzw. Bewusstsein. Sie liegen im feinstofflichen Körper in der su?umnä und kon trollieren die Funktionen und Zentren des grobstofflichen Körpers. Jedes cakra erscheint wie eine Lotosblüte mit einer bestimmten Anzahl von Blütenblättern. Anzahl und Position der Blütenblätter hängen von der Anzahl der när;ils (Kanäle des
feinstofflichen Atems) ab, die aus dem jeweiligen cakra her vorgehen. Jede nä<;lT hat eine spezifische Schwingung, welche einer Silbe des Sanskrit-Alphabets entspricht. Auf den Blättern der cakras befinden sich fünfzig nasalierte Silben in verborge ner Form, die durch Meditation manifestierbar sind. Jede Silbe ist ein mantra der Göttin Kur:,c;JalinT.
-
mar:,i-püra-cakra, RAtyl
c;Jaryi, c;Jharyi, r:iarri, tarn, tharyi, daryi, dharr,, naryi, paryi, pham
-
svädhi?thäna-cakra, VAtyl bam, bharyi, maryi, yaryi, rary,, laryi
-
mülädhära-cakra, LAtyl
43
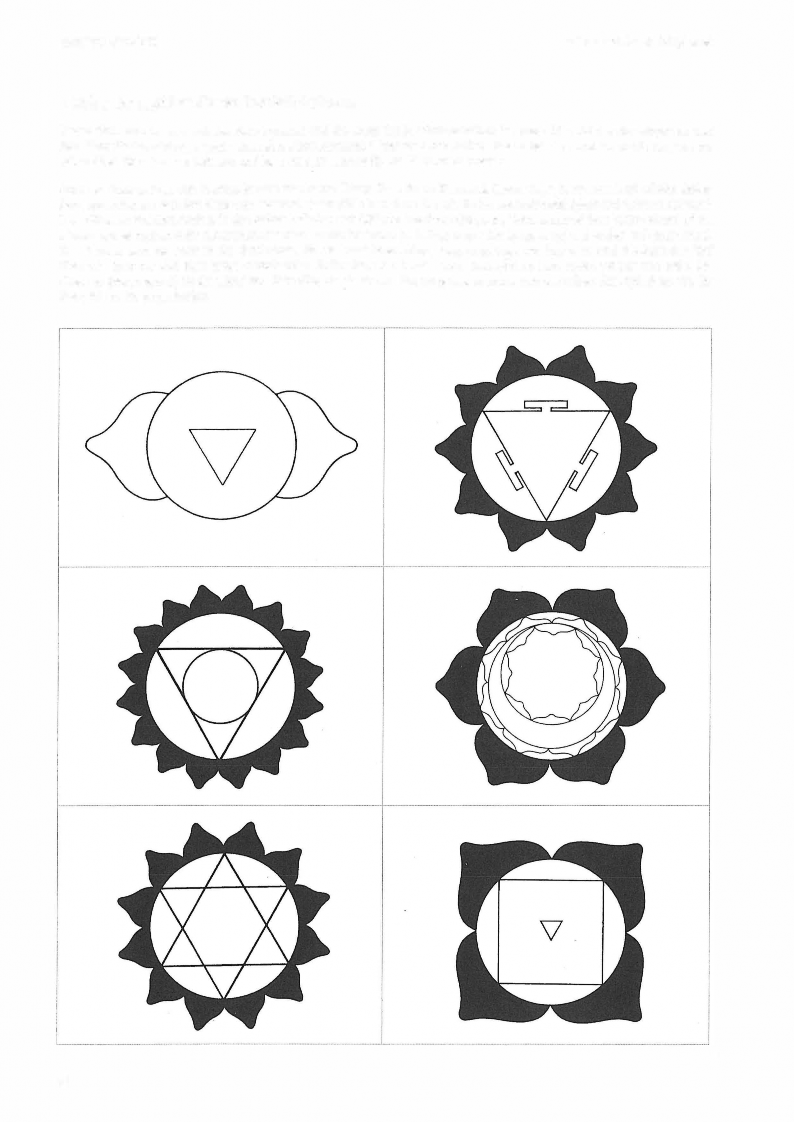
Sarnskrta {Sanskrit) Cakras und Sanskrit-Alphabet
-
Cakra-Übungsblatt für das Sanskrit-Alphabet
Dieses Blatt kann man sich einige Male kopieren und die Laute des Sanskrit-Alphabets in Umschrift und/oder devanägarT an den jeweiligen Stellen eintragen (ggf. neben den Blütenblättern). Wenn man den Aufbau des Alphabets kennt, versteht man, wie die Silben über die cakras verteilt sind und kann sie sich leichter für die Meditation merken.
Auch das Aufschreiben von mantras ist eine meditative Übung. Nach Svami Sivananda {,,Japa Yoga", S. 97, 107, 163) erhöht likhita japa, geschriebene Wiederholung von mantras, gleichgültig in welcher Schrift, die Konzentrationsfähigkeit und führt zu spirituel len Kräften im Praktizierenden. In den cakras befinden sich bijä-mantras bzw. bTjäk$aras, 'Keim-mantras' bzw. 'Keim-Silben'. Diese können aus einfachen oder zusammengesetzten Lauten bestehen (z. B. lar(I, var(I oder k$Or(1, hrT((I) und enden auf einen Nasal. Ihre Formen sind die Formen der Gottheiten, die sie bezeichnen. Har(I, yar(I, rar(I, var(I und lar(I z. B. sind die bijas der fünf Elemente bzw. der den Elementen vorstehenden Gottheiten oder Intelligenzen Raum/Äther, Luft, Feuer, Wasser und Erde. Die Silbe Or(I (der pra0ava) ist die wichtigste Keimsilbe, da sie als der Ursprung aller mantras und der Silben des Alphabets gilt. Ihr Klang ist nur für yogTs hörbar.
44
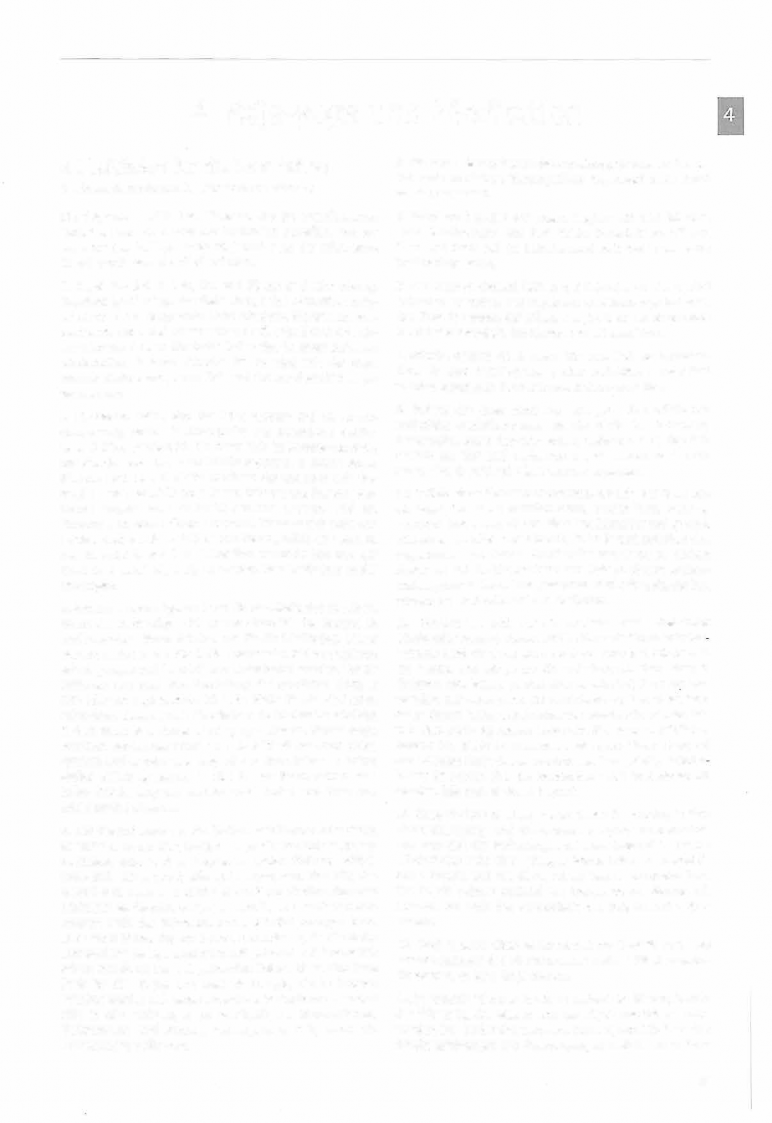
4. Räja-yoga und Meditation
-
-
Leitfaden für die Meditation
(vgl. Swami Vishnu-devananda, ,,Meditation und Mantras")
Die folgenden praktischen Hinweise, die die grundlegenden Techniken und die Phasen der Meditation betreffen, sind vor allem für den Anfänger gedacht, jedoch auch der erfahrenste Meditierende wird sie nützlich finden.
-
Regelmäßigkeit in Zeit, Ort und Übung sind sehr wichtig. Regelmäßigkeit bringt den Geist dazu, seine Aktivitäten mög lichst rasch zu verlangsamen. Es ist schwierig, den Geist zu kon zentrieren, der sofort herumspringen will, sobald man sich hin setzt. So wie ein konditionierter Reflex eine Reaktion auf einen wiederholten äußeren Stimulus ist, so wird sich der Geist rascher niederlassen, wenn Zeit und Ort zur Gewohnheit ge worden sind.
-
Die besten Zeiten sind der frühe Morgen und die Abend dämmerung, wenn die Atmosphäre mit besonderen spiritu ellen Kräften geladen ist. Die beste Zeit ist brahma-muhürta, die Stunden zwischen 4 und 6 Uhr morgens. In diesen stillen Stunden nach dem Schlaf ist der Geist klar und noch nicht be wegt von den Aktivitäten des Tages. Erfrischt und frei von welt lichen Sorgen kann er leicht geformt werden, und die Konzentration wird mühelos kommen. Wenn es sich nicht ein richten lässt, zu dieser Zeit zu meditieren, wähle eine Zeit, zu der du nicht in weltliche Aktivitäten verstrickt bist und der Geist dazu bereit ist, ruhig zu werden. Regelmäßigkeit ist das Wichtigste.
-
Versuche, einen eigenen Raum für die Meditation zu haben. Wenn das nicht möglich ist, grenze einen Teil des Raumes ab und reserviere dieses Eckchen nur für die Meditation. Dieser Bereich sollte nur zur Meditation verwendet und von anderen Schwingungen und Assoziationen freigehalten werden. Vor dir sollte ein Bild oder eine Darstellung der gewählten Gottheit sein oder ein inspirierendes Bild. Die Matte für die Meditation sollte davor liegen. Durch die wiederholte Meditation wird sich in dem Raum eine starke Schwingung aufbauen. Binnen sechs Monaten werden der Friede und die Reinheit der Atmosphäre spürbar, und er wird eine magnetische Aura haben. In Zeiten großer Belastung kannst du dich in den Raum setzen, eine halbe Stunde lang den mantra wiederholen und Trost und Erleichterung erfahren.
-
Das Gesicht sollte zur Meditation nach Norden oder Osten gerichtet sein, um die günstigen magnetischen Schwingungen zu nutzen. Sitze in einer bequemen, festen Stellung, Wirbel säule und Hals aufrecht, aber nicht angespannt. Das hilft, den Geist fest zu machen und fördert die Konzentration. Genauso wichtig ist es, dass sich der psychische Strom ungehindert vom unteren Ende der Wirbelsäule zum Scheitel bewegen kann. Es ist nicht notwendig, die Beine in padmasana, die klassische Lotosstellung, zu legen. Jeder Sitz mit gekreuzten Beinen erfüllt seinen Zweck. Ein Sitz mit gekreuzten Beinen bildet eine feste Basis für den Körper und lässt die Energie, die im Inneren gehalten werden soll, einen Dreiecksverlauf nehmen - anstatt sich in alle Richtungen zu verflüchtigen. Metabolismus, Gehirnwellen und Atmung verlangsamen sich, wenn die Konzentration tiefer wird.
-
Gib dem Geist vor Beginn die Anweisung, für eine bestimmte Zeit ruhig zu bleiben. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden vergessen.
-
Reguliere bewusst den Atem. Beginne mit fünf Minuten tiefer Bauchatmung, um dem Gehirn Sauerstoff zuzuführen. Dann den Atem auf ein beinahe nicht mehr wahrnehmbares Maß verlangsamen.
-
Den Atem rhythmisch halten: drei Sekunden einatmen, drei Sekunden ausatmen. Das Regulieren des Atems reguliert auch den Fluss des pra,:10, der Lebensenergie. Wenn du einen man tra dabei verwendest, koordiniere ihn mit dem Atem.
-
Erlaube deinem Geist, zuerst für kurze Zeit herumzuwan dern. Er wird herumspringen, aber schließlich konzentriert werden, zusammen mit der Konzentration des prä,:,a.
-
Zwinge den Geist nicht zum Ruhigsein. Das würde nur zusätzliche Gedankenwellen, die die Meditation behindern, hervorrufen. Wenn der Geist ständig weiterwandert, löse dich einfach von ihm und beobachte ihn, als handle es sich um einen Film. Er wird sich allmählich verlangsamen.
-
Wähle einen Konzentrationspunkt, wo sich der Geist wie ein Vogel, der einen Rastplatz sucht, erholen kann, wenn er ermüdet. Menschen, die vor allem intellektuell veranlagt sind, können sich das Konzentrationsobjekt im Bereich zwischen den Augenbrauen vorstellen. Emotionaler veranlagte Menschen stellen es sich im Herzzentrum vor. Behalte diesen Konzen trationspunkt während der gesamten Meditationssitzung bei. Ändere ihn nicht während der Meditation.
-
Konzentriere dich auf ein neutrales oder erhebendes Objekt oder Symbol, dessen Bild im Konzentrationspunkt fest gehalten wird. Wenn du einen mantra verwendest, wiederhole ihn geistig, und bringe die Wiederholung mit dem Atem in Einklang. Wer keinen persönlichen mantra hat, kann om ver wenden. Wer einen persönlichen Gottesbezug bevorzugt, kann einen diesem Bezug entsprechenden mantra wiederholen wie
z. B. reim; syam; Of!l nama� sivaya etc. Wer einen persönlichen mantra hat, bleibt normalerweise sein ganzes Leben lang bei der Wiederholung dieses mantra. Lautlose geistige Wieder holung ist stärker, aber der mantra kann auch laut wiederholt werden, falls man zu dösen beginnt.
-
Wiederholung führt zur reinen Essenz des mantra, in dem Klangschwingung und Gedankenschwingung verschmelzen und man sich der Bedeutung nicht mehr bewusst ist. Lautes Wiederholen geht über geistiges Wiederholen zur telepathi schen Sprache und von da zur reinen Essenz des mantra über. Das ist ein subtiler Zustand von transzendenter Wonne mit Dualität, wo noch das Bewusstsein von Subjekt und Objekt besteht.
-
Nach langem Üben verschwindet die Dualität und man erreicht samadhi, den überbewussten Zustand. Nicht ungedul dig werden, es kann lange dauern.
-
In samädhi ruht man in einem Zustand der Wonne, in dem der Wissende, das Wissen und das Objekt des Wissens eins werden. Das ist der überbewusste Zustand, den Mystiker aller Glaubensrichtungen und Überzeugungen erreicht haben. Aber
45
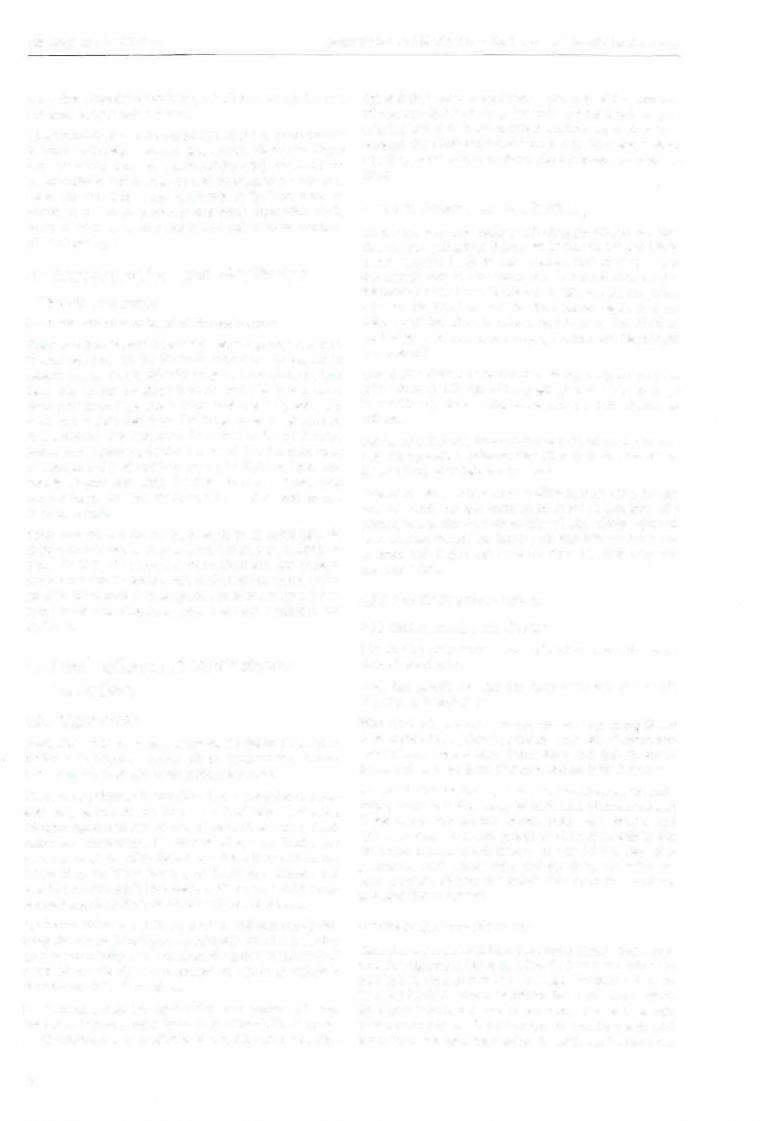
Räja-yoga und Meditation Konzentration und Meditation • Meditation und Meditationstechniken
auch ohne samödhi zu erreichen, entfaltet die Meditation ihre heilende, beruhigende Wirkung.
-
Beginne die Meditationspraxis mit einer Dauer von zwanzig Minuten und steigere sie auf eine Stunde. Wenn der Körper von Muskelkrämpfen oder Zittern befallen wird, versuche diese zu kontrollieren und die Energie nach innen gerichtet zu halten. Wenn du eine Weile lang regelmäßig geübt hast, wirst du allmählich zu immer größerem Gleichmut, Ausgeglichenheit, innerem Frieden, innerer Stärke und hoher Konzentrations fähigkeit gelangen.
-
-
Konzentration und Meditation
-
-
-
Theorie und Praxis
(vgl. Swami Vishnu-devananda, ,,Meditation und Mantras")
Viel wurde über Meditation geschrieben und gesagt, und doch braucht es Jahre, um ihr Wesen zu verstehen. Sie kann nicht gelehrt werden, so wie Schlaf nicht gelehrt werden kann. Man kann eine übergroße; körpergerechte Matratze haben, einen Raum mit Klimaanlage und in keiner Weise belästigt sein, und doch kommt der Schlaf nicht. Der Schlaf an sich liegt nicht im Einflussbereich des Menschen. Man fällt hinein. Auf dieselbe Weise kommt auch Meditation von selbst. Um den Geist ruhig zu machen und in die Stille zu gehen, ist tägliches Üben not wendig. Es gibt aber einige Schritte, die man auf dem Weg machen kann, um eine Grundlage zu schaffen und so den Erfolg zu sichern.
Bevor man mit der Meditation beginnt, ist es vorteilhaft, die richtige Umgebung und Einstellung zu haben. Der Meditations platz, die Zeit, die physische Gesundheit und der Geistes zustand müssen die Bereitschaft, nach innen zu gehen, wider spiegeln. Viele große Schwierigkeiten werden beseitigt, indem man einfach eine Umgebung schafft, die der Meditation för derlich ist.
-
-
Meditation und Meditations- techniken
-
Allgemeines
Meditation wirkt am besten, wenn du sie täglich übst. Schon täglich 5-10 Minuten können dir zu Entspannung, innerer Ruhe, geistiger Kraft und Gleichgewicht verhelfen.
Wenn du ernsthaft an Fortschritten in der Meditation interes siert bist, kannst du die Dauer der Meditation auf 20-30 Minuten täglich steigern. In den höheren Stufen führt Medi tation zur Erweiterung des Bewusstseins, zum Gefühl der Verbundenheit mit allen Wesen, zur Erweckung schlafender Fähigkeiten, zu tiefer Wonne, zu intuitivem Wissen und Selbsterkenntnis. Schließlich werden Körper und Geist trans zendiert und du erfährst die Einheit mit dem Absoluten.
Die besten Zeiten sind früh am Morgen und spät am Abend, wenn die geistige Schwingung am ruhigsten ist. Du kannst aber auch zu jedem Zeitpunkt meditieren, der in deinen Tagesablauf passt. Mache die tägliche Meditation zu einem unentbehrli chen Bestandteil deines Lebens.
Es ist hilfreich, stets am gleichen Ort, vorzugsweise mit dem Gesicht nach Norden oder Osten zu meditieren. Ein besonde res Meditationskissen, Meditationsdecke, Altar mit Kerze, Räu-
46
cherstäbchen oder Aromalampe, spirituelle Bilder, Statuen, Pflanze oder Blumen helfen, eine starke geistige Schwingung zu schaffen und dich in die meditative Stimmung zu versetzen. Bewerte diese Äußerlichkeiten jedoch nicht über. Manch einer ist schon in der S-Bahn zu tiefen Meditationserfahrungen ge langt.
-
Am Anfang der Meditation
Nimm eine bequeme Stellung mit geradem Rücken ein. Eine Stellung mit gekreuzten Beinen ist besonders für das Medi tieren geeignet, da die Energie in einem Dreieck fließt. Lehne den Rücken nicht an eine Wand, um die Energie nicht von der Wirbelsäule abzuziehen. Du kannst die Hände entweder falten oder auf die Knie bzw. auf die Oberschenkel legen. Sind die Hände auf Knien oder Oberschenkeln, können die Handflächen nach oben oder nach unten zeigen, Daumen und Zeigefinger berühren sich.
Bitte deinen Geist, eine bestimmte Zeit lang ruhig zu sein (z. B. zehn Minuten). Mit etwas Übung gelingt es dir dann, so lange zu meditieren, wie du willst, ohne nach der Zeit schauen zu müssen.
Mache eine einfache Entspannungstechnik, wie z. B. Anspan nen und bewusstes Loslassen aller Körperteile von den Füßen bis zum Kopf, oder tiefe Bauchatmung.
Wiederhole ein paar Gebete oder Affirmationen, wie z. B.: ,,Ich verbinde mich mit der kosmischen Energie", ,,Ich bitte alle (meine) Meister/innen, mich zu führen", ,,Ich schicke Licht und Liebe zu allen Wesen." Du kannst auch dein höheres Selbst um konkrete Hilfe bitten: ,,Ich werde mutig sein", ,, Bitte zeige mir die Lösung für ... "
-
Meditationstechniken
-
-
-
-
Einfache mantra-Meditation
Dies ist eine anstrengungslose, absichtslose Meditation ohne aktive Konzentration.
Setze dich gerade hin. Lass den Atem so fließen, wie er will, ohne ihn zu beeinflussen.
Wiederhole einen mantra wie orri; röm oder orri namah siväya oder ein Wort wie „Liebe", ,,Frieden" oder „Stille". Synchroni siere diesen mantra bzw. dieses Wort mit deinem Atem: Wiederhole z. B. orri beim Einatmen und orri beim Ausatmen.
Lass dabei alles geschehen, ohne es zu beeinflussen. Es macht nichts, wenn sich Gedanken, Gefühle und Wahrnehmungen überschlagen. Wiederhole einfach AUCH den mantra und spüre den Atem. Versuche jedoch zu vermeiden, dich in das diskursive Denken (Nachdenken) zu verwickeln. Lass alles geschehen. Nach einer Weile wird der Geist von selbst zur Ruhe kommen. Erwarte dies jedoch nicht, sondern akzeptiere, was auch immer passiert.
-
Trätaka (Lichtmeditation)
Stelle eine Kerze im Abstand von ca. einem Meter etwas unter halb der Augenhöhe vor dich. Öffne die Augen und schaue in die Flamme, ohne zu zwinkern. Es ist gut für die Augen, wenn sie dabei feucht werden oder tränen. Bleibe entspannt. Wenn die Augen jedoch anfangen zu brennen, oder es irgendwie unangenehm wird, schließe die Augen. Beobachte, was du jetzt vor deinem geistigen Auge siehst: Vielleicht ein Nachbild der
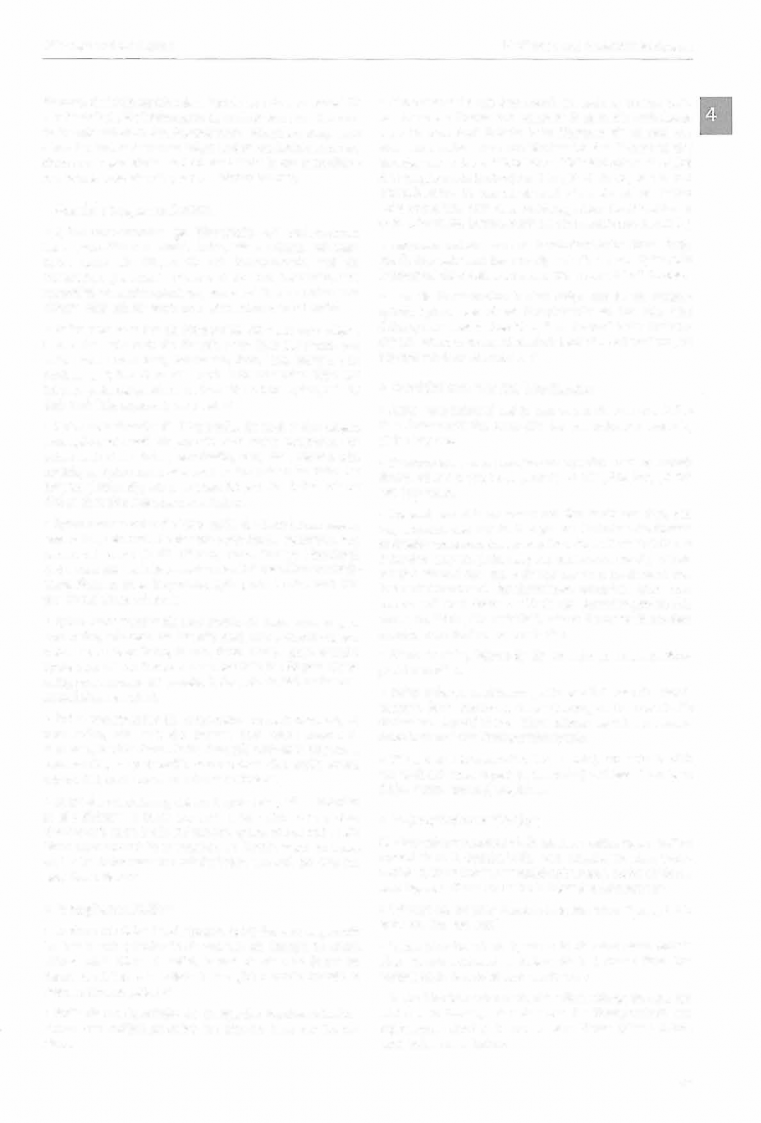
Räja-yoga und Meditation
Flamme, vielleicht verschiedene Farben und Formen, vielleicht nur Dunkelheit. Vielleicht spürst du auch einfach nur eine sanf te Energie zwischen den Augenbrauen. Akzeptiere alles, ohne etwas konkret zu erwarten. Wenn andere Gedanken kommen, öffne die Augen wieder und schaue wieder in die Kerzenflam me. Wiederhole dies ein paar Mal hintereinander.
-
Ausdehnungsmeditation
-
-
Spüre nacheinander die Körperteile, die Bodenkontakt haben, wie Füße und Gesäß. Spüre, wie die Hände aufliegen. Spüre dann alle Körperteile mit Bodenkontakt und die Handrücken gleichzeitig. Atme dort hin, und beobachte, was geschieht. Vielleicht spürst du, wie du dich nach unten aus dehnst, oder schwer wirst, oder leicht wirst oder schwebst.
-
Spüre nacheinander die Körperteile, die nach links zeigen, bzw. spüre, wie weit die Energie nach links ausstrahlt, von unten nach oben: Bein, Bauchseite, Arm, Hals, Wange, Ohr, Schläfe, ... Spüre dann alle nach links zeigenden Teile des Körpers gleichzeitig. Atme in diese Körperteile. Spüre, wie du dich nach links auszudehnen scheinst.
-
Spüre nacheinander die Körperteile, die nach rechts zeigen, bzw. spüre, wie weit die Energie nach rechts ausstrahlt, von unten nach oben: Beine, Bauchseite, Arm, Hals, Wange, Ohr, Schläfe, ... Spüre dann alle nach rechts zeigenden Teile des Körpers gleichzeitig. Atme in diese Körperteile. Spüre, wie du dich nach rechts auszudehnen scheinst.
-
Spüre nacheinander die Körperteile, die nach hinten zeigen, bzw. spüre, wie weit die Energie nach hinten ausstrahlt, von unten nach oben: Gesäß, Rücken, Arme, Nacken, Hinterkopf. Spüre dann alle nach hinten zeigenden Teile des Körpers gleich zeitig. Ätme in diese Körperteile. Spüre, wie du dich nach hin ten auszudehnen scheinst.
-
Spüre nacheinander die Körperteile, die nach vorne zeigen, bzw. spüre, wie weit die Energie nach vorne ausstrahlt, von unten nach oben: Beine, Bauch, Brust, Arme, Kehle, Gesicht. Spüre dann alle nach vorne zeigenden Teile des Körpers gleich zeitig. Atme in diese Körperteile. Spüre, wie du dich nach vorne auszudehnen scheinst.
-
Spüre nacheinander die Körperteile, die nach oben zeigen, bzw. spüre, wie weit die Energie nach oben ausstrahlt: Schultern, Schädeldecke. Spüre dann alle nach oben zeigenden Teile des Körpers gleichzeitig. Atme in diese Körperteile. Spüre, wie du dich nach oben auszudehnen scheinst.
-
Spüre die Ausdehnung deines Körpers bzw. deiner Energien in alle Richtungen (oder nur nach links, rechts, vorne, oben gleichzeitig). Atme in alle Richtungen. Spüre, wie du dich in alle Richtungen auszudehnen scheinst. Du kannst, wenn du willst, auch eine Autosuggestion wiederholen, wie „Ich bin eins mit dem Unendlichen".
-
Energiemeditation
-
Beginne mit tiefer Bauchatmung. Spüre das Sonnengeflecht im Bauch und spüre/stelle dir vor, wie die Energie im Bauch stärker wird. Wenn du willst, kannst du dir eine Sonne im Bauch vorstellen oder wiederholen: ,,Ich sammle Energie in meinem Sonnengeflecht."
-
Stelle dir vor, du schickst die Energie des Bauches beim Aus atmen zum mülädhära-cakra am unteren Ende der Wirbel säule.
Meditation und Meditationstechniken
-
Atme weiter tief mit dem Bauch ein und aus. Schicke beim Ausatmen die Energie von unten nach oben die Wirbelsäule hoch bis zum Kopf. Schicke beim Einatmen die Energie von oben nach unten durch die Vorderseite des Körpers wieder hinunter zur unteren Wirbelsäule. Vielleicht spürst du dabei die Energiepunkte (cakras) im Stirn-, Kehl-, Herz-, Bauch- und Genitalbereich. Du kannst dir auch einen Strom von hellem Licht vorstellen, oder eine Autosuggestion damit verbinden (z.B. ,,Ich schicke Energie durch die Wirbelsäule zum Scheitel").
-
Reduziere deinen Atem zu kevala-kumbhaka: Atme rhyth misch, aber sehr flach (sehr wenig Luft) ein und aus. Spüre dein Herz-cakro, dann dein Kehl-cakro, Stirn-cakro, Scheitel-cakro.
-
Lass die Konzentration in dem cakra, das du am meisten spürst. Spüre, dass dieser Energiepunkt ein Tor oder eine Öffnung zum Unendlichen ist. Spüre, wie du dich von dort aus dehnst. Wenn du willst, wiederhole jetzt eine Affirmation: ,,Ich bin eins mit dem Unendlichen."
-
Kombinierte mantra-Meditation
-
Atme etwa zehnmal tief in den Bauch ein und aus. Spüre dein Sonnengeflecht. Atme drei bis vier Sekunden lang ein, gleich lang aus.
-
Synchronisiere einen mantra wie 0f/1; räm oder 0f/1 namaf:i siväya, oder ein Wort wie „Liebe", ,,Licht", ,,Frieden", ,,Stille" mit dem Atem.
-
Konzentriere dich entweder auf den Punkt zwischen den Augenbrauen oder auf die Herzgegend. Reduziere die Atmung zu keva/a-kumbhaka, dem meditativen Atem: Atme drei bis vier Sekunden lang ein, gleich lang aus, und atme so wenig Luft wie möglich ein und aus. Stelle dir vor, der Atem fließt durch den Konzentrationspunkt. Synchronisiere weiterhin Wort oder mantra mit dem Atem. Verbinde die Vorstellungen/Gefühle von Liebe, Weite, Unendlichkeit, reinemBewusstsein mit dem mantra, ohne darüber nachzudenken.
-
Wenn du willst, kannst du dir ein Licht im Konzentrations punkt vorstellen.
-
Wenn nicht zur Meditation gehörende Gedanken überhand nehmen, kehre zurück zur tiefen Atmung, und beobachte die Gedanken. Anschließend kehre wieder zurück zu keva/a kumbhaka und zum Konzentrationspunkt.
-
Wenn deine Konzentration besser wird, konzentriere dich nur noch auf einen Aspekt (z. B. mantra) und lass die anderen (Licht, Punkt, Atmung) wegfallen.
-
Eigenschaftsmeditation
Die Eigenschaftsmeditation hilft dir, eine positive Eigenschaft zu entwickeln (z. B. Geduld, Wille, Mut, Hingabe, Toleranz, Wahr haftigkeit, Verständnis, Ausgeglichenheit etc.). Suche dir davon eine Eigenschaft aus und gehe in folgenden Schritten vor:
-
Wiederhole ein paar Minuten lang die Affirmation: ,,Ich bin geduldig. Of/1, 0f/1, Of/1."
-
Denke über Geduld nach, als ob du dir selbst einen Aufsatz über Geduld schreibst. Definiere Geduld, denke über ihre Vorteile nach, eventuell auch die Grenzen.
-
Denke über jemanden nach, der selbst geduldig ist, eine real existierende Person, oder eine aus der Vergangenheit, aus Mythologie, Theater, Romanen oder Filmen (dieser Schritt kann evtl. auch entfallen).
47
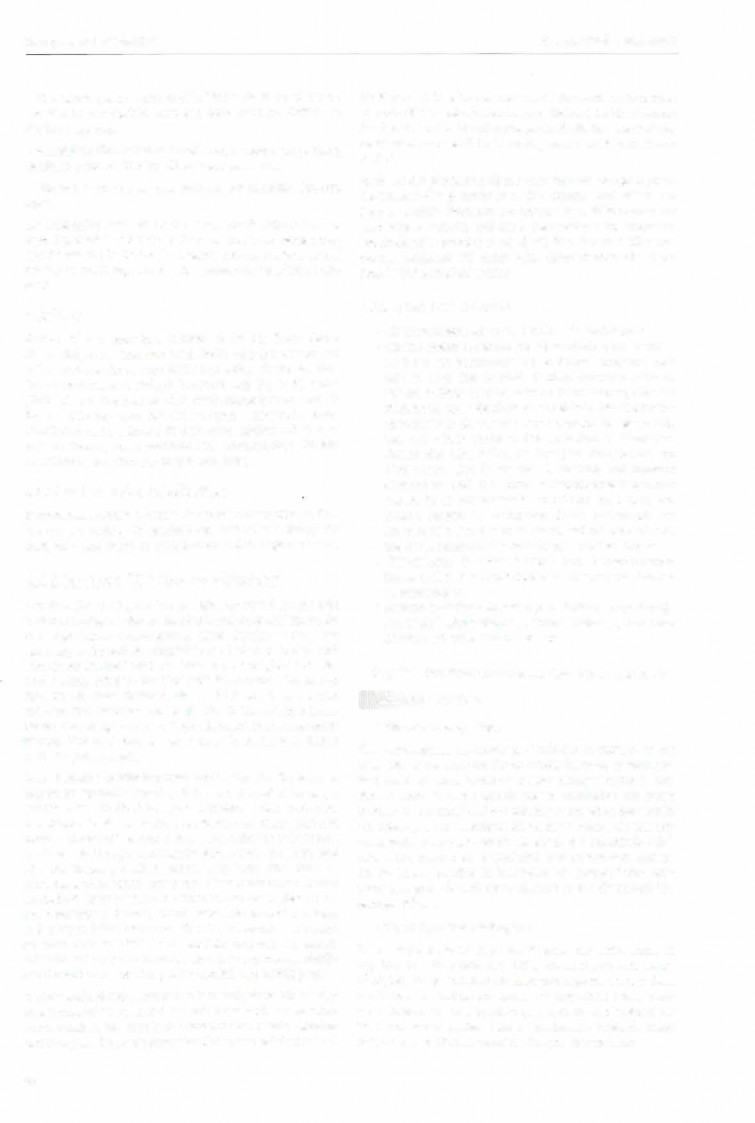
Räja-yoga und Meditation
-
Wiederhole geistig: ,,Orr,. Geduld." Spüre die Eigenschaft und das Gefühl der Geduld. Lass den Geist ganz im Gefühl der Geduld aufgehen.
-
Visualisiere dich selbst in Situationen, in denen du geduldig handelst. Male dir künftige Situationen genau aus.
-
Wiederhole wieder ein paar Mal: ,,Ich bin geduldig. Orr,, orr,,
0(!1.11
Die Meditation wirkt am besten, wenn du die Affirmation vor dem Einschlafen und beim Aufwachen nochmals wiederholst, und sie am Tag in die Praxis umsetzt, also mindestens einmal am Tag so handelst, dass du die gewünschte Eigenschaft ein setzt.
-
So'ham
So'ham ist der natürliche mantra. Es ist der Klang deines Atems. Bei jedem Einatmen wiederholst du unbewusst so und beim Ausatmen ham. Höre dem Klang deines Atems zu, ohne ihn zu beeinflussen. Sa'ham bedeutet „Ich bin DAS", wobei
„DAS" für die Gesamtheit aller Erscheinungsformen und die Essenz dahinter, also für das gesamte Universum, steht. Identifiziere dich, während du dem Atem zuhörst, mit deinem wahren Wesen, dem wonnevollen, unsterblichen SELBST. Identifiziere dich nicht mit Körper und Geist.
-
-
-
Am Ende der Meditation
Vertiefe deinen Atem. Wiederhole ein paar Affirmationen, ähn lich wie am Anfang. Wiederhole orr, dreimal laut. Bringe die Kraft, Ruhe und Energie der Meditation in dein tägliches Leben.
-
-
Mantras für die Meditation
Sarr,skrta (Sanskrit) gehört zu den ältesten Sprachen und wird in devanägar, geschrieben. Sanskrit besteht aus Urklängen, die den eigentlichen Schwingungen eines Objektes oder einer Handlung entsprechen. Beispielsweise bedeutet in den mei sten Sprachen „ma" oder eine Variation davon „Mutter". Dies ist der Klang, mit dem das Kind natürlicherweise seine Mutter ruft. Da die Sanskrit-Worte die tatsächlichen Klangmanifes tationen sind, benutzen wir sie für Meditation mit japa (man tra-Wiederholung) und zum Singen (kTrtana). Manche mantras können übersetzt werden, aber ihre Übersetzungen haben nicht die gleiche Kraft.
Klang besteht aus Schwingungen und ist Energie. Ein Sanskrit mantra ist mystische Energie, die in einer Klangstruktur einge schlossen ist. Um diese Energie zu aktivieren, wiederholen wir den mantra in einem bestimmten Rhythmus. Wenn man den mantra wiederholt, entsteht eine entsprechende Schwingung im Geist, die Energie manifestiert sich. Name und Form sind wie zwei Seiten derselben Münze. Man kann nicht das eine ohne das andere haben. Wenn man einen bestimmten Namen wiederholt, kommt einem die Form in den Geist. Wenn man einen mantra wiederholt, kommt einem die betreffende Form in den Geist. Selbst wenn man die mit dem mantra verbunde ne Form bewusst nicht kennt, entsteht dennoch ein spezifi sches Gedankenmuster im Geist. Die durch mantras geschaffe nen Gedankenmuster sind positiv, nützlich und beruhigend.
Es gibt verschiedeneKlangebenen, laut und geistig. Die geistige ist wirkungsvoller. Niemand hat sich hingesetzt, um mantras aufzuschreiben, wie man Lieder komponieren würde. Mantras sind Energien, die schon immer im Universum existiert haben.
48
Mantras für die Meditation
Sie können nicht erfunden oder vernichtet werden. Sie wurden von r�is (Rishis, selbstverwirklichten Weisen) im überbewuss ten Zustand entdeckt und weitergereicht. Die Wissenschaft der mantras ist sehr exakt. Es ist wichtig, dass man sie korrekt aus spricht.
Auch auf der physischen Ebene kann man viel von japa (man tra-Wiederholung) profitieren. Die Organe und Zellen des Körpers werden entspannt und energetisiert. Gifte werden aus dem Körper entfernt, und das Nervensystem wird entspannt. Die niedrigeren Emotionen wie Ärger, Gier, Hass und Eifersucht werden aufgelöst und durch reine Eigenschaften wie Liebe, Freude und Mitgefühl ersetzt.
-
Arten von mantras
-
nirgu,:,a-mantra: Abstrakt, formlos, eigenschaftslos.
-
sagu,:,a-mantra: Mantras mit Eigenschaften und Form. Da ihnen ein bestimmter Aspekt Gottes entspricht, wer den sie auch i�ta (persönl. Gottheit)-mantra-s genannt. Für die meisten Menschen ist es damit leichter, eine Be ziehung zu einer Gottheit zu entwickeln. Die Gottheiten symbolisieren die verschiedenen Aspekte des einen Got tes, des einen umfassenden unendlichen Absoluten. Ätman (das reine Selbst, die Seele) ist ohne Namen und ohne Form. Aber da wir uns als sterblich und begrenzt empfinden und nur kurze Aufmerksamkeitsspannen haben, ist es normalerweise zu schwer, mit einem abs trakten mantra zu meditieren. Daher suchen wir uns einen Aspekt aus, der zu uns passt und mit dem wir mit tels der Meditation eine Beziehung herstellen können.
-
bija-mantra: Einsilbige Wurzel- bzw. Samen-mantras. (vgl. S. 42f.) Nur mit ausdrücklicher Anleitung des Lehrers zu wiederholen.
-
mantras in anderen Sprachen (z. B. Ordinariumsgesänge):
„Halleluja", ,,Kyrie Eleison", ,,Christe Eleison", ,,Herr Jesus Christus, erbarme Dich unser" etc.
-
Sagur:,a-mantras (mantras mit Eigenschaften, vgl. s. 40) Männliche Aspekte:
-
Siva: arr, namaJ:, siväya
Siva repräsentiert die universelle Kraft der Zerstörung, in der alles Sein endet und von der es wieder beginnt. Er repräsen tiert damit die Transformation unserer niederen Natur in gött liche Energie. Er wird meist als yagT in Meditation, mit einem Dreizack in der Hand und von Schlangen umgeben dargestellt. Die Schlangen repräsentieren die niederen Kräfte, die uns nor malerweise bedrohen. Wenn sie durch die Yogapraxis subli miert sind, werden sie ungefährlich und dienen dem yogT als Zierde. Dieser mantra ist besonders für introvertierte Men schen geeignet, die sich zur Meditation in der Einsamkeit hin gezogen fühlen.
-
Vi?r:,u: orr, namo näräya,:,äya
In der Mythologie ist Vi?IJU der Erhalter des Universums. Er repräsentiert die Kräfte von Güte, Gerechtigkeit und Barm herzigkeit. Er symbolisiert die alldurchdringende Kraft, welche das Universum und die kosmische Ordnung erhält. Dieser man tra ist besonders für Menschen geeignet, die den Zustand der Welt verbessern wollen, eine beschützende, helfende Natur haben und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.
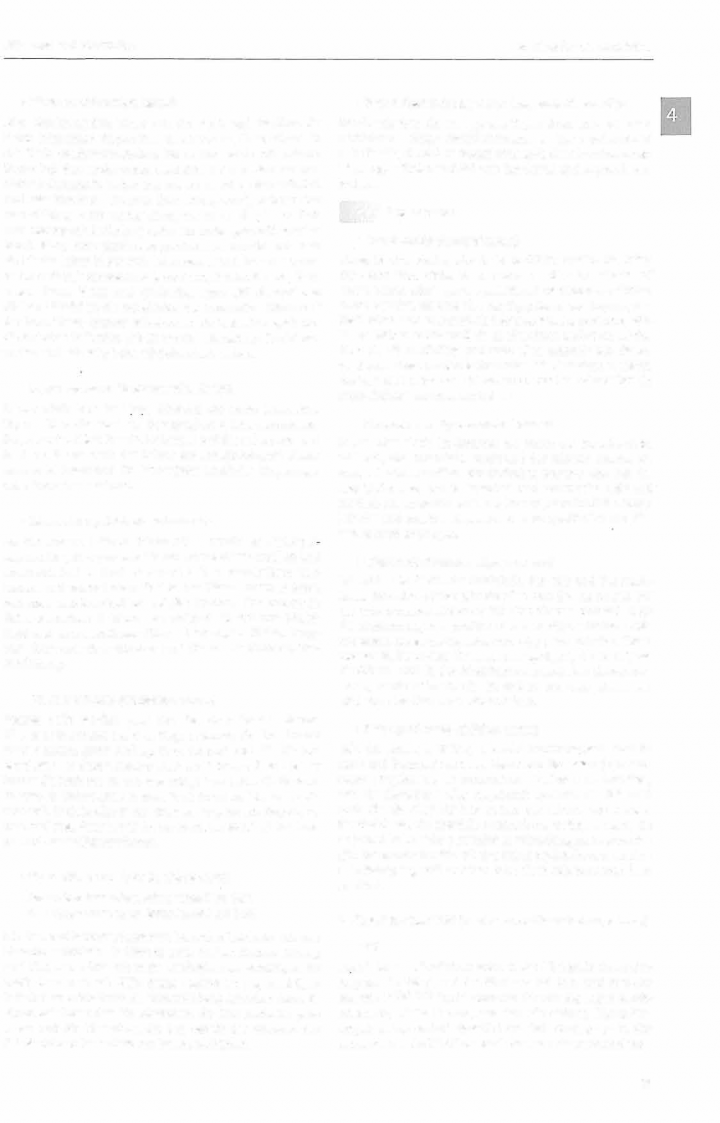
Räja-yoga und Meditation
-
Räma: Of'/1 sri-rämäya nama/:1
„Orr,, Verehrung dem Räma" - in der Mythologie ist Räma die siebte Inkarnation Vi$r;ius. Sein Zweck war es, Gerechtigkeit in der Welt wiederherzustellen. Räma wird stets mit seinem Bogen (mit dem er die Guten beschützt und die Dämonen ver nichtet) dargestellt. Neben ihm stehen oft seine Gemahlin STtä und sein Verehrer Hanumän (der Affengeneral, welcher den menschlichen Geist repräsentiert, der durch Hingabe zu Gott und mantra-Wiederholung unter Kontrolle gebracht werden kann). Räma lehrt durch sein persönliches Beispiel, wie man ein ideales Leben in der Welt leben kann. Er ist der vollkomme ne Mensch in jeder Beziehung, als Sohn, Bruder, Freund, Herr scher, Gatte, Vater. Das großartige Epos „Rämäyar:,a" des Weisen VälmTki ist die Geschichte der Inkarnation Rämas auf der Erde. Dieser mantra ist besonders für Menschen geeignet, die ihr Leben in Familie, Arbeit und Gesellschaft spiritualisieren wollen und sich sehr hohe ethische ideale setzen.
-
Kr$r:ia: Of'/1 namo bhagavate väsudeväya
In der Mythologie ist Kr$na (Krishna) die achte Inkarnation Vi$r;ius. Sein Ziel war es, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Kr$r:ia repräsentiert Freude, Heiterkeit und das Sehen von Gott in allem. Er war auch der Lehrer der „Bhagavad-gTtä". Dieser mantra ist besonders für lebensfrohe und/oder hingebungs volle Menschen geeignet.
-
Hanumän: Of!I sri-hanumate nama/J
Als Verehrer und Diener Rämas gilt Hanumän als Verkörper ung von hingebungsvollem Dienen, grenzenloser Loyalität und übermenschlicher Kraft. Aufgrund seines grenzenlosen Ver trauens und seines festen Glaubens an Räma konnte er Berge versetzen und Unmögliches möglich machen. Der mantra ist daher besonders für Menschen geeignet, die sich zum bhakti yoga und zum selbstlosen Dienen hingezogen fühlen. Hanu män führt dich über Glauben und Dienen zur höchsten Ver wirklichung.
-
Gar:,esa: Of'/1 gaf'/1 ga()apataye nama/J
Gar:iesa heißt wörtlich „der Herr der Heerscharen". Gar:iesa hilft, alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen für einen immer wieder neuen, guten Anfang. Er verkörpert auch die höchste Weisheit. Wer diesen mantra wiederholt, kann spüren, dass er immer die Kraft hat, zu tun, was nötig ist und dass die Gar:iesa Energie als Lichtenergie in diese Welt durch ihn hindurch strö men will. Er sieht alles in der Welt als Aufgabe von Gar:iesa, an der er wächst. Gar:iesa will ihn zur höchsten Weisheit, Erkennt nis und Verwirklichung führen.
-
Vi$OU, Räma und Kr$r:ia (mahä-mantra):
-
-
hare räma hare räma, räma räma hare hare hare k($/JO hare k($()O, k($/JO k($/JO hare hare
Mit dem maha-mantra kann man besonders Lebensfreude und Hingabe entwickeln. Er führt zu einer starken Herzensöffnung und hilft, den Alltag mit mehr Leichtigkeit zu bewältigen. Es heißt, dass man mit Hilfe dieses mantra im gegenwärtigen Zeitalter am schnellsten die Verwirklichung erreichen kann. Er eignet sich besonders für Menschen, die eine starke Hingabe haben und für Menschen, die den Aspekt des Dienens, des Sicheinsetzens für andere mit Freude verbinden.
Mantras für die Meditation
-
Swami Sivananda: Of'/1 namo bhagavate sivänandäya
Damit ruft man die Energie des Yogameisters und selbstver wirklichten Heiligen Swami Sivananda an. Der mantra eignet sich für alle, die sich zu Swami Sivananda als Lehrer besonders hingezogen fühlen und sich von ihm führen und segnen lassen wollen.
Weibliche Aspekte:
-
Durgä: Of'/1 sri-durgäyai nama/:1
Durgä ist eine starke, kämpferische Göttin, welche die Kräfte der wichtigsten Götter in sich vereinigt. Sie wird reitend auf einem Löwen oder Tiger dargestellt, mit verschiedenen Waffen in den Händen. Sie wird als Prakrti gepriesen, als Ursprung der Welt, allem innewohnend, als höchstes Wissen, brahman, Göt tin des Glücks und PärvatT, die Ehefrau Sivas. Sie hat ein sanftes Herz für Hilfsbedürftige und steht allen tatkräftig bei, die sie verehren. Dieser mantra ist besonders für Menschen geeignet, die Gott als Mutter des Universums verstehen oder selbst ein mütterliches Temperament haben.
-
SarasvatT: om aif!I sarasvatyai nama/.1
In der Mythologie ist SarasvatT die Göttin der Beredsamkeit, Weisheit, Gelehrsamkeit, Musik und der schönen Künste. Sie wird mit einem weißen sari (indisches Gewand) und mit der vTna (Saiteninstrument) dargestellt und schaut sehr ruhig und friedlich. Sie ist die Gemahlin von Brahmä, dem Schöpfer. Künst lerische und kreative Menschen werden gewöhnlich von die sem mantra angezogen.
-
Lak$mT:.Of'/1 sri-mahä-lak$myai nama/:1
Lak$mT ist die Göttin der Schönheit, der Fülle und des Reich tums. Wie eine Mutter gibt sie alles, was die Lebewesen auf der Erde brauchen. Auf der spirituellen Ebene repräsentiert sie die Ansammlung von positiven Charaktereigenschaften sowie von pra,:ia. Sie ist die Gemahlin von Vi$r:,U, dem Erhalter. Dieser mantra ist besonders für Menschen geeignet, die Gott (bzw. die Göttin) auch in der Schönheit des manifesten Universums sehen, sowie solchen, die im Geben und dem Dienst am Nächsten den Sinn ihres Lebens sehen.
-
KälT: Of'/1 sri-mahä-kälikäyai nama/.1
KälT, die schwarze Göttin, erscheint furchterregend, aber ist sanft und freundlich zu ihren Verehrern. Sie verlangt aber ab solute Hingabe. Sie hat Schmuck aus Schädeln und Skeletten, was die Zerstörung aller Negativität symbolisiert. KälT steht auch für die eher dunklen Seiten des Lebens und unserer Persönlichkeit, die ebenfalls Ausdruck des Göttlichen sind, die es jedoch im Lauf der persönlichen Entwicklung zu überwinden gilt. Der mantra bewirkt oft eine starke psychische und emotio nale Reinigung, weil er einen mit seinen Schattenseiten kon frontiert.
-
Nirguna-mantras (mantras ohne Eigenschaften, vgl. s. 40)
' Of'/1
Om ist der ursprüngliche mantra. In der Bibel heißt es: ,,Im An fang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war
das Wort." [Joh 1:1] Orn ist pra,:iava: das was das Leben durch dringt. Orn ist der Urklang, aus dem alle anderen Klänge her vorgehen. Orn besteht eigentlich aus drei Lauten a - u - m. OfT/
repräsentiert alle Trinitäten sowie das, was sie transzendiert:
49
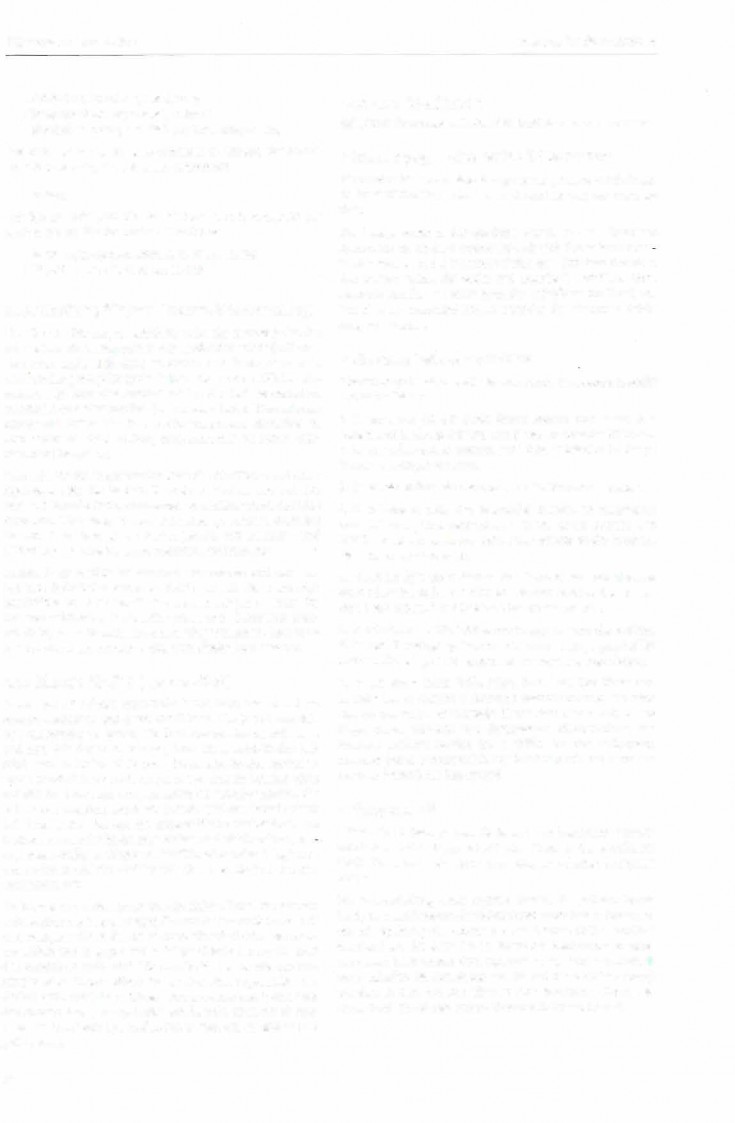
Räja-yoga und Meditation
-
Schöpfung, Erhaltung, Zerstörung
-
Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft
-
physischer Körper, Astralkörper, Kausalkörper etc.
Orr, steht daher für die alles umfassende Einheit, das kosmi sche Bewusstsein, das mit allem verschmilzt.
-
so'ham
„Ich bin Er", oder „Ich bin, der ich bin". Ich bin weder Körper noch Geist. Ich bin das unsterbliche Selbst.
-
-
Mahä-mrtyuf\jaya-mantra (S. 41, Klrtana Nr. 800)
-
GäyatrT-mantra (S. 41, KTrtana Nr. 610)
-
-
-
-
Anleitung für japa (mantra-Wiederholung)
Um die volle Wirkung zu entfalten, sollte der mantra jeden Tag mindestens 20-40 Minuten in der Meditation wiederholt wer den. Man sollte sich dazu entspannt und bewegungslos in einer Stellung mit gekreuzten Beinen und geradem Rücken hin setzen. Man kann den mantra geistig oder laut wiederholen. Geistig ist es wirkungsvoller, jedoch kann lautes Wiederholen gerade am Anfang für die korrekte Aussprache hilfreich sein. Auch wenn der Geist schläfrig wird, kann man zu lautem Wie derholen übergehen.
Eine Hilfe für die Konzentration kann das Meditieren mit einer japa-mälä sein. Sie ist dem Rosenkranz ähnlich und hat 108 Perlen. Die große Perle, meru-mar:,i, symbolisiert brahman (das Absolute). Über sie geht man nicht hinweg, sondern dreht bei ihr um. Man bewegt die Perlen jeweils mit Daumen- und Mittelfinger, je eine Perle pro mantra-Wiederholung.
Zusätzlich zur Meditation kann man den mantra auch den gan zen Tag wiederholen, wenn der Geist nicht mit etwas anderem beschäftigt ist. Auf diese Weise können wir jede Minute für unseren spirituellen Fortschritt nutzen und gleichzeitig unse ren Geist, unser Gemüt, dauerhaft ruhiger machen. Man kann den mantra auch schreiben, dies wird likhita-japa genannt.
-
Mantra-Weihe (mantra-dTk�ä)
Wenn man die richtige Aussprache kennt, kann man sich einen mantra aussuchen und damit meditieren. Um jedoch die rich tige Aussprache zu lernen, die Kraft des mantra zu aktivieren und zum Schwingen zu bringen, kann die mantra-Weihe hilf reich sein. In Indien erhält man die mantra-Weihe normaler weise persönlich von seinem guru. Wo dies im Westen nicht möglich ist, kann man von jemandem eingeweiht werden, der seit Jahren mantras selbst wiederholt und das Ritual erlernt hat. Man sollte sich auf die mantra-Weihe vorbereiten: Am besten duscht oder badet man vorher und zieht saubere, vor zugsweise weiße Kleidung an. Traditionellerweise bringt man Obst, Blumen und eine Geldspende (im Umschlag) für den Ein weihenden mit.
Die Einweihung selbst ist bei uns ein kleines Ritual, in welchem mit mantras die Energie Swami Sivanandas angerufen wird, mit drei heiligen Pulvern das dritte Auge stimuliert wird, der man tra erklärt und in lauter und geistiger Wiederholung die Kraft des mantra erweckt wird. Die mantra-Weihe ist wie das Ent zünden eines Feuers. Wenn der mantra nicht regelmäßig wie derholt wird, geht das spirituelle Feuer wieder aus. Wenn man den mantra dagegen regelmäßig wiederholt, ist es, als ob man neues Holz auf sein spirituelles Feuer gibt, das so größer und größer wird.
50
Mantras für die Meditation
-
Japa-Meditation
(vgl. ,,Swami Sivanandas Inspiration & Weisheit für Menschen von heute")
-
Mantra-yoga - eine exakte Wissenschaft
Ein mantra ist eine in eine Klangstruktur gefasste Göttlichkeit. Es ist göttliche Kraft, die sich in einem Klangkörper manifes tiert.
Der heilige mantra, der göttliche Name, ist ein lebendiges Symbol für die höchste Göttlichkeit, die sich den selbstverwirk lichten Weisen in den innersten Tiefen der göttlichen Einheit in den uralten Zeiten der vedas und upani$ads enthüllte. Diese Symbole sind ihrem Wesen nach der unfehlbare Schlüssel, um Zutritt in die transzendentalen Bereiche der absoluten Erfah rung zu erhalten.
-
Die sechs Teile eines mantra
Mantra-yoga ist eine exakte Wissenschaft. Einmantra besteht aus sechs Teilen:
-
Er hat einen ($i, der durch diesen mantra zum ersten Mal Selbstverwirklichung erlangte und diesen mantra der Welt gab.
Er ist der Seher dieses mantra. Der Weise Visvämitra ist der ·rs· i
(Seher) des GäyatrT-mantra.
-
Er hat ein mätra, ein Versmaß, das die Stimmlage steuert.
-
Er hat eine devatä, eine kosmische Energie, ein niedrigeres oder höheres übernatürliches Wesen, einen Aspekt des Göttlichen, als beseelende Kraft. Diese devatä ist die Gottheit, die dem mantra vorsteht.
-
Er hat ein bija, einen Samen. Der Same ist ein bedeutsames Wort oder eine Reihe von Worten, die dem mantra eine beson dere Kraft geben. Das bija ist die Essenz des mantra.
-
Er hat eine sakti. Die sakti ist die Energie in Form des mantra,
d. h. der Schwingungsformen, die durch Klänge geschaffen werden. Sie bringen den Menschen zu der verehrten devata.
-
Er hat einen kT/aka (Stift, Pflock bzw. Keil). Der kT/aka ver schließt das im mantra verborgene mantra-caitanya, die reine Essenz, das reine Bewusstsein hinter dem Klang. Sobald das Siegel durch ständige und fortgesetzte Wiederholung des Namens entfernt worden ist, enthüllt sich das verborgene caitanya (reine Bewusstsein). Der Meditierende hat dann das darsana (Vision) der i$ta-devatä.
-
-
Klang und Bild
Klänge sind Schwingungen. Sie lassen ganz bestimmte Formen entstehen. Jeder Klang schafft eine Form in der sichtbaren Welt. Zusammensetzungen von Klängen schaffen komplexe Formen.
Die Wiederholung eines mantra besitzt die geheimnisvolle Kraft, die Manifestation der Göttlichkeit entstehen zu lassen, so wie die Spaltung des Atoms die ungeheuren Kräfte manifest werden lässt, die darin liegen. Wenn ein bestimmter mantra, der einem bestimmten Gott zugeordnet ist, richtig wiederholt wird, schaffen die Schwingungen, die auf diese Weise erzeugt werden, in den höheren Ebenen eine bestimmte Form, die diese Gottheit für den entsprechenden Zeitraum beseelt.
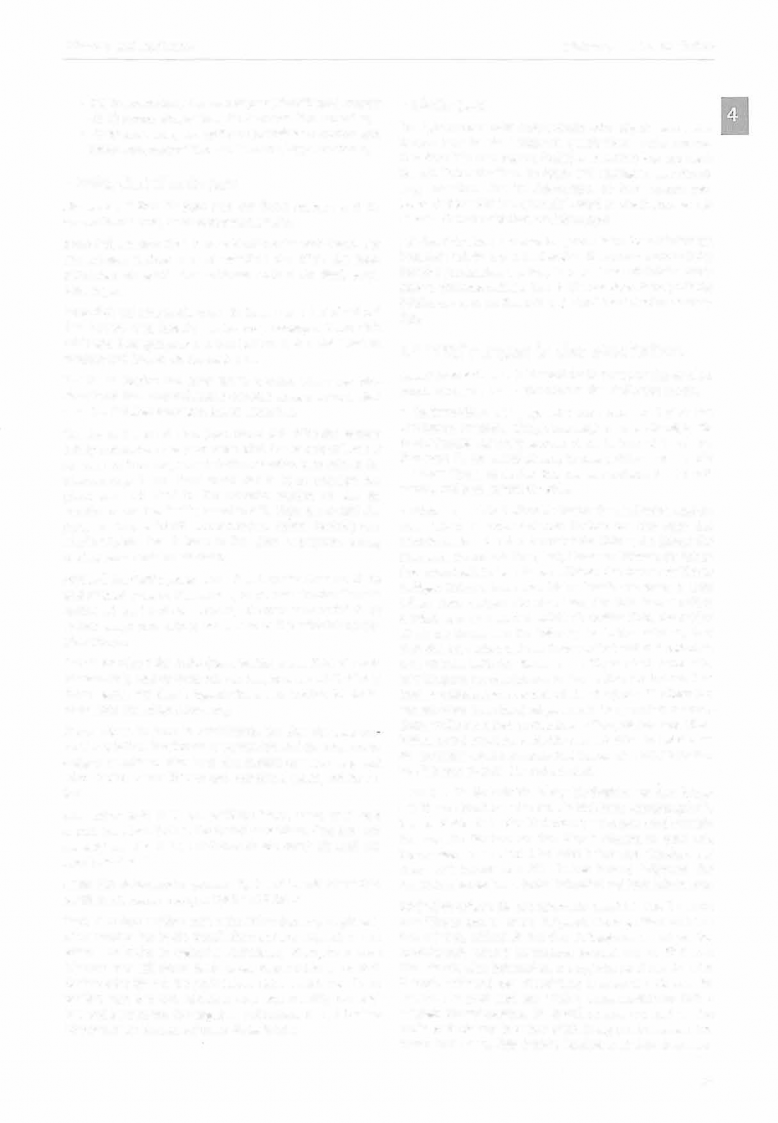
Räja-yoga und Meditation
-
Die Wiederholung des pancäk$ara (fünfsilbigen) mantra
,,(of!l) nama� siväya" lässt die Form von Siva entstehen.
-
Die Wiederholung des U$täk$ara (achtsilbigen) mantra „Of!l
namo näräya,:,äya" lässt die Form von Vi�r:iu entstehen.
-
Praktische Hilfen für japa
Die besten Zeiten für japa sind der frühe Morgen und die Abenddämmerung, wenn sattva vorherrscht.
Setze dich mit dem Gesicht nach Norden oder nach Osten. Das übt subtilen Einfluss aus und verstärkt den Effekt des japa. Besonders als spiritueller Anfänger solltest du diese Regel beherzigen.
Setze dich auf eine Decke oder ein Kissen und nicht direkt auf den Boden. Dies bewahrt deine Körperenergie. Setze dich ruhig und bewegungslos hin. Das hilft auch, den Geist fest zu machen und fördert die Konzentration.
Sprich vor Beginn des Japa einige Gebete. Wenn die i$ta devatä mit den entsprechenden Gebeten angerufen wird, lässt dies den richtigen sattwigen bhäva entstehen.
Nun beginnt man mit dem japa, wobei jede Silbe des mantra richtig und deutlich ausgesprochen wird. Der mantra soll weder zu rasch noch zu langsam wiederholt werden. Man erhöht die Geschwindigkeit nur dann, wenn der Geist zu wandern be ginnt. Japa soll nicht in Eile gemacht werden, so wie ein Arbeiter seine Arbeit eilig beenden will. Nicht die Anzahl des Japa, sondern Reinheit, Konzentration, bhäva (Gefühl) und Einpünktigkeit des Geistes helfen dem Aspiranten dabei, Gottesbewusstsein zu erlangen.
Japa soll mit Gefühl gemacht werden. Derselbe Fluss von Liebe und Respekt muss im Herzen sein, wenn man sich des Namens Gottes erinnert und daran denkt, wie man ganz natürlich im Herzen empfinden würde, wenn man Gott tatsächlich gegen über stünde.
Die Verwendung der mälä (Gebetskette) unterstützt die Auf merksamkeit, und es wirkt wie ein Ansporn, die mälä ständig fortzusetzen. Für den fortgeschrittenen Aspiranten ist sie je doch nicht unbedingt notwendig.
Abwechslung im japa ist erforderlich, um das Interesse auf rechtzuerhalten, Ermüdung zu vermeiden und der Monotonie entgegenzuwirken. Man kann den mantra eine Zeit lang laut wiederholen, dann flüstern und manchmal geistig wiederho len.
Man bittet Gott nicht um weltliche Dinge, wenn man Japa macht. Man kann jedoch das Gefühl entwickeln, dass das Herz gereinigt und der Geist, mit Gottes Gnade, durch die Kraft des mantra fest wird.
Halte den guru-mantra geheim. Sprich nicht mit Menschen darüber, die keinen Bezug zu Spiritualität haben.
Nach dem japa verlässt man nicht sofort den Ort, begibt sich nicht unmittelbar in die Gesellschaft anderer Menschen und stürzt sich nicht in weltliche Aktivitäten. Wenigstens zehn Minuten lang still sitzen bleiben, ein Gebet flüstern, an Gott denken oder über Seine grenzenlose Liebe nachsinnen. Dann verlässt man den Ort, nachdem man sich demütig verbeugt hat, und beginnt mit den täglichen Aktivitäten. Die spirituellen Schwingungen bleiben auf diese Weise intakt.
Erfahrungen in der Meditation
-
-
-
Likhita-japa
Der i$ta-mantra oder guru-mantra wird täglich eine halbe Stunde lang in ein Notizbuch geschrieben. Beim mantra Schreiben hält man mauna (Stille). Den mantra klar und deut lich mit Tinte schreiben. An Sonn- und Feiertagen eine Stunde lang schreiben. Das ist likhita-japa. So kann wunderbare Konzentrationsfähigkeit entwickelt werden. Unschätzbarer spi ritueller Nutzen erwächst aus likhita-Japa.
Für das Schreiben des mantra gelten keine Beschränkungen bezüglich Schrift und Schreibweise. Ein mantra kann in jeder Sprache geschrieben werden, du kannst also lateinische Buch staben, wissenschaftliche Umschrift oder devanägarT (indische Schrift, die u. a. für Sanskrit und HindT benutzt wird) verwen den.
-
-
-
Erfahrungen in der Meditation
Swami Sivananda hat die Vielzahl der Erfahrungen des Schülers beschrieben, wenn er Fortschritte in der Meditation macht.
-
Anähata-Töne: Der yogT hört manchmal zu Beginn der Meditation mystische Klänge. Das zeigt an, dass die när;}Ts, die Energiekanäle, gereinigt worden sind. Es kann sich um den Klang von Glocke, Muschelhorn, Zymbeln, Flöten usw. handeln
- letzten Endes ist es der Ton, der alle anderen in sich auf nimmt, und man kommt zur Stille.
-
Lichter in der Meditation: Zu Beginn der Meditation erschei nen Lichter in verschiedenen Farben vor der Stirn des Meditierenden. Das sind tanmatrische Lichter, die Lichter der Elementarformen wie Erde, Luft, Feuer und Wasser. Sie haben ihre charakteristischen Farben. Neben den zuvor erwähnten farbigen Lichtern kann man kleine Kugeln von weißem Licht sehen. Nach einigen Monaten kann das Licht immer größer werden, und man sieht vielleicht ein weißes Licht, das größer ist als die Sonne. Die Erscheinung des Lichtes zeigt an, dass man das Körperbewusstsein transzendiert und sich zwischen zwei Ebenen befindet. Bewege den Körper nicht, atme sehr, sehr langsam. Formen können in den Lichtern erscheinen. Dies können Gestalten von devatäs (Gottheiten) sein. Die Gestalten von ($iS (Weisen, Sehern) mögen erscheinen, um dich zu ermu tigen. Vielleicht siehst du Gebäude, Flüsse, Gärten usw. Diese Visionen sind entweder subjektiv oder objektiv, das heißt, dass sie entweder eigene mentale Reaktionen oder W irklichkeiten von feineren Ebenen der Materie sind.
-
Zeichen für Fortschritte in der Meditation: Für den fortge schrittenen Meditierenden hat die Welt keine Anziehungskraft. Sinnesobjekte sind keine Verlockung mehr. Man wird wunsch los, und die Bindung an den Körper schwindet. Geist und Körper werden zu Licht. Man wird heiter und glücklich. Der Geist ruft immer das Bild Gottes hervor. Während der Meditation verliert man jedes Zeitgefühl und hört keinen Laut.
Schließlich erfährt der Meditierende vielleicht eine Trennung vom Körper, und in einem fortgeschritteneren Stadium ist es ihm möglich, willentlich mit dem Astralkörper zu reisen. Der Meditierende erlangt kosmisches Bewusstsein. Er fühlt sein Einssein mit allen Seinsstufen. Er sorgt sich nicht um Tod oder Zukunft. Während der Erleuchtung brechen die Dämme der Freude. Der yogT wird von Wellen unbeschreiblicher Glück seligkeit überschwemmt. Er ist vollkommen wunschlos. Eine große Veränderung in seiner Erscheinung und in seinem Auf treten findet statt. Sein Gesicht leuchtet in strahlendem Licht.
51
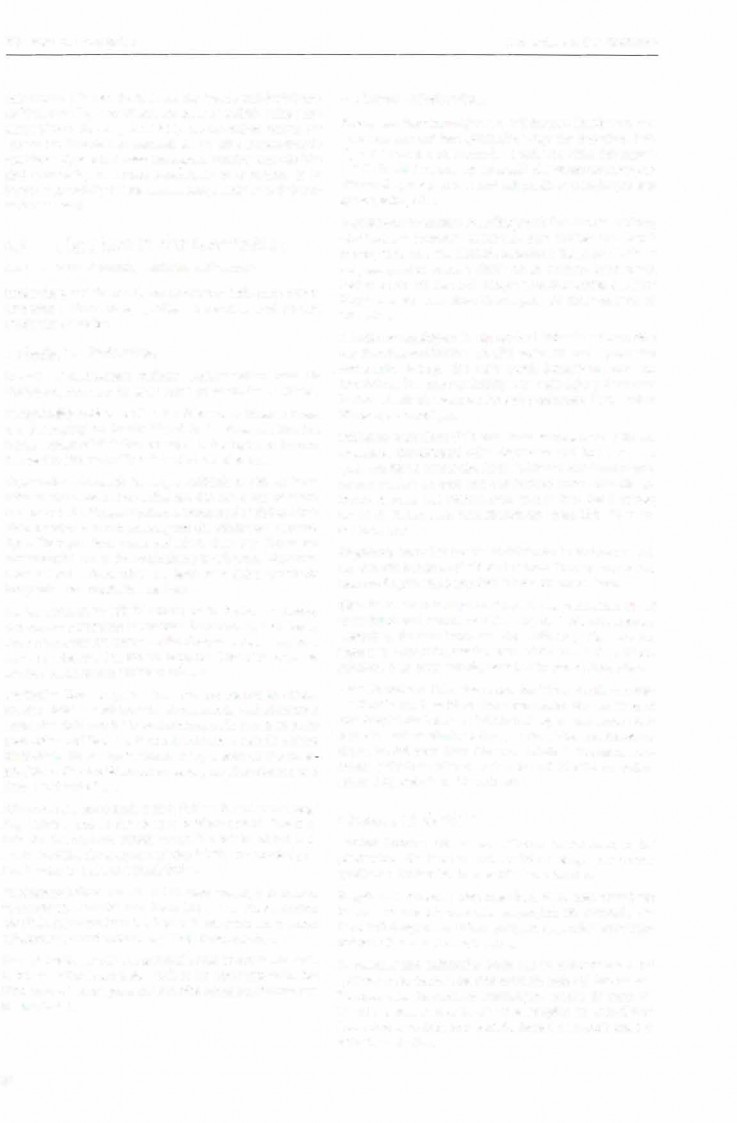
Räja-yoga und Meditation
Seine Augen glänzen. Sie sind Seen der Freude und der Wonne. Er fühlt, dass die ganze Welt in ein Meer unendlicher Liebe und unsterblichen Glücks getaucht ist, das die wahre Essenz des Lebens ist. Kosmisches Bewusstsein ist eine innewohnende natürliche Eigenschaft aller Menschen. Training und Disziplin sind notwendig, um dieses Bewusstsein zu erwecken. Es ist immer gegenwärtig im Menschen. Möge jeder sein Geburts recht erlangen!
-
-
Hindernisse in der Meditation
(vgl. Swami Vishnu-devananda, ,,Meditation und Mantras")
Hindernisse, auf die man in der Meditation trifft, kann man in körperliche Hindernisse, geistige Hindernisse und höhere Hindernisse einteilen.
-
Physische Hindernisse
Instabile Wohnsituation: Zielloses Umherwandern oder die Unfähigkeit, auch nur für eine Woche an einem Ort zu bleiben.
Unregelmäßiges sädhana: Das Aufhören der spirituellen Praxis und der Mangel an Regelmäßigkeit in der täglichen Routine. Solche Unregelmäßigkeiten vor allem in der täglichen Medita tion wirken sich nachteilig auf das Fortschreiten aus.
Ungesunder Lebensstil: Zu langes Aufbleiben, sich zu lange unter zu vielen Menschen aufhalten, das Essen von ungesun den oder nicht sattwigen Speisen, anstrengende geistige Arbeit ohne ausreichende Entspannung und das Fehlen von regelmä ßigen Übungen. Man muss bedenken, dass der Körper das Instrument ist, um Gottverwirklichung zu erlangen. Wenn man nicht bei guter Gesundheit ist, kann man keine ernsthafte Yogapraxis oder Meditation machen.
Starkes Mitteilungsbedürfnis: Durch zuviel Reden und beson ders das Sichverwickeln in unnötige Kontroversen und Diskus sionen fördert innere Unruhe. Stille hingegen erlaubt uns, nach innen zu schauen. Das innere Buch der Erkenntnis wird die intuitive Weisheit zum Erblühen bringen.
Ungünstige Umgebung: Negative Orte und Menschen verwir ren den Geist. Verwicklung in stimulierende Äußerlichkeiten erregt den Geist durch Sinneseindrücke, zieht den Geist mehr nach außen und lässt den Eindruck entstehen, dass die äußere Wirklichkeit die einzige Wirklichkeit ist, anstatt es uns zu er möglichen, die eine Wahrheit zu sehen, die allen Formen und Namen zugrunde liegt.
Kritiksucht: Das stete Suchen nach Fehlern in anderen erzeugt Negativitäten und ist der eigenen Reinigung nicht förderlich. Sehr viel Zeit wird mit Tratsch vertan. Die Zeit ist höchst kost bar. Daher kläre deine eigene geistige Fabrik, und du wirst gro ßen Frieden im äußeren Tumult finden.
Narzissmus: Ichbezogenheit und die Gewohnheit, sich stets zu rechtfertigen, schadet der Entwicklung von Konzentration ebenfalls. Ständiges Sprechen über sich selbst führt zu falschen Behauptungen und anderen negativen Gewohnheiten.
Kein spiritueller Lehrer: Der spirituelle Pfad ist dornig und steil. Er ist buchstäblich auf jeder Stufe voller Schwierigkeiten. Die Führung durch einen guru, der den Pfad schon beschritten hat, ist unerlässlich.
52
Hindernisse in der Meditation
-
Mentale Hindernisse
Reizbarkeit: Verstimmungen wie Erbitterung, Entrüstung, Wut oder Zorn sind auf dem spirituellen Weg sehr hinderlich. Geis tig und körperlich die Kontrolle zu verlieren wirkt sich negativ auf die Meditation aus. Die Intervalle der Verstimmungen ver stärken sich, wenn ihnen nicht mit positiven Handlungen ent gegengewirkt wird.
Depression: Sie entsteht in Anfängern als Resultat vieler Dinge, einschließlich früherer Neigungen, dem Einfluss von Astral wesen, schlechter Gesellschaft, bewölkten Tagen usw. Ihr kann entgegengewirkt werden durch einen raschen Spaziergang, Laufen an der frischen Luft, Singen göttlicher Lieder, das laute Singen von orr, oder einen Spaziergang am Meer oder an ei nem Fluss.
Zweifel: Zwiespältigkeit ist ein großes Hindernis auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Zweifel versperrt den spirituellen Fortschritt. Reinige das Herz durch intensiven Japa und Meditation. Übe dies regelmäßig. Der große Lehrer, der innere Lenker, ist mit dir. Wenn du Ihn sich ausdrücken lässt, wird Er Hindernisse beseitigen.
Schlechte Gedanken: Viele von ihnen stammen aus früheren sarr,skäras (Eindrücken) oder Neigungen und holen uns auf quälende Weise wieder ein. Auch sie können nur durch perma nentes Denken an Gott und das Positive unter Kontrolle ge bracht werden. Das Positive siegt immer über das Negative; das ist ein Naturgesetz. Mut überwindet Angst, Liebe überwin det Hass usw.
Ängste: Sie entstehen aus vielerlei Gründen im Geiste und quä len den Strebenden, sobald sie konkrete Formen annehmen. Manche Ängste sind besonders schwer zu kontrollieren.
Gier: Sie ist ein mächtiges Hindernis in der Meditation. Sie ist unersättlich und nimmt verschiedene, oft subtile Formen an. Menschen, die nach Ruhm und Macht dürsten, mögen sie nun yogTs sein oder nicht, werden vom spirituellen Fortschritt ab gehalten. Man muss ständig seine Motive genau überprüfen.
Hass: Ein weiterer Feind des Aspiranten ist das Gefühl von star ker Abneigung. Hass ist ein tief verwurzelter Gegner. Er kann zum Beispiel die Form von Feindschaft gegen eine andere Reli gion, eine andere ethnische Gruppe oder Nation annehmen; er nimmt im ka/i-yuga (dem Eisernen Zeitalter) überhand. Dau erndes selbstloses Dienen verbunden mit Meditation helfen, solche Widerstände zu überwinden.
-
Höhere Hindernisse
Letztlich kommen wir zu den höheren Hindernissen in der Meditation. Sie tauchen auf, nachdem einige der vorher erwähnten Hindernisse transzendiert worden sind.
Ehrgeiz und Wünsche: Man muss bedenken, dass Vergnügen Schmerz verursacht; dass alles vergänglich ist. Entwickle Lei denschaftslosigkeit und Gleichgültigkeit gegenüber Sinnesver gnügen. Hänge nicht an Wünschen.
Moralischer und spiritueller Stolz: Das ist nichts Seltenes bei spirituellen Aspiranten: Sie sind oft recht stolz auf ihre Askese übungen oder Meditationserfahrungen. Mache dir stets die Tatsache bewusst, dass du ein Wassertropfen im unendlichen Ozean brahmans bist, und es wird schwierig sein, Stolz und Ego aufrechtzuerhalten.
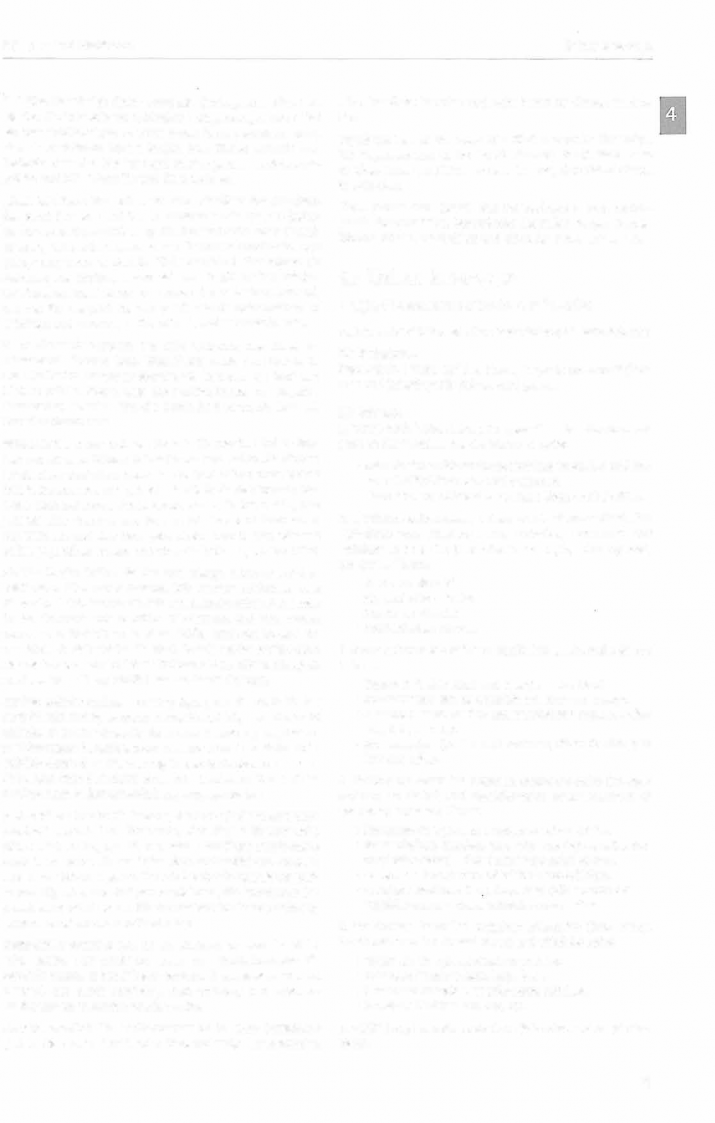
Räja-yoga und Meditation
Religiöse Heuchelei: Einige sannyäsTs (Entsagende, Mönche), die den Pfad der Selbstverwirklichung eingeschlagen und dabei ein paar siddhis erlernt oder gewonnen haben, tendieren dazu, sich als mahätmas (große Seelen bzw. Weise) aufzuführen. Bedenke, dass der Weg lang und anstrengend ist, und dass die größte und hilfreichste Tugend die Demut ist.
Ruhm und Ehre: Hier sehen wir eine Manifestation des Egos; das Bedürfnis nach weltlichem Ansehen ist ein großes Hinder nis für die Gottverwirklichung. Ein Aspirant sollte stets danach streben, sich zurückzunehmen und Demut zu entwickeln. Dies gelingt nur, wenn er sich der Gleichwertigkeit aller Wesen als Ausdruck des Göttlichen bewusst wird. Es gilt in allen sichtba ren Aspekten bescheiden und menschlich zu bleiben. Jemand, der den Ruf verspürt, äsrams (spirituelle Gemeinschaften) zu errichten und zu leiten, sollte selbst innerlich gereinigt sein.
Elementarerscheinungen: Das sind seltsame, manchmal er schreckende Formen (bzw. Wesenheiten), die dem Schüler in der Meditation begegnen können. Sie kommen, um Kraft und Mut zu prüfen. Wisse, dass das Positive immer das Negative überwindet, so wie Licht die Dunkelheit vertreibt, Mut die Furcht verbannt usw.
Visionen: Wenn der Anfänger Fortschritte macht, wird er Visio nen von höheren Wesen, Astralebenen usw. haben. Sie können Hindernisse darstellen, wenn der Aspirant seinen Geist auf sie fixiert. Sie kommen und gehen, wie alle Gedankenformen; ver weile nicht bei ihnen. Denke daran, dass dein Ziel das ist, was jenseits aller Visionen und Formen ist. Du suchst kosmisches Bewusstsein, und alles Geringere ist ein Unrecht dem höheren Selbst gegenüber. Erhebe dich über die Visionen, strebe weiter.
siddhis: Es gibt Kräfte, die der yogT erlangt, wenn er auf dem spirituellen Pfad voranschreitet. Wir warnen nochmals, dass diese eine Behinderung sein können. Manche Schüler kommen in der Hoffnung, solche Kräfte zu erlangen, und ihre Motive verursachen Verhaftung an diese Kräfte (auch das ist eine Art von Gier, nämlich spirituelle Gier). Meide solche Kräfte, denn sie werden unausweichlich zu Stolpersteinen. Wisse, dass jede zu starke Verhaftung letztlich ein Hindernis darstellt.
ka$äya: Subtiler Einfluss von Vergnügungen auf den Geist, der zurückbleibt und irgendwann wieder Frucht trägt und den Geist ablenkt. Er ist ein Hindernis, da er eine Erinnerung an genosse nes Vergnügen heraufbeschwört. Dadurch wird der Geist buch stäblich durch die Veränderung in den Gedankenformen ver färbt. Man kann dem durch dauerndes Denken an Gott und das Streben nach Selbstverwirklichung entgegenwirken.
rasäsvädana: Das ist die Wonne, die vom niederen savika/pa samädhi kommt. Der Strebende, der dieses übersinnliche Glück erfahren hat, glaubt, nun seine endgültige Bestimmung erreicht zu haben. Er darf hier nicht stehenbleiben, sondern muss seine Erfahrungen weiter mit Beschreibungen jener spiri tuellen Giganten und Heiligen vergleichen, die kosmisches Be wusstsein erreicht haben. Wieder darf der Strebende nicht sta gnieren, sondern muss weiterstreben.
tü$Tm-bhüta avasthä: Das ist ein Zustand, in dem der Geist ruhig bleibt. Der Strebende kann ihn fälschlicherweise für samädhi halten. Es handelt sich tatsächlich um einen neutralen Zustand, der durch sorgfältige Selbstprüfung und intensive Meditation überwunden werden sollte.
stabdha avasthä: Dieser Geisteszustand ist einer Betäubung gleich, die durch Furcht oder Verwunderung hervorgerufen
Kleiner kriyä-yoga
wird. Der Geist ist träge und nicht bereit zur aktiven Medita tion.
avyaktam: Das ist die leere. Hier fühlt man große Einsamkeit (im Gegensatz zum erstrebten All-ein-sein). Es gilt diese leere zu überwinden und Mut aus dem Inneren, dem Selbst (Gott), zu schöpfen.
Fühle immer und überall das Innewohnende, Alldurchdrin gende, Gegenwärtige. Verwirkliche das Selbst. Mögen Freude, Wonne, Friede, Herrlichkeit und Glanz für immer mit dir sein.
-
-
Kleiner kriyä-yoga
-
UjjäyT-Meditation (Quelle der Energie)
Tantrische Meditation aus dem kur:i<;JalinT-yoga in zehn Schritten
Die Sitzhaltung:
Kreuzbeinig, Hände auf den Knien, Finger in cin-mudrä (Dau men und Zeigefinger berühren sich) geben.
Die Schritte:
-
Zunge nach hinten falten, Zungenspitze oder Zungenunter seite an den weichen Teil des Gaumens geben.
-
Beim Einatmen Stimmritzenverschluss anwenden und hör bar mit ujjäyT-Atem ein- und ausatmen.
Diese Atmung während der ganzen Übung beibehalten.
-
-
Rhythmus sicherstellen, indem du die Atmung zählst. Das Verhältnis vom Einatmen zum Anhalten, Ausatmen und Anhalten ist 2 : 1 : 2 : 1. So zählst du z. B. ,,017J eins, 0/7J zwei, 0f!l drei ... "beim:
-
Einatmen bis acht
, Atemanhalten bis vier
, Ausatmen bis acht
, Atemanhalten bis vier.
-
-
Atemrhythmus von selbst weiterfließen lassen. Stelle dir vor, beim ...
-
Einatmen fließen Licht und Energie in dich hinein.
, Atemanhalten bist du angefüllt mit Licht und Energie.
-
Ausatmen leerst du dich und entwickelst Hingabe, Loslas sen, Entspannung.
-
Atemanhalten (nach dem Ausatmen) fühlst du dich ganz leer und offen.
-
-
Verbindung herstellen zwischen mar:ii-püra-cakra (Energie zentrum am Nabel) und visuddha-cakra (Energiezentrum an der Kehle) vorne am Körper.
-
Einatmen: Energie zum mar:ii-püra-cakra schicken.
-
Atemanhalten: Rezitiere räf!), räi7J, räl"(J (bija-mantra des
mar:ii-püra-cakra) - dabei mar:ii-püra-cakra spüren.
-
Ausatmen: Energie zum visuddha-cakra schicken.
, Anhalten: Rezitiere ham, hai7J, ha/7J (bija-mantra des
visuddha-cakra) - dabei visuddha-cakra spüren.
-
-
Verbindung herstellen zwischen äjfiä-cakra (bzw. trikutT,
Punkt zwischen den Augenbrauen) und visuddha-cakra.
-
Einatmen: Energie zu visuddha schicken.
-
Anhalten: Rezitiere hai7J, hai7J, hai7J.
-
Ausatmen: Energie zum äjfiä-cakra schicken.
-
Anhalten: Rezitiere o/7J, o/7J, 0/7J.
-
-
Verbindung herstellen zwischen äjfiä-cakra und mar:ii-püra cakra.
53
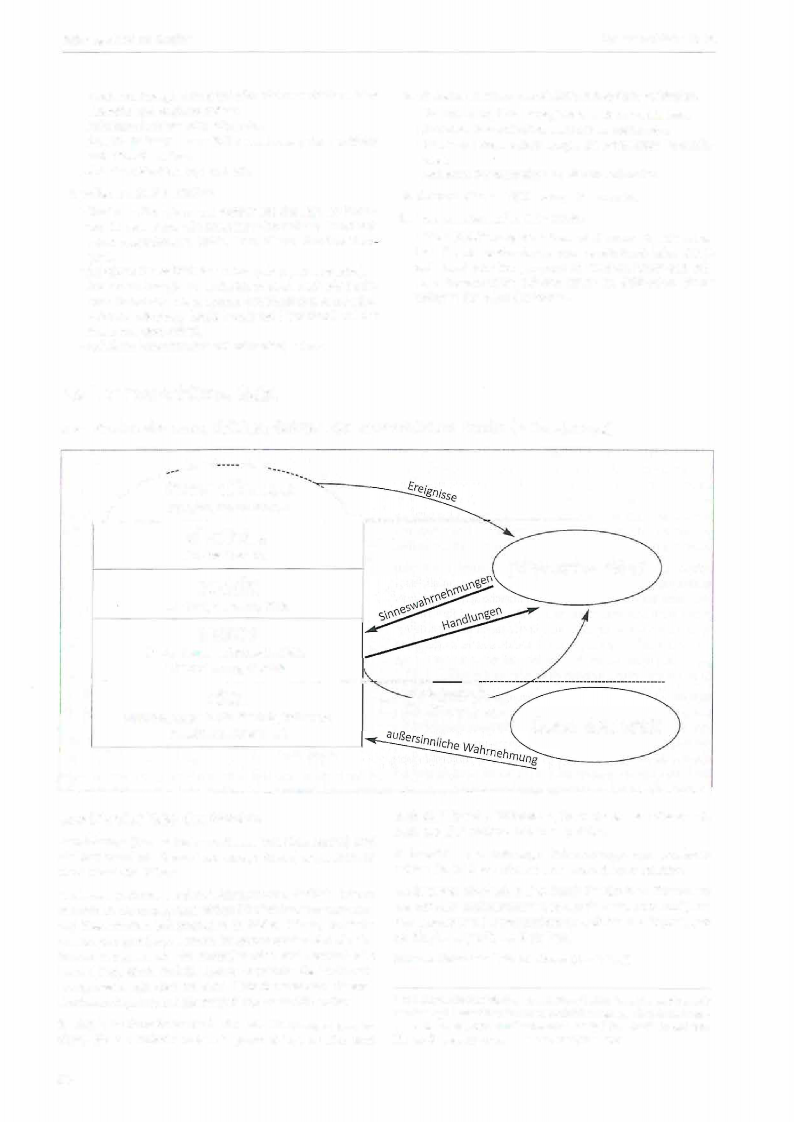
Räja-yoga und Meditation
-
Einatmen: Energie zum mar_,i-püra hinunterschicken, dabei
visuddha und anähata spüren.
-
Anhalten: Rezitiere rärn rärn rärr,.
-
-
Ausatmen: Energie zum äjfiä hochschicken, dabei anähata
und visuddha spüren.
-
Anhalten: Rezitiere Or(l, or(), Orf1.
-
-
-
Vollen Kreislauf herstellen.
-
Einatmen: Energie an der Vorderseite des Körpers hinun terschicken. Dabei alle Energiepunkte spüren: Punkt zwi schen Augenbrauen, Kehle, Herz, Nabel, Geschlechtsor gane.
-
Anhalten: Das mülädhära-cakra spüren (ohne mantra).
-
Ausatmen: Energie durch dieWirbelsäule nach oben schi cken. Dabei alle cakras spüren (svädhi?thäna, mar_,i-püra, anähata, visuddha, bindu (Punkt am Hinterkopf, auf der Ebene des äjfiä-cakra).
-
Anhalten: Konzentration auf sahasrära(-cakra).
-
-
-
Der menschliche Geist
Der menschliche Geist
-
Weiterhin Kreislauf beibehalten, mit so'ham verbinden.
-
Einatmen: so, dabei Energie vorne hinunterschicken.
-
Anhalten: Konzentration auf sakti im mülädhära.
-
Ausatmen: ham, dabei Energie die Wirbelsäule hochschi cken.
-
Anhalten: Konzentration auf siva im sahasrära.
-
-
Konzentration auf äjfiä-cakra, ohne mantra.
-
Konzentration auf inneren Raum:
-
Die ujjäyT-Atmung aussetzen, nicht mehr die Luft anhal ten. Normal weiteratmen oder kevala-kumbhaka. Zunge entspannt oder Zungenspitze an Gaumen hinter den Zäh nen. Konzentration auf den Raum im äjfiä-cakra, hinter trikutT in der Mitte des Kopfes.
-
Modell des menschlichen Geistes, der menschlichen Psyche (antab-karar:ia)
-----,,,,
,,,,------ä ....------
------
,,/
tman (Selbst)
Intuition, innere Stimme
aharikära
r-'''-------------------'--r---------------------- -----------------------------------------------
„Ich-Macher" Ego
buddhi
Intellekt, Vernunft, Wille
manas
Denkprinzip: einfaches Denken,
Wahrnehmung, Gefühle
----+-
_______________, _
physische Welt
citta
1
Unterbewusstsein (Gedächtnis, Wünsche,
Fähigkeiten, Ängste ... )
--=======--.Gedankenkraft
Gedankenwelt
L_ _
-
Die vier Teile des Geistes
Antai)-karar_,a (inneres Instrument): Der Geist (die Psyche) wird als Instrument von ätman bzw. puru?a (Seele) angesehen. Er besteht aus vier Teilen:
-
Manas: Einfaches Denken, Wahrnehmung, Gefühle. Manas wandelt die durch diejfiänendriyas (fünfWahrnehmungs-orga ne) übermittelten Informationen in Bilder, Klänge, Ge-rüche etc. um und gibt ihnen Namen. Im manas spielen sich die ein fachen Gedanken ab, die normalerweise drei Bestand-teile haben: Bild, Wort, Gefühl. Manas vergleicht die Wahr-neh mungsorgane mit dem im citta (Unterbewusstsein) Gespei cherten und gibt sie zwecks Beurteilung an buddhi weiter.
-
Citta*: Im Unterbewusstsein sind alle Erfahrungen gespei chert, die das Individuum jemals gemacht hat. Im citta sind
54
auch die Wünsche, Fähigkeiten, Traumata etc. aus diesem wie auch aus allen anderen Leben gespeichert.
-
Buddhi: Unterscheidungs-, Entscheidungs- und Urteilsver mögen. Besteht aus Intellekt und ganzheitlicher Intuition.
-
Aharikära: Ich-Macher, Ego. Durch das Ego identifizieren wir uns mit dem Wahrgenommenen (,,mein Haus, Auto etc.") und dem Instrument derWahrnehmung (,,ich bin der Körper", ,,ich bin klug", ,, ... groß", ,, ... klein" etc.)
Jenseits dieser vier Teile ist ätman (das Selbst).
-
Im Rahmen des Modells des menschlichen Geistes (anta�karal)a) bezeich net der Begriff citta einen Teil der menschlichen Psyche, nämlich das Unter bewusstsein. Im „Yoga-sütra" verwendet Patafijali den Begriff im weiteren Sinn als Überbegriff für den gesamten Geist/die Psyche.
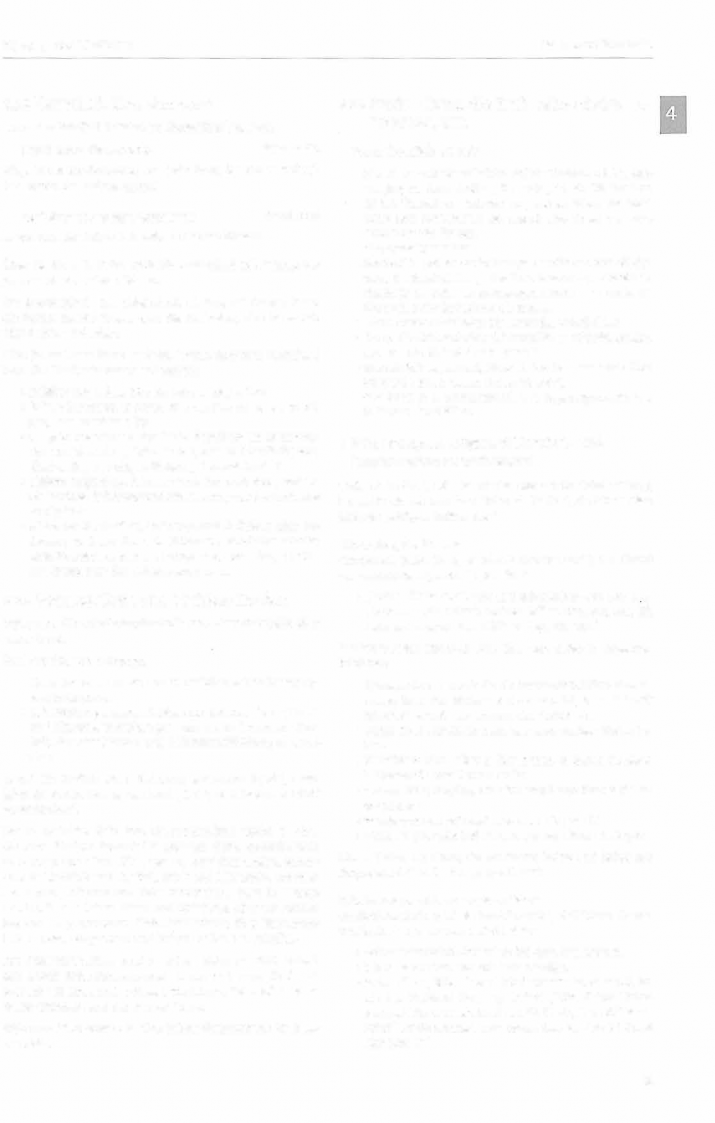
Räja-yoga und Meditation
-
-
Herrschaft über den Geist
Der weise Patafijali definiert im „Yoga-sütra" yoga als:
yogas citta-v.rtti-nirodhal:, [Yoga-sütra 1.2]
,,Yoga ist das Zur-Ruhe-Kommen (nirodhal:,) der Gedanken[wel len] (vrttis) des Geistes (citta)."
tadii dra$tu!J sva-rüpe 'vasthiinam [Yoga-sütra 1.3]
,,Dann ruht der Sehende in seinem wahren Wesen."
Über die Herrschaft der vrttis (Gedanken[wellen]) gelangt der
yog'i zu seinem wahren Wesen.
Der See-Vergleich: Der Geist ist wie ein See, auf dessen Grund ein Schatz ist. Die Wellen sind die Gedanken, die den Schatz (das Selbst) verdecken.
Citta (im weiteren Sinne als Geist, Psyche, Gemüt zu verstehen) kann fünf Zustandsformen annehmen:
-
müi;Jha: Träge, faul. Wie ein verunreinigter See.
-
k$ipta: Zerstreut, unruhig. Wie ein See an einem windi gen, sehr unruhigen Tag
-
vik$ipta: (manchmal) abgelenkt, Bemühen um Konzentra tion und Sammlung. Wie ein See, dessen Oberfläche von gleichmäßigen, ruhigen Wellen gekennzeichnet ist.
-
ekiigra: Einpünktig, fokosiert Volle Konzentration, welche die intuitive Erfahrung und Erweiterung des Bewusstseins ermöglicht.
-
niruddha: Kontrolliert, vollkommenes Aufhören aller Ge danken, welches die volle Erfahrung des Selbst ermög licht. Wie ein vollkommen ruhiger und klarer See, auf des sen Grund man den Schatz sehen kann.
-
-
Gedankenkraft und positives Denken
Räja-yoga: Über Gedankenkontrolle zum Herrscher (räja) über unser Leben
Zwei Aspekte von räja-yoga:
-
Gedankenkraft nutzen, um im täglichen Leben besser zu rechtzukommen.
-
Beherrschung unseres Geistes und Transzendierung unse rer Wünsche, Verhaftungen etc., um vollkommene Frei heit, Gotteserfahrung und Selbstverwirklichung zu errei chen.
In diesem Kapitel: Mehr Betonung auf ersten Aspekt, ange lehnt an Swami Sivanandas Buch „Erfolgreich leben und Gott verwirklichen".
Der menschliche Geist bzw. die menschliche Psyche ist ohne Grenzen. Riesiges Potenzial in unserem Geist. Gedanke steht am Anfang von allem. Alles, was wir erreichen wollen, kommt vom Geist: Glück und Unglück, Erfolg und Misserfolg. Wir müs sen lernen, mit unserem Geist umzugehen. Geist ist geprägt durch früheres Leben, Gene und Erziehung. Aber wir können ihn neu programmieren. Nicht lamentieren über Vergangen heit, sondern Gegenwart und Zukunft selbst neu schaffen.
JETZT trainieren. JETZT positiv machen. Keine rosa Brille aufset zen: Durch tiefes Hineinschauen in uns zu innerer Kraft. Der Mensch hat einen freien Willen. Wir können jederzeit unseren Geist verändern und damit unser Leben.
Räja-yoga ist so etwas wie eine Gebrauchsanweisung für unse ren Geist.
Der menschliche Geist
4.8.s Praxis - lerne, die Kraft deines Geistes zu benutzen, um:
-
-
Stets fröhlich zu sein
-
Mindfulness: Achtsamkeit im täglichen Leben, z. B. bei Spa ziergängen, Hausarbeiten, Einkaufen, Arbeit. Wartezeiten als Möglichkeit zur Entspannung nutzen. Wenn der Geist ruhig und konzentriert ist, macht alles Spaß und man empfindet viel Freude.
-
Gegenwart genießen
-
-
Das Positive sehen: Veränderungen als Chance zum Wachs tum. Krankheit als Möglichkeit zur Besinnung. Verluste als Neubeginn. Gute Charaktereigenschaften in anderen. Chancen mehr betrachten als Risiken.
-
Wenn etwas schiefgeht: Die Kunst des Urteilfällens.
-
Temporär statt endgültig {,,Diesmal ist es schiefgegangen, das nächste Mal wird es klappen").
-
Speziell statt allgemein {,,Diesen Job habe ich verloren. Aber ich werde einen neuen finden können").
DREI SCHRITTE: 1. Bewusstwerden. 2. Gegenargumentieren.
3. Neues Urteil fällen.
-
-
Erinnerungsvermögen, Willenskraft und Konzentration zu verbessern
Wille ist die Kraft, mit der wir das, was wir für richtig erkannt haben, in die Tat umsetzen. Wille ist die Kraft, die hinter allen anderen geistigen Kräften steht.
Entwicklung des Willens
Wiederhole jeden Morgen beim Aufwachen und jeden Abend vor dem Schlafengehen ein paar Mal:
-
,,Mein Wille ist stark, rein und unbesiegbar. OfTI, 0rfl, am. Ich vermag alles durch meinen Willen. OfTI, 0rfl, 0fT/. Ich habe einen unendlichen Willen. OfT/, 0fT/, OfTI."
Meditiere jeden Tag 5-15 Min. über den Willen in folgenden Schritten:
-
Wiederhole mehrmals die obengenannten Affirmationen.
-
-
Denke über den Willen nach - was er ist, was du damit bewirken kannst, die Grenzen des Willens etc.
-
Denke über Menschen nach, die einen starken Willen ha ben.
-
Visualisiere dich selbst in Situationen, in denen du deine Willenskraft unter Beweis stellst.
-
Werde still und spüre, wie eine ungeheure Kraft in dir er weckt wird.
-
-
Wiederhole die Affirmationen noch ein paar Mal.
, Atme ein paar Mal tief ein und aus und öffne die Augen.
Mache jeden Tag etwas, das du richtig findest und bisher aus Bequemlichkeit o. ä. nicht gemacht hast.
Entwicklung des Erinnerungsvermögens
Gedächtnisschulung ist ein faszinierendes, vielfältiges Thema. Drei kleine Tipps können sofort helfen:
-
Aufmerksamkeit/Achtsamkeit bei dem, was wir tun.
-
-
Interesse an dem, was wir lernen wollen.
-
Affirmation: ,,Bitte, liebes Unterbewusstsein, sage mir, wo ich den Schlüssel hingelegt habe", ,,Bitte, liebes Unter bewusstsein, erinnere mich um 13.50 Uhr, Frau XYZ anzu rufen", ,,Bitte erinnere dich daran, dass ich den Schlüssel hier hinlege."
-
-
55
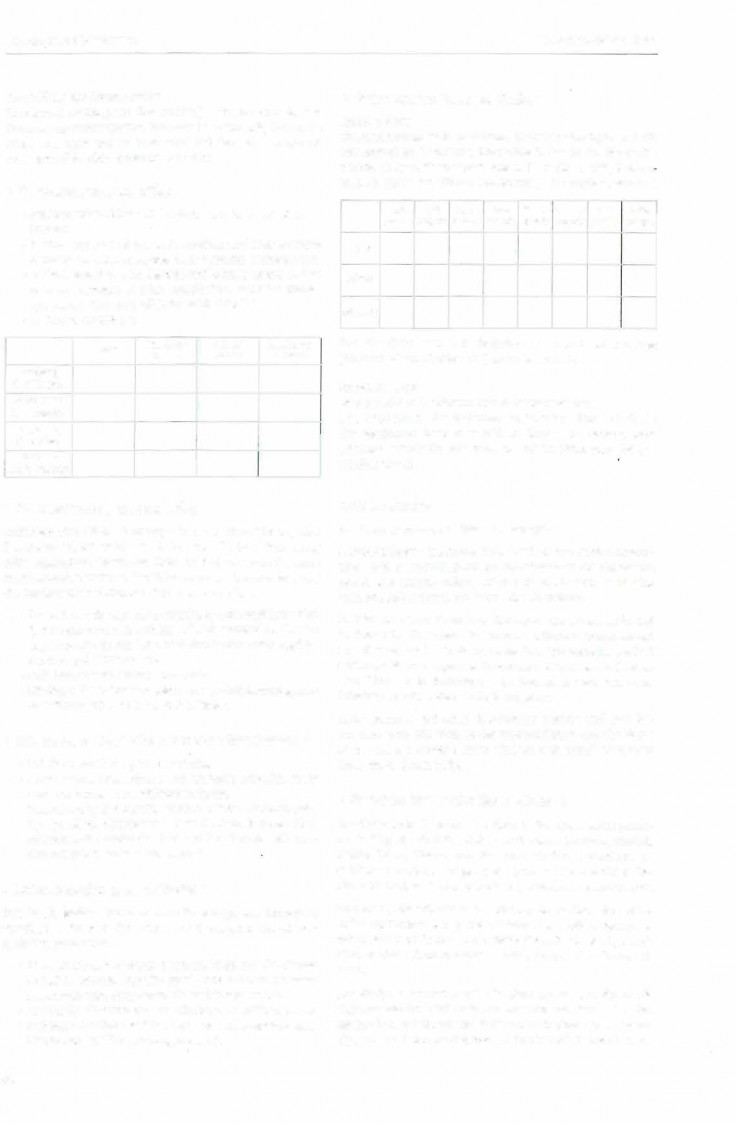
Räja-yoga und Meditation
Entwicklung der Konzentration
Konzentrationsübungen (Meditation). Entspannung ist der Schlüssel zur Konzentration. Interesse ist notwendig. lerne, die Dinge zu mögen und sei interessiert bei dem, was du machst oder worauf du dich konzentrieren willst.
-
Zu wissen, was du willst
, Brainstorming: Alles aufschreiben, was dir in den Sinn kommt.
> Beurteilung nach ethischen Maßstäben und eigenen Wert vorstellungen. Schauen, was dahintersteckt, umbenennen.
, Im Zweifelsfall (,,Will ich das wirklich?"): Stelle dir vor, du hast
es schon erreicht, in allen Einzelheiten, mit allen Konse quenzen. Prüfe: ,,Wie fühle ich mich dabei?"
, In Tabelle einordnen:
Beruf
Beziehung/ privat/ persönlich/ Familie Hobby spirituell
kurzfristig (1-4 Wochen)
(
mittelfristig 1-6 Monate)
langfristig (1-2 Jahre)
sehr lang- fristig (visionär)
-
Zu bekommen, was du willst
Gedanken sind Kräfte. Autosuggestion und Visualisierung sind besonders wirkungsvoll am Ende einer Tiefenentspannung oder Meditation: Wenn der Geist im Alphazustand ist, kann man besonders stark auf das Unterbewusstsein einwirken, und die ausgesandten Gedanken sind besonders stark.
-
Stelle dir vor, du hast schon erreicht, was du erreichen willst. Sprich Affirmationen: ,,Ich bin ... ", ,,Ich entwickle ... "Jeden Tag ein paar Minuten lang, nach Entspannungsübung/Me ditation, 1-6 Wochen lang.
-
Hilfe kommt vom Unterbewusstsein.
-
-
Erhöhung der Lebensenergien durch prär:,äyäma (yogische Atemübungen) macht den Geist stärker.
-
-
Mit anderen Menschen gut zurechtzukommen
-
In jedem steckt ein göttlicher Funke.
-
In den anderen Menschen hineinversetzen; Empathie, mehr über den anderen in Erfahrung bringen.
-
-
Visualisierung und Autosuggestion: Dir den Anderen geis tig vorstellen. Visualisieren, dass du dem Anderen Licht schickst. ,,Ich schicke dir Licht und Verständnis. Wir wer den gut miteinander auskommen."
-
-
Deine Beziehung zu verbessern
Dies ist ein großes Thema. Genaue Ratschläge sind individuell verschieden. Ein paar Tipps sind sehr wirkungsvoll und einfach in die Tat umzusetzen.
-
Sich Zeit für den Anderen nehmen. Nicht nur die Menge an Zeit ist wichtig. ,,Quality time" - nur mit dem Anderen zusammen sein, ohne etwas Zielgerichtetes zu tun.
, Realistische Erwartungen - den Anderen nicht überfordern.
, Gedanken der Liebe schicken (oft, aber insbesondere nach Meditation und Entspannungstechnik).
Der menschliche Geist
-
Deine wahre Natur zu finden
Relative Natur
Charakterspiegel nach Elementen (Beispiel: eine typische Luft eigenschaft ist Flexibilität, Schnelligkeit. Das ist im Normalfall positiv. Es kann übersteigert aber z. B. zu Nervosität, Reizbar keit, Ungeduld etc. führen. Das ist mit „Luft negativ" gemeint.)
Luft Luft Feuer Feuer Wasser Wasser Erde Erde positiv negativ positiv negativ positiv negativ positiv negativ
stark mittel schwach
Der Charakter kann mit Techniken des mentalen Trainings (Eigenschaftsmeditation etc.) verändert werden.
Absolute Natur
Wer bin ich? In Meditation den Geist beobachten.
Das, was jenseits der Gedanken ist, ist reines Bewusstsein. In der Meditation kann man höhere Stufen des Bewusstseins erlangen. (Vergleiche mit dem, was wir im jfiäna-yoga-Teil ge- macht haben.)
4.8.6 Gedanke
(vgl. Swami Sivananda, ,,Die Kraft der Gedanken")
Der Gedanke ist eine starke Kraft. Der Gedanke ist eine dynami sche Kraft. Er entsteht durch die Schwingungen des physischen prär:,a, des sük!jmä-prär:,a, auf der Geistsubstanz. Er ist eine Kraft wie Schwerkraft, Kohäsion oder Abstoßung.
Du bist von einem Ozean von Gedanken umgeben. Du treibst im Ozean der Gedanken. Du nimmst bestimmte Gedanken auf und gibst andere in die Gedankenwelt ab. Die Gedankenwelt ist wirklicher als das physische Universum. Gedanken sind leben dige Dinge. Jede Veränderung im Gedanken wird von einer Schwingung seiner Geistmaterie begleitet.
Jeder Gedanke hat einen bestimmten Namen und eine be stimmte Form. Die Form ist der grobstofflichere und der Name ist der feinere Zustand einer einzigen sich manifestierenden Kraft, die Gedanke heißt.
-
-
-
Gedanke ist feinstoffliche Materie
Der Gedanke ist feinstoffliche Materie. Der Gedanke ist genau so ein Ding wie ein Stück Stein. Der Gedanke hat Form, Gestalt, Größe, Farbe, Eigenschaft, Substanz, Kraft und Gewicht. Ein spiritueller Gedanke ist gelb; ein hass- und zornerfüllter Ge danke ist dunkelrot; ein selbstsüchtiger Gedanke ist braun usw.
Man stirbt, aber die Gedanken können nie sterben. Die macht vollen Gedanken von großen Weisen und (!jis vergangener Zeiten sind noch immer in der äkäsa-Chronik. Hellsichtige yogTs können diese Gedankenbilder wahrnehmen. Sie ·können sie lesen.
Der Gedanke kommt durch die Nahrung zu uns. Wenn die Nahrung rein ist, wird auch der Gedanke rein. Wer reine Ge danken hat, spricht mit viel Kraft und hinterlässt einen starken Eindruck im Geist des Zuhörers. Er beeinflusst Tausende Men-
56
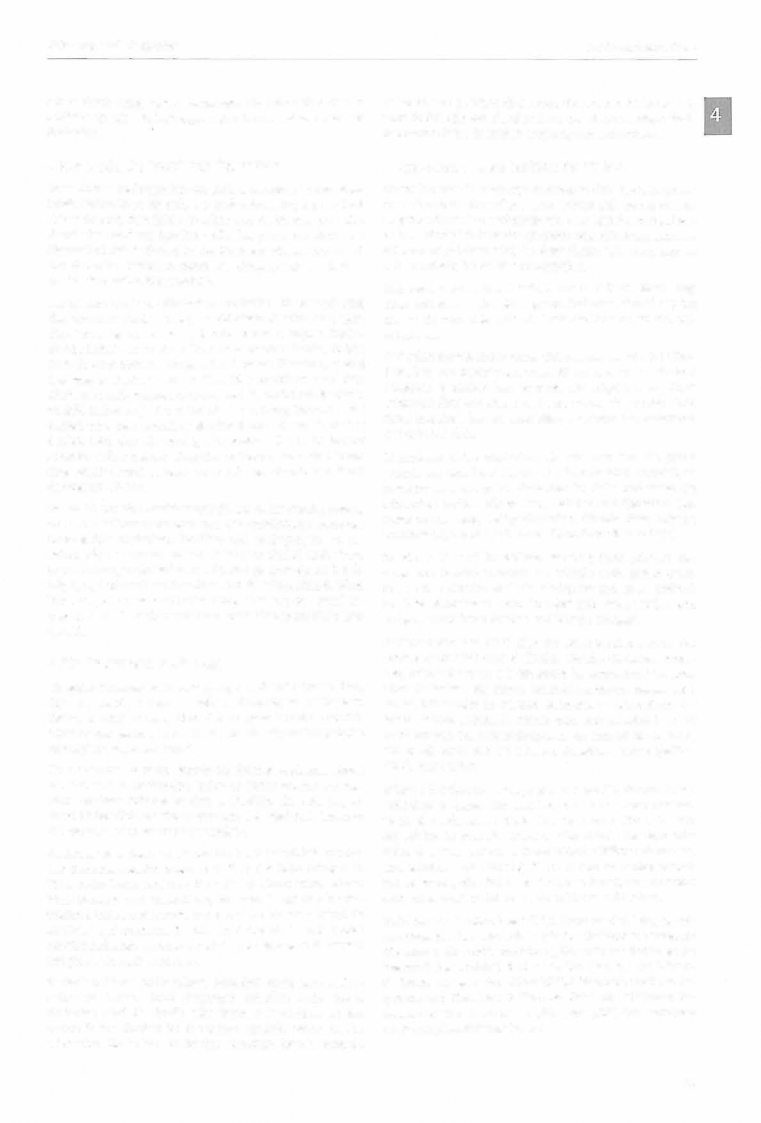
Räja-yoga und Meditation
sehen durch seine reinen Gedanken. Ein reiner Gedanke ist schärfer als eine Rasierklinge. Habe immer reine, erhabene Gedanken.
-
Der Gedanke formt den Charakter
Jeder deiner Gedanken hat auf jede erdenkliche Weise einen tatsächlichen Wert für dich. Die Kraft deines Körpers, die Kraft deines Geistes, dein Erfolg im Leben und die Freude, die deine Gesellschaft anderen bereitet - alles hängt von der Natur und Eigenschaft deiner Gedanken ab. Du musst wissen, wie du mit den Gedanken umgehen musst. Der Umgang mit den Gedan ken ist eine exakte Wissenschaft.
Der Mensch wird vom Gedanken geschaffen. Ein Mensch wird das, woran er denkt. Denke, du bist stark; du wirst stark wer den. Denke, du bist schwach; du wirst schwach werden. Denke, du bist töricht; du wirst ein Dummkopf werden. Denke, du bist Gott; du wirst Gott. Ein Mensch formt seinen Charakter, er wird das, was er denkt. Wenn du über Mut meditierst, wird dein Charakter mutig werden. Genauso verhält es sich mit Reinheit, Geduld, Selbstlosigkeit und Selbstbeherrschung. Wenn du edel denkst, wird dein Charakter allmählich edel. Wenn du niedrig denkst, wird sich ein niedriger Charakter bilden. Du kannst genauso sicher deinen Charakter aufbauen, wie ein Maurer eine Mauer errichten kann, da er mit dem Gesetz und durch das Gesetz arbeitet.
Der Geist hat eine Anziehungskraft. Du ziehst ständig sowohl von der sichtbaren wie auch von der unsichtbaren Seite der Lebenskräfte Gedanken, Einflüsse und Bedingungen an, die deinen eigenen Gedanken und Linien sehr ähnlich sind. Nimm jeden beliebigen Gedanken mit dir, und so lange du ihn bei dir trägst, egal wie weit du über Berg und Tal gehst, wirst du ohne Unterlass, ob du es weißt oder nicht, eben nur das anziehen, was der in dir vorherrschenden Gedankeneigenschaft ent spricht.
-
Die Frucht von Gedanken
Ein guter Gedanke ist dreimal gesegnet. Zuerst nützt er dem, der ihn denkt, indem er seinen Geistkörper verbessert. Zweitens nützt er dem, über den er gedacht wird. Letztlich nützt er der ganzen Menschheit, da die allgemeine geistige Atmosphäre verbessert wird.
Ein schlechter Gedanke jedoch ist dreimal verflucht. Zuerst schadet er dem Denkenden, indem er seinen Geistkörper ver letzt. Zweitens schadet er dem Menschen, der sein Gegen stand ist. Letztlich schadet er der ganzen Menschheit, indem er die ganze geistige Atmosphäre verdirbt.
Gedanken sind deine wirklichen Kinder. Sei vorsichtig mit dei ner Gedankennachkommenschaft. Ein guter Sohn bringt dem Vater Glück, Ruhm und Ehre. Ein schlechter Sohn bringt seinem Vater Schande und Missachtung. Genauso bringt dir ein edler Gedanke Glück und Freude. Ein schlechter Gedanke bringt dir Kummer und Schmerz. So wie du deine Kinder mit großer Sorgfalt aufziehst, genauso musst du gute erhabene Gedanken mit großer Sorgfalt aufziehen.
Gedanken führen zu Handlung. Schlechte Gedanken schaffen schlechte Taten. Gute Gedanken schaffen gute Taten. Gedanken sind die Quelle aller Taten. Der Gedanke ist das wahre Karma. Denken ist das wahre Handeln. Wenn du alle schlechten Gedanken am Beginn ausrotten kannst, wirst du
Der menschliche Geist
nichts Böses tun. Wenn du sie in der Knospe vernichten kannst, wirst du frei sein von Elend und von den Unbilden dieser Welt. Beobachte deine Gedanken sorgfältig und aufmerksam.
-
Ausrotten von schlechten Gedanken
Zuerst kommt ein negativer Gedanke in den Geist. Dann hat man eine feste Vorstellung. Man erfreut sich daran, diesem negativen Gedanken nachzuhängen. Man lässt ihn im Geist ver weilen. Allmählich fasst der schlE;chte Gedanke, wenn ihm kein Widerstand geleistet wird, im Geist festen Fuß. Dann wird es sehr schwierig, ihn wieder zu vertreiben.
Gedanken werden durch Wiederholung stärker. Wenn man einen schlechten oder einen guten Gedanken einmal hat, hat dieser schlechte oder gute Gedanke die Tendenz, wieder auf zutauchen.
Gedanken derselben Art rotten sich zusammen, wie sich Vögel derselben Art zusammenfinden. Wenn man einen einzigen negativen Gedanken hat, kommen alle möglichen negativen Gedanken dazu und ziehen dich nach unten. Wenn man einen guten Gedanken hat, kommen alle guten Gedanken zusammen und erheben dich.
Kontrolliere deine Gedanken. So wie man nur die guten Früchte aus dem Korb nimmt und die schlechten wegwirft, so bewahre auch die guten Gedanken im Geist und weise die schlechten zurück. Merze Lust, Habgier und Egoismus aus. Bewahre nur reine, heilige Gedanken. Obwohl diese Aufgabe schwierig ist, musst du sie üben. Ohne Schweiß kein Preis!
So wie du Tür und Tor schließt, wenn ein Hund oder ein Esel versuchen hereinzukommen, so schließe auch deinen Geist, bevor ein schlechter Gedanke eindringen und einen Eindruck im Geist hinterlassen kann. Du wirst bald weise werden und ewigen, unendlichen Frieden und Wonne erlangen.
Gedanken sind wie die Wellen am Meer. Sie sind zahllos. Am Anfang verzweifelt man vielleicht. Manche Gedanken verge hen, während andere wie ein Strom hervorquellen. Dieselben alten Gedanken, die einmal unterdrückt waren, zeigen nach einiger Zeit wieder ihr Gesicht. Verzweifle in keiner Phase der Praxis. Innere spirituelle Stärke wird sich allmählich in dir manifestieren. Das kannst du spüren. Am Ende ist dir der Erfolg sicher. Alle yogTs von einst hatten dieselben Schwierigkeiten, die du nun erlebst.
Erkenne klar die schwerwiegenden und zerstörerischen Folgen schlechter Gedanken für dich. Das wird dich achtsam machen, wenn die schlechten Gedanken kommen sollten. In dem Augenblick, in dem sie kommen, übe Gebet oder Japa oder richte den Geist auf ein anderes Objekt göttlicher Gedanken. Eine wirklich ernste Absicht, die schlechten Gedanken vertrei ben zu wollen, wird dich so achtsam sein lassen, dass du sofort aufwachen wirst, selbst wenn sie im Traum auftauchen.
Halte den Geist vollauf beschäftigt. Dann werden keine negati ven Gedanken kommen. Ein englisches Sprichwort besagt: An id/e mind is the devil's workshop {,,Ein untätiges Gehirn ist die Werkstatt des Teufels"). Beobachte den Geist in jeder Minute. Sei immer mit einer Arbeit beschäftigt. Vermeide unnötige Ge spräche und Tratschen. Erfülle den Geist mit erhabenen Ge danken, so wie du sie in der „Bhagavad-gTtä", den upani$ads oder dem „Yogaväsi�tha" findest.
57
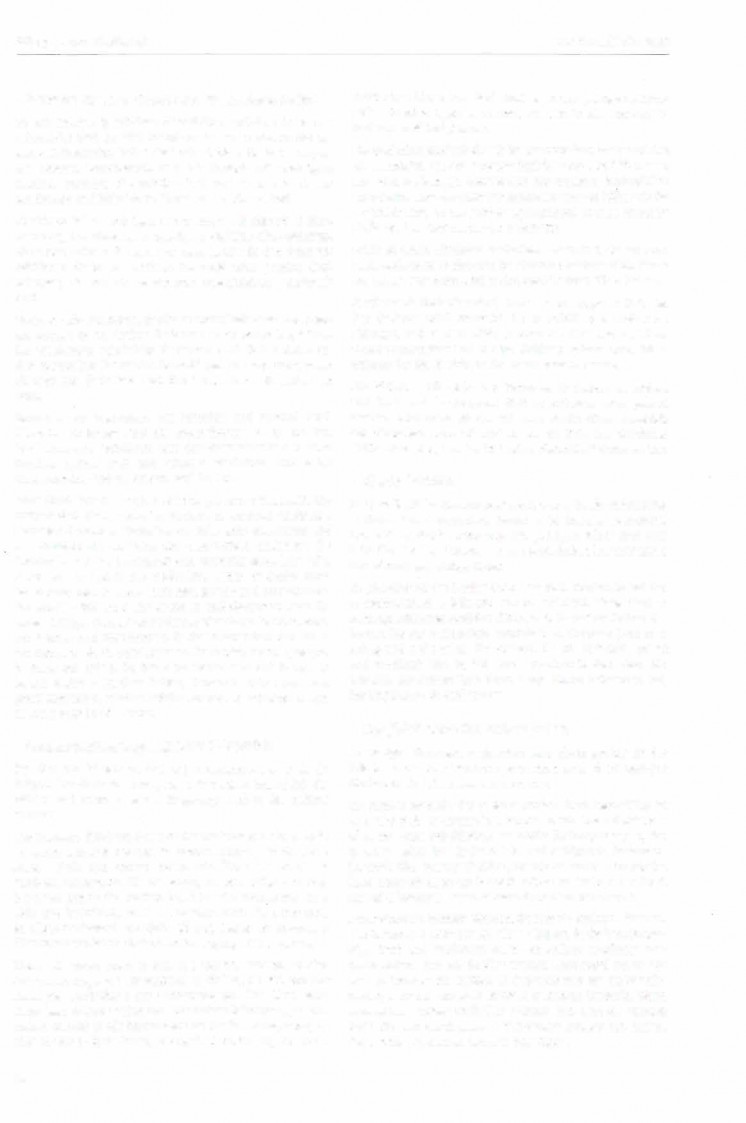
Räja-yoga und Meditation
-
Bewahrung und Einsatz der Gedankenenergie
So wie Energie in müßigen Gesprächen und Getratsche ver schwendet wird, so wird Energie auch durch nutzlose Gedan ken verschwendet. Daher darf kein einziger Gedanke vergeu det werden. Verschwende kein Jota Energie mit unnötigem Denken. Bewahre alle geistige Kraft und verwende sie zur Meditation und hilfreichem Dienst an der Menschheit.
Speichere keine unnötigen Informationen in deinem Gehirn. lerne es, den Geist zu entgeistigen. Verlerne alles Gelernte. Es ist nun nutzlos für dich. Nur dann kannst du den Geist mit göttlichen Gedanken erfüllen. Du wirst neue geistige Kraft erlangen, da nun alle zerstreuten Geiststrahlen gesammelt sind.
Vertreibe alle unnötigen, sinnlosen und missliebigen Gedanken aus deinem Geist. Unnütze Gedanken behindern dein spirituel les Wachstum; missliebige Gedanken sind Stolpersteine für den spirituellen Fortschritt. Du entfernst dich von Gott, wenn du unnötige Gedanken hast. Ersetze sie durch Gedanken an Gott.
Bewahre nur Gedanken, die hilfreich und sinnvoll sind. Sinnvolle Gedanken sind die Sprungbretter zu spirituellem Wachstum und Fortschritt. Lass den Geist nicht in den alten Furchen gehen und sein eigenes Verhalten und seine Gewohnheiten haben. Sei stets auf der Hut.
Rotte durch Innenschau jede Art von gemeinen Gedanken, un nötigen Gedanken, unwerten Gedanken, unreinen Gedanken, sexuellen Gedanken, Gedanken der Eifersucht, des Hasses und der Selbstsucht aus. Rotte alle destruktiven Gedanken der Zwietracht und der Uneinigkeit aus. Entwickle gute, liebevolle, erhabene und göttliche Gedanken. Jeder Gedanke muss konstruktiv sein. Er muss stark sein, positiv und entschlossen. Das geistige Bild muss klar umrissen und abgegrenzt sein. Du musst richtiges Denken entwickeln. Jeder Gedanke muss ande ren Frieden und Trost bringen. Er darf niemandem den leises ten Schmerz oder Unglück bringen. Dann bist du eine gesegne te Seele auf Erden. Du bist eine starke Kraft auf Erden. Du kannst vielen Menschen helfen, Tausende heilen und eine große Zahl von Menschen spiritualisieren und erheben, so wie es Jesus oder Buddha taten.
-
Gedankenübertragung oder Telepathie
Der Gedanke ist sehr ansteckend, noch ansteckender als die Grippe. Der Gedanke bewegt sich. Er verlässt tatsächlich das Gehirn und schwebt herum. Er gelangt auch in die Gehirne anderer.
Das Medium, durch welches sich der Gedanke von einem Geist zu einem anderen bewegt, ist manas. Manas, die Geistsub stanz, erfüllt den ganzen Raum wie Äther und dient als Fortbewegungsmittel für Gedanken, so wie pror:ia das Fort bewegungsmittel für Gefühle ist, Äther das Vehikel für Hitze,
Licht und Elektrizität, und Luft das Vehikel für Töne. Der Geist ist alldurchdringend wie akasa (Äther). Daher ist Gedanken übertragung möglich. Gedankenübertragung ist Telepathie.
Wenn wir einen Stein in den See werfen, erzeugt er eine Aufeinanderfolge von konzentrischen Wellen, die sich von der Stelle des Auftreffens aus weiterbewegen. Das Licht einer Kerze lässt ebenso Wellen von ätherischen Schwingungen ent stehen, die sich in alle Richtungen von der Kerze wegbewegen. Ebenso, wenn ein Gedanke, sei er gut oder schlecht, durch den
58
Der menschliche Geist
Geist eines Menschen läuft, lässt er in der geistigen Atmos phäre Schwingungen entstehen, die sich in alle Richtungen weit und breit fortpflanzen.
Die Gedankengeschwindigkeit ist unvorstellbar. Während sich die Elektrizität mit einer Geschwindigkeit von 186 000 Meilen pro SekL-1nde bewegt, bewegt sich der Gedanke buchstäblich ohne Zeitverlust, die Geschwindigkeit ist sehr viel höher als die der Elektrizität, da das Fortbewegungsmittel, manas, feiner ist als Äther, das Medium für die Elektrizität.
Wenn du einen nützlichen Gedanken aussendest, der anderen helfen soll, muss er eine ganz bestimmte Absicht und ein klares Ziel haben. Nur dann wird er den gewünschten Effekt haben.
Je stärker die Gedanken sind, desto rascher tragen sie Früchte. Der Gedanke wird konzentriert und erhält eine bestimmte Richtung, und in dem Maß, in dem der Gedanke auf diese Weise konzentriert und in eine Richtung gelenkt wird, ist er wirksam für die Absicht, in der er ausgesandt wurde.
Die Methode, hilfreiche und liebevolle Gedanken an andere und überhaupt in die ganze Welt zu schicken, muss gelernt werden. Man muss wissen, wie man Zerstreutheit beseitigt, alle Gedanken sammelt und sie als ein Bataillon hilfreicher Kräfte ausschickt, um der leidenden Menschheit Gutes zu tun.
-
Klares Denken
Der gewöhnliche Mensch weiß nicht, was es heißt, tief nachzu denken. Seine Gedanken laufen wild herum. Manchmal herrscht im Geist Verwirrung. Die geistigen Bilder sind sehr trüb. Nur Denker, Philosophen und yogTs haben klar umrissene und eindeutige geistige Bilder.
Es gibt sehr wenige Denker auf dieser Welt. Denken ist bei den meisten Menschen belanglos und oberflächlich. Tiefes Denken benötigt intensives sadhana (Übung). Es bedarf unzähliger Ge burten, bis der Geist richtig entwickelt ist. Nur dann kann man richtig und tief denken. Ein Mensch, der die Wahrheit spricht und moralisch rein ist, hat immer machtvolle Gedanken. Ein Mensch, der seinen Zorn durch lange Übung beherrscht hat, hat ungeheure Gedankenkraft.
-
Der jnänT ohne Gedankenwellen
Je weniger Gedanken vorhanden sind, desto größer ist der Friede. Je weniger Wünsche vorhanden sind, desto weniger Gedanken sind da. Denke immer daran.
Ein reicher Mensch, der in einer großen Stadt beschäftigt ist und sehr viele Gedanken hat, hat einen ruhelosen Geist trotz all seiner Annehmlichkeiten; ein sadhu (Mönch) dagegen, der in einer Höhle im Himälaya lebt und erfolgreich Gedanken kontrolle übt, ist sehr glücklich, obwohl er arm ist. Umgekehrt kann natürlich auch ein Mensch mitten im Treiben der Stadt zur Ruhe kommen, wenn er seine Gedanken beherrscht.
Jeder Gedanke weniger gibt dem Geist mehr Kraft und Frieden. Das Reduzieren auch nur um einen einzigen Gedanken gibt gei stige Kraft und Frieden im Geist. Am Anfang empfindet man das vielleicht nicht so, da der Verstand nicht subtil ist; es gibt aber im Inneren ein spirituelles Thermometer, das die Vermin derung auch nur um einen einzigen Gedanken feststellt. Wenn man einen einzigen Gedanken weniger hat, wird die geistige Kraft, die man durch diese Verminderung erreicht hat, helfen, den zweiten Gedanken leicht zu beseitigen.
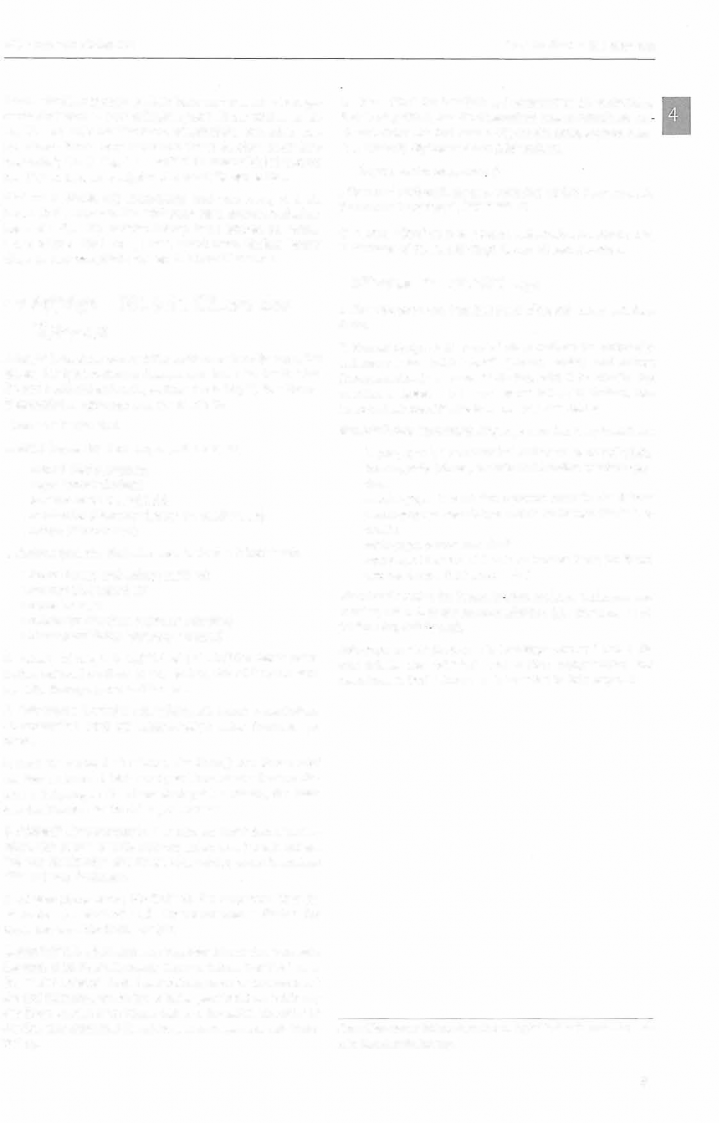
Räja-yoga und Meditation
Durch ständiges intensives Üben kann man wellenlos bzw. ge dankenfrei werden. Der wellenlose yog, hilft der Welt mehr als der Mensch auf einer Plattform. Gewöhnliche Menschen kön nen diesen Punkt kaum verstehen. Wenn du ohne Gedanken wellen bist, durchdringst und erfüllst du tatsächlich jedes Atom des Universums, du reinigst und erhebst die ganze Welt.
Wellenlose jnönTs, wie Ja(Jabharata und Vämadeva, sind bis heute nicht vergessen. Sie errichteten keine asrams. Sie hielten keine Vorträge. Sie veröffentlichten keine Bücher. Sie hatten keine Schüler. Und doch, welch ungeheuren Einfluss hatten diese wellenlosen JnönTs auf den Geist der Menschen.
-
-
-
-
A�täriga - Die acht Glieder des räja-yoga
-
A?töriga bezeichnet die acht Stufen/Glieder des röja-yoga, des Weges der systematischen Analyse und Kontrolle des Geistes . Sie sind beschrieben im „Yoga-sütra" des Patafijali, dem Grund lagenwerk des röja-yoga und der Meditation.
Diese acht Stufen sind:
-
Yama (Regeln für den Umgang mit anderen)
-
ahimsö (Nichtverletzen)
-
satya (Wahrhaftigkeit)
-
brahma-carya (Keuschheit)
-
aporigraha (Nichtannehmen von Geschenken)
-
asteyo (Nichtstehlen)
-
-
Niyomo (Gebote, Verhaltensregeln für das Privatleben):
-
sauca (innere und äußere Reinheit)
-
santo?a (Zufriedenheit)
-
topas (Askese)
-
svödhyöya (Studium religiöser Schriften)
-
1svora-prar:iidhöna (Verehrung Gottes)
-
-
Äsana (Stellung, Haltung): Wichtig ist, die Wirbelsäule frei zu halten, aufrecht zu sitzen. Brust, Nacken, Hals bilden eine gera de Linie. Bewegungslos und bequem.
-
Prär:iäyäma (yogische Atemübungen): Durch verschiedene Atemtechniken wird die Lebensenergie unter Kontrolle ge- bracht.
-
Pratyähara (das Zurückziehen [der Sinne]): Den Sinnen wird der Weg zu ihren Objekten versperrt bzw. sie werden von die sen zurückgezogen. Auf dieser Stufe geht es darum, den Geist von den Sinnen, die ihn stören, zu trennen.
-
Dhöraf)ö (Konzentration): Hier wird der Geist darauf vorbe reitet, sich besser zu konzentrieren, indem man ihn z. B. auf ein äußeres Objekt oder eine innere Idee richtet, unter Ausschluss aller anderen Gedanken.
-
Dhyäna (Versenkung, Meditation): Kontemplation über die Attribute einer Gottheit o. Ä. Ununterbrochenes Fließen der Gedanken zum Meditationsobjekt.
-
Samädhi (Überbewusstsein): Samödhi ist der überbewusste Zustand. Er ist über alle Beschreibung erhaben. Der Geist kann ihn weder erfassen noch beschreiben, denn er transzendiert die drei Elemente, die während jeder gewöhnlichen Erfahrung der Sinne präsent sind: Raum, Zeit und Kausalität. Samödhi ist
Die acht Glieder des räja-yoga
Im „Yoga-sütra" des Patafijali wird saf!lyama als ein technischer Begriff eingeführt, der die Gesamtheit bzw. unmittelbare Auf einanderfolge der drei letzten Glieder des a?töriga-yoga, näm lich dhörar:iö, dhyöna und samödhi umfasst.
trayam ekatra saf!lyamah II
Sammlung bezeichnet". [Yoga-sütra 3.4]
„Diese drei (dhörar:iö, dhyöna, samödhi) werden zusammen als
(Die „Yoga-sütra" ist in vier Kapitel aufgeteilt: 1. Samädhi-päda,
II. Sädhana-päda, III. Vibhüti-päda und IV. Kaivalya-päda.)
-
Räja-yoga und kuo<;ialin1-yoga
-
Der röja-yoga von Patafijali beschäftigt sich direkt mit dem Geist.
-
Kur:iljolin1-yoga sucht zuerst die Beherrschung des prör:ia (der Lebensenergie), reinigt naljTs (Energiekanäle} und cakras (Energiezentren) und erweckt die kur:iljalinT. Er beschreibt das psychische System und kennt verschiedene Techniken. Das Hauptziel ist ebenfalls die Beherrschung des Geistes.
Kur:ilja!inT-yoga hat Unterteilungen je nach den Hauptpraktiken:
-
hatha-yoga: Insbesondere bei Anfängern sollte auf kriyös, ösanas, prör:iöyömos, mudrös und bandhas geachtet wer den.
-
mantra-yoga: benutzt den Klang zur Kontrolle des Geistes
-
yantra-yoga: verwendet geometrische Formen für die Me ditation.
-
näda-yoga: verwendet Musik
-
!aya-yoga: Hier wird sich auf den inneren Klang (anöhota)
-
und das innere Licht konzentriert.
Manchmal werden im kur:iljalinT yoga mehrere Techniken ver bunden, wie z. B. in der cakro-Meditation (vgl. hierzu das Kapi tel über kur:iljalinT yoga).
Röja-yoga und hatha-yoga sind a?töriga-yoga und haben die acht Glieder, die praktiziert werden. Die Hauptprinzipien sind dieselben. Es besteht nur ein Unterschied im Schwerpunkt.
das Ziel aller Existenz. Alle Lebewesen bewegen sich auf dieses Anm.: Literaturempfehlungen zu diesem Kapitel findest du unter den Lite-
Ziel zu. raturhinweisen im Anhang.
59

Raja Yoga und Meditation Notizen
60
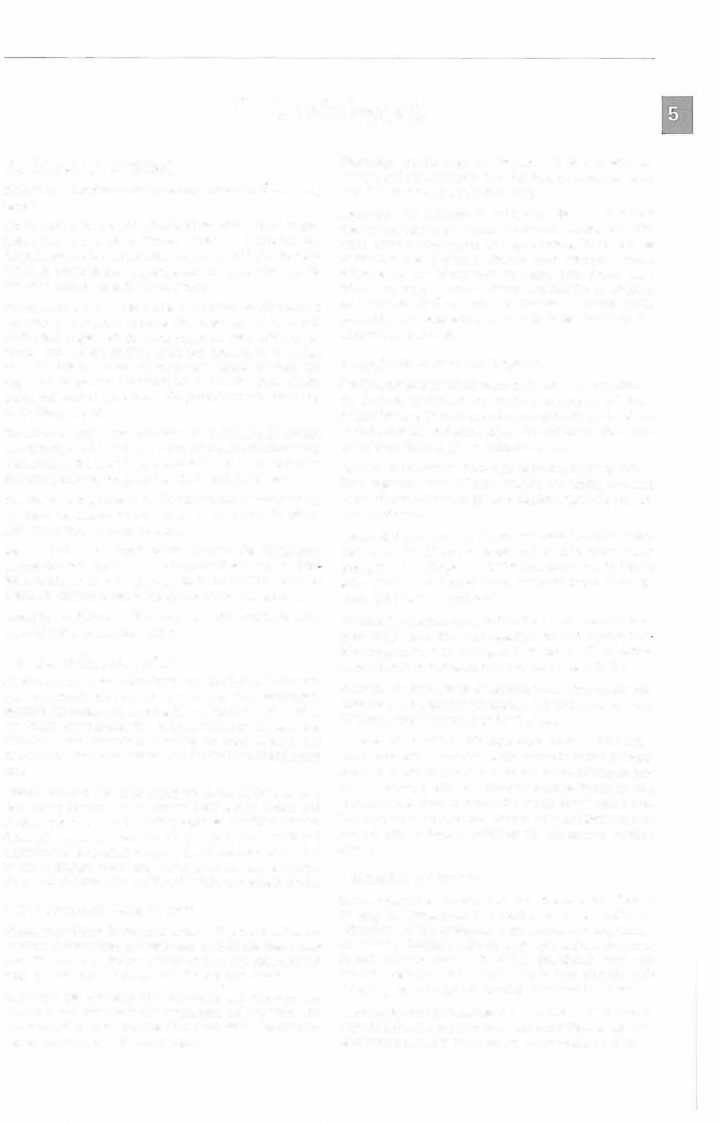
s.1 Bhakti (Hingabe)
5. Bhakti-yoga
Jfiäna-yoga ist der yaga der Weisheit. Es ist der Weg der Analyse und Verweigerung. Es ist der Pfad der endlosen Nega
(5.1-5.11: vgl. ,,Swami Sivanandas Inspiration & Weisheit für Menschen von
heute")
Bhakti heißt, in Gott' zu sein. Bhakti ist das Fließen von Hingabe gleich dem Fließen eines Flusses. Bhakti ist Kontinuität von Hingabe, so wie Öl kontinuierlich aus einem Gefäß in ein ande res fließt. Bhakti ist das Hingezogensein des }Tva zu Gott, so wie die Nadel zum Magnet hingezogen wird.
Bhakti ist Liebe um der Liebe willen. Der Gläubige will Gott und nur Gott. Es liegt keine selbstsüchtige Erwartung darin. Es gibt auch keine Angst. Hat der Sohn Angst vor seinem Vater, der Richter ist? Hat die Ehefrau Angst vor ihrem Gatten? So hat auch der Gläubige nicht im mindesten Furcht vor Gott. Die Angst vor Vergeltung verschwindet in ihm. Er spürt, glaubt, denkt und stellt sich vor, dass sein i$tam (Gott) ein Ozean von Liebe bzw. prem ist.
Bhakti transformiert den Menschen in Göttlichkeit. Sie infiziert den Gläubigen mit göttlichem prem (Liebe). Sie gibt ihm ewige Befriedigung. Sie macht ihn vollkommen. Sie lenkt den Geist von Sinnesobjekten weg. Sie lässt ihn in Gott frohlocken.
Emotionale Erregung ist nicht Hingabe an Gott. Hingabe ist rei ne Liebe. Fanatismus ist keine Hingabe. Fanatismus ist Wahn sinn. Fanatismus ist bloße Erregung.
Bhakti ist nicht nur Emotionalität, sondern das Einstimmen sowohl des Willens als auch des Denkvermögens auf das Gött liche. Bhakti ist höchste Liebe zu Gott. Sie erblüht später zu Jfiäna. Sie führt zu Unsterblichkeit und Gottverwirklichung.
Bhakti ist die direkte Annäherung an das Ideal durch das Herz. Liebe ist jedem Menschen natürlich.
-
Bhakti steht jedem offen
Bhakti kann unter allen Umständen und von jedem gleicherma ßen praktiziert werden. Lernen, strenge Askeseübungen, Studium der vedas und ein brillanter Verstand sind nicht nötig, um bhakti oder Hingabe zu erlangen. Es bedarf hingegen des ständigen und lebendigen Denkens an Gott, gepaart mit Glauben und Vertrauen. Daher steht der Pfad von bhakti jedem offen.
Ni$äda stammte aus einer niedrigen Kaste; Sabari war eine Bauersfrau; Dhruva war ein ungebildeter Junge; Vidura und Sudämä waren sehr arm; VibhT$ar:ia war ein hässlicher räk$asa (Dämon); Hanumän war ein Affe; Jatäyu war ein Vogel; Gajendra war ein Elefant; die gopTs von Vrndävana waren nicht in die vedischen Riten eingeweiht; aber sie alle erreichten Gottverwirklichung aufgrund ihrer Hingabe und Selbstaufgabe.
-
Der einfachste Weg zu Gott
Bhakti ist einfacher als irgendein anderer Weg der Annäherung an Gott. In jfiäna-yoga und räja-yoga besteht das Risiko, dass man fällt. Auf dem Pfad der Hingabe gibt es kein Risiko, da der Gläubige volle Unterstützung und Hilfe von Gott erhält.
Menschen, die den Weg von jfiäna-yaga und räja-yaga be schreiten, sind der Gefahr ausgesetzt, stolz auf ihre Kräfte und ihre Weisheit zu sein. Bhaktas sind bescheiden. Bescheiden heit ist die Grundlage für bhakti-yoga.
tion. Dies ist ein sehr schwieriger Weg.
Räja-yoga ist auch schwierig. Es ist, als wollte man die Wellen des Ozeans glätten. Man muss alle Gedankenwellen zum Still stand bringen. Karma-yoga ist auch schwierig. Es ist wie das Erklimmen des höchsten Gipfels. Man braucht enorme Willenskraft. Nur bhakti-yoga ist leicht. Gott streckt seine Hände aus, um dich aus dem Sumpf von sarnsära zu erheben. Du musst Seine Hand fest erfassen. Aber eines ist dabei absolut wesentlich: Du darfst keinen anderen Gedanken haben als den an Gott und Gott allein.
-
-
Einpünktigkeit in der Hingabe
Das Kind denkt allein an die Mutter. Ein leidenschaftlich lieben der Ehemann denkt allein an seine Frau. Ein habgieriger Mensch denkt allein an sein Geld. So sollte auch der Gläubige in seinem Herzen allein das Bild seines i$tam (Gottes) haben. Dann kann er leicht ein darsana (Vision Gottes) erfahren.
Objekte sind die Feinde Gottes. Zu starke Anhaftung an Söhne, Frau, Eigentum, Vieh, Häuser, Freunde, Verwandte usw. sind Feinde Gottes. Man muss äußeren Objekten gegenüber Gleich mut entwickeln.
Denke nicht zuviel an den Körper und seine Bedürfnisse. Ge danken an den Körper, an Essen und zu viele Gedanken an Mann, Frau und Kinder lassen dich Gott vergessen. Du kannst keine göttlichen Gedanken haben, wenn du Gedanken an an ätmas (Nichtselbst-Dinge) hast.
Ein Gläubiger, der manchmal Gott liebt und manchmal auch Frau, Sohn, Geld, Haus, Vieh und Eigentum, wird ein vyabhicäri,:,T bhakta genannt. Die Liebe ist geteilt. Ein kleiner Teil des Geistes gehört Gott. Der Rest gehört der Familie und dem Besitz.
Gott wird nur dann Diener des bhakta, wenn Letzterer sich voll kommen und bereitwillig hingegeben hat. Gott unterzieht den Gläubigen strengen Proben und Prüfungen.
Im Allgemeinen hält der/die Aspirant/in, bewusst oder unbe wusst, wissentlich oder nicht, einige Wünsche nach Belohnung aufrecht. Er will nicht ganz und gar mit seinen Wünschen bre chen. Deswegen wird die Hingabe nicht vollkommen und bedingungslos. Deshalb kommt die Gnade Gottes nicht herab. Wenn auch nur ein Atom von Wunsch oder lchdenken vorhan den ist, gibt es keine Möglichkeit für vollständige göttliche Gnade.
-
Hingabe und Wunsch
Der selbstsüchtige Wunsch steht dem Wachsen von Hingabe im Weg. Die Hingabe an Gott wächst, wenn man weltlichen Wünschen entsagt. Entsagung ist die Quintessenz hingebungs voller Liebe. Göttliche Liebe trägt kein Element des Wunsches in sich. Hingabe kann nicht neben irgendeiner Form von Wunsch bestehen, nicht einmal neben dem Wunsch nach Befreiung. Der Gläubige will nur Gott allein und Ihm dienen.
Der Gläubige liebt Gott und dient Ihm und Seiner Schöpfung. Er bemüht sich nicht mehr bewusst um mukti (Befreiung). Aber Gott sendet dem, der an Ihn glaubt, mukti unaufgefordert.
61
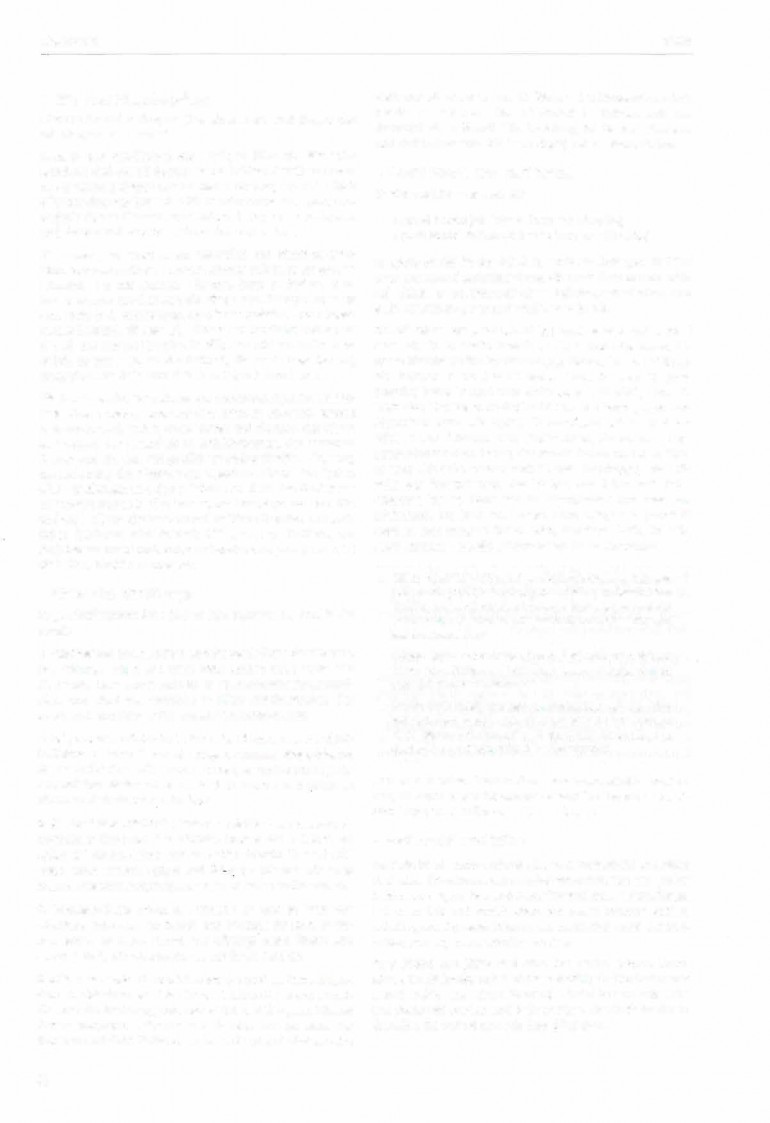
Bhakti-yoga
-
Wie man Hingabe pflegt
Manche Menschen fragen: ,,Wie können wir Gott lieben, den wir nie gesehen haben?"
Lebe in der Gesellschaft von Heiligen; höre die /T/äs ([Ge schichten der] Spiele) Gottes; lies die heiligen Schriften; vereh re Ihn zuerst in Seinen verschiedenen Formen, die in der Welt offenbar sind; verehre jedes Bild von Gott oder dem guru; wie derhole Seinen Namen; singe Seinen Ruhm; besuche asrams und Tempel und du wirst Liebe zu Gott entwickeln.
Alles muss getan werden, um das Gefühl von bhakti zu erwe cken. Baue einen Altar in deinem Zimmer auf; halte ihn sauber; schmücke ihn mit Blumen, Pflanzen, Statuen, Bildern, Sym bolen; brenne Räucherwerk ab; zünde eine Öllampe an; trage eine mälä (ind. Gebetskette, die oft aus rudräk�a- oder tulas, Samen besteht). All das wirkt günstig auf den Geist und erhebt ihn. All das erzeugt Hingabe. Es hilft, den nötigen bhäva oder Gefühl zu erzeugen, um die Gottheit, die verehrt werden soll, anzurufen. Der Geist wird sich dann leicht konzentrieren.
Die Praxis rechten Verhaltens, von sat-sanga, japa (Wiederho lung eines mantra), smarar:,a (Sicherinnern an Gott), kTrtana (mantra-Singen), Gebet, Gottesdienst und Ritualen, der Dienst an Heiligen, der Aufenthalt an Wallfahrtsorten, der Dienst an Armen und Kranken mit göttlichem bhäva (Gefühl, Hingabe), die Einhaltung der Pflichten des täglichen Lebens, das Opfern aller Handlungen und deren Früchte an Gott, das Gefühl der Gegenwart Gottes in allen Wesen, das Verneigen vor dem Bild und vor Heiligen, der Verzicht auf weltliche Freuden und welt lichen Reichtum, Wohltätigkeit, Mäßigung und Gelübde, das Praktizieren von ahirrsä, satya und brahma-carya - all das wird dir helfen, bhakti zu entwickeln.
-
Bhävas im bhakti-yoga
Es gibt fünf verschiedene bhävas (Einstellungen zu Gott) in der
bhakti:
-
Sänta-bhäva ist eine ruhige und friedvolle Form der Hingabe. Der Gläubige hüpft und tanzt nicht umher, auch wenn sein Herz voller Liebe und Freude ist. Er ist emotional sehr ausgegli chen und sieht das Göttliche in allem gleichermaßen. Der große Held und Krieger Bhi?ma war ein sänta-bhakta.
-
Däsya-bhäva drückt sich in Form des Dienens aus. Der devo te Affengott Hanumän war ein ausgesprochener däsya-bhakta. Er diente Sri-räma mit ganzem Herzen, er wollte ihn in jeder erdenklichen Weise erfreuen. Er fand Freude und Glück im Dienst an Gott als seinem Meister.
-
Sakhya-bhäva drückt die Hingabe an Gott in Form von freund schaftlicher Liebe aus. Der Gläubige bewegt sich mit Gott auf
,,gleicher" Ebene. Arjuna war ein sakhya-bhakta. Er sah in Sr1- kr?1Ja einen Freund. Arjuna und Sri kr?i:ia pflegten wie enge Freunde zusammenzusitzen, zu essen, zu reden und zu gehen.
-
Vätsalya-bhäva drückt die Hingabe an Gott in Form von elterliche Liebe aus. Für Yasodä war Sri-kf?!Ja ihr Kind. In die sem bhava ist keine Furcht. Der Gläubige dient, füttert und umsorgt Gott, wie eine Mutter es mit ihrem Kind tut.
-
Mädhurya-bhäva (bzw. känta-bhava) drückt die Beziehung zu Gott als Geliebten aus. Dies ist die höchste Form von bhakti. Dies war die Beziehung zwischen Rädhä und Sri-kf?!Ja. Dies ist ätma-samarpar:,a. Liebender und Geliebte werden eins. Der Gläubige und Gott fühlen sich eins und halten trotzdem eine
62
Bhakti
Getrenntheit aufrecht, um die Wonne des Liebesspiels mitei nander zu erfahren. Dies ist Einheit in Getrenntheit und Getrenntheit in Einheit. Die Beziehung ist die von Ehemann und Gattin. Jayadeva, Mirä und Äi:ic;Jä! hatten diesen bhäva.
-
-
Aparä bhakti und parä bhakti
Es gibt zwei Arten von bhakti:
-
aparä bhakti (niedrigere Form der Hingabe)
-
parä bhakti (höhere/höchste Form der Hingabe)
In aparä bhakti ist der Gläubige noch ein Anfänger. Er führt zwar Rituale und Zeremonien aus, aber sein Herz ist nicht wirk lich dabei. Er ist Anhänger einer Religionsgemeinschaft und sieht auf Anhän-ger anderer Religionen herab.
Ein Gläubiger vom parä-bhakti-Typ, umfasst alles und schließt alles mit ein. Er besitzt kosmische Liebe bzw. visva-prem. Die ganze Welt ist für ihn Vrndävana (hlg. Gebiet, in dem Sri-km1a als Kuhhirte seine Jugend verbrachte). Er besucht (bzw. braucht) keine Tempel zum Gottesdienst. Er fühlt, dass die Welt eine Manifestation Gottes ist und alle Bewegungen und Aktivitäten Seine /T/ä (Spiel). Er empfindet keinen Ekel vor Fäkalien und Schmutz, dem Obdachlosen, Kastenlosen, dem Straßenkehrer, dem Bettler, der Prostituierten oder dem Dieb. Er sagt: ,,Ich sehe meinen Gott überall. Hari (Vi?IJU) spielt die Rolle der Prostituierten, des Diebes, des Schurken!" Seine erhabene innere Einstellung ist allumfassend und alles ein schließend. Das kann mit Worten nicht adäquat ausgedrückt werden. Man muss es fühlen. Mirä, Gauräriga, Hafiz, Tulsidäs, Kabir, Rämdäs - sie alle erfreuten sich dieses Zustandes.
Nämdev [ca. 1270-1350, heiliger Dichter aus Mahärä$1;fa] sagte zum Hund: ,,0 Vitt):1ala (Vi$r:iu), mein Lieber, in Gestalt eines Hundes, lauf nicht mit dem trockenen Brot weg. Es wird dei nem zarten Hals schaden. Bitte lass mich noch etwas Ghee auf das Brot schmieren."
SrT-rämakm1a Paramaharrisa [1836-1886] verbeugte sich vor einem unberührbaren Mädchen und sagte: ,,0 Mutter KälT! Ich sehe dich in diesem Mädchen."
Eknäth [1533-1599], ein bhakta aus MahäräWa, gab dem Dieb freiwillig auch seinen Ring, als jener in sein Haus kam: ,,0 Dieb! Nimm auch diesen Ring. Deine Pflicht ist es, Dinge zu stehlen. Du bist Kr$r:ia. Halte diese IT/ä aufrecht."
Hast du den hohen Zustand dieser erhabenen bhaktas verstan den, die einen neuen Blickwinkel haben? Der Tag wird auch für dich kommen. Bemühe dich. Streng dich an.
-
-
Parä bhakti und jnäna
Para bhakti ist nichts anderes als jfiäna. Para bhakti und jfiäna sind eins. Sri-sarikara, ein kevalädvaita-jfiän,, war ein großer bhakta von Vi?IJU, Siva und Devi. Sri-rämakr?r:ia Paramaharrisa betete zu Käll und erhielt jfiäna von Svämi Totapuri, seinem advaita-guru. Appayya Dik?itar, ein berühmter jfiänT aus Süd indien, war ergebener bhakta von Siva.
Parä bhakti und Jfiäna sind eins. Der einzige leichte Unter schied ist: Ein bhakta gebraucht sein Gefühl; ein Jfiän, gebraucht seinen Willen und seinen Verstand. Bhakti beginnt mit Liebe und jfiäna mit Denken und Selbstanalyse. Das Ende beider ist dasselbe, die Vereinigung mit dem Göttlichen.
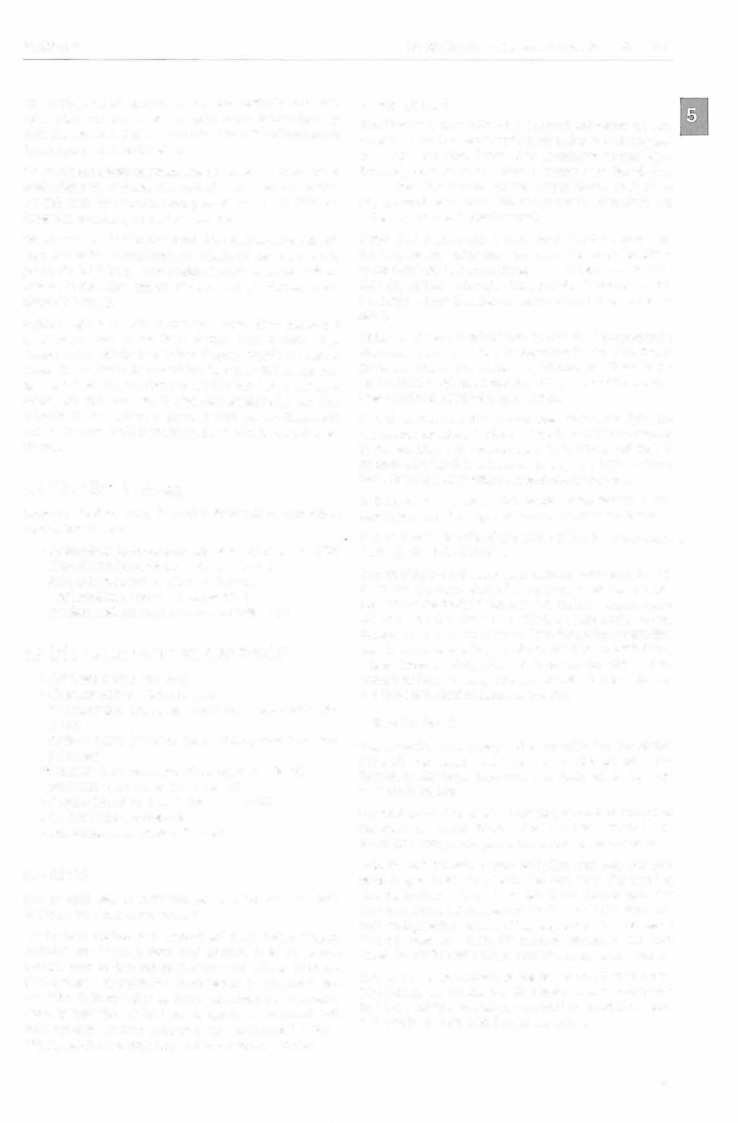
Bhakti-yoga
Ein Gläubiger zieht sich zusammen. Ein vedantT weitet sich. Jener zieht sich zusammen und geht durch Selbstaufgabe in Gott ein. Dieser weitet sich und wird eins mit brahman durch Anstrengung und Identifikation.
Die Frucht von bhakti istjfiana. Jfiana intensiviert bhakti. Selbst großejfianis wie Sarikara, Madhusüdana und Sukadeva wende ten sich nach ihrer Verwirklichung bhakti zu, um die Süße der liebenden Beziehung zu Gott zu genießen.
Wissen und Weisheit werden durch das Praktizieren von bhakti yaga von selbst heraufdämmern. Bhakti ist der angenehme, glatte, direkte Weg zu Gott. Bhakti ist schön und freudvoll am Anfang, in der Mitte und am Ende. Sie bringt höchste, unver gängliche Wonne.
Entzünde göttliche Liebe in deinem Herzen, denn das ist der unmittelbare Weg in das Reich Gottes. Bete zu Gott. Singe Seinen Ruhm. Wiederhole Seinen Namen. Werde ein Mittler Seiner Gnade. Suche Seinen Willen. Tu Seinen Willen. Gib dich Seinem Willen hin. Du wirst eins werden mit dem kosmischen Willen. Gib dich Gott hin. Er wird dein Wagenlenker auf dem Schlachtfeld des Lebens werden. Er wird deinen Wagen gut lenken. Du wirst das Ziel erreichen, den Wohnsitz unsterblicher Wonne.
-
-
Die fünf bhävas
Bhava ist die Einstellung, die der/die Suchende zu Gott haben oder entwickeln kann.
-
sänta-bhäva (Gott verehren als reinen Frieden und Stille)
-
däsya-bhäva (Gott verehren als Sein Diener)
-
sakhya-bhäva (Gott verehren als Freund)
-
vätsa/ya-bhäva (Gott verehren als Kind)
-
mädhurya-bhäva (Gott verehren als Geliebte/n)
-
-
Die neun Formen der bhakti
-
srava(Jam (Hören von Gott)
-
kirtanam (Seinen Namen singen)
-
smara(Jam (ständiges Denken und Wiederholen Seines Na mens)
-
päda-sevanam (Dienst zu Seinen Füßen; Altar- bzw. Tem- peldienst)
-
arcanam (Darbringen [von Blumen]; Gottesdienst)
-
vandanam (sich [vor Gott) verneigen)
-
däsyam (Dienst für Ihn, als Sein Instrument)
-
sakhyam (Gott als Freund)
-
ätma-nivedanam (völlige Hingabe)
-
-
Gott
-
Wer ist Gott? Was ist Gott? Gibt es einen Gott? Wo ist Gott? Wie kann man Gott verwirklichen?
Der Mensch möchte eine Antwort auf diese ewigen Fragen. Natürlich gibt es einen Gott. Gott existiert. Er ist die einzige Realität. Gott ist dein Schöpfer, Retter und Erlöser. Er ist all durchdringend. Er wohnt in deinem Herzen. Er ist immer in dei ner Nähe. Er ist dir näher als deine Halsschlagader oder deine Nase. Er liebt dich. Er kann mit dir sprechen. Du kannst Gott nicht mit dem Verstand aufspüren. Aber du kannst Ihn durch Fühlen, Meditation, Erfahrung und Verwirklichung finden.
Die fünf bhävas • Die neun Formen der bhakti • Gott
-
-
Wer ist Gott?
Eine Öllampe spricht nicht, aber sie strahlt und verbreitet Licht um sich herum. Der Jasmin spricht nicht, aber er verbreitet sei nen Duft nach allen Seiten. Der Leuchtturm schlägt keine Trommel, aber er schickt dem Seefahrer sein freundliches Licht. Das Ungesehene schlägt keinen Gong, aber Seine Allgegenwart kann vom leidenschaftslosen Menschen mit Unterscheidungskraft gespürt werden.
Hinter allen Namen und Formen steht die eine namen- und formlose Essenz. Hinter allen Herrschern steht der eine höchs te Herrscher der Herrscher. Hinter allen Lichtern steht das eine Licht des Lichtes. Hinter allen Klängen steht die klanglose erha bene Stille. Hinter allen Lehrern ist der eine erhabene guru der gurus.
Hinter all diesem Vergänglichen ist das eine unvergängliche Absolute. Hinter all diesen Bewegungen ist das eine bewe gungslose Unendliche. Hinter Zeit, Minuten und Tagen ist die eine zeitlose Ewigkeit. Hinter dem Hass, den Aufständen und Kriegen steht die eine verborgene Liebe.
Gott ist die Gesamtheit all dessen, was existiert, des Unbeleb ten wie des Belebten, des Bewussten wie des Unbewussten. Er ist frei von Übel und Begrenzungen. Er ist allgegenwärtig, all mächtig, allwissend. Er hat keinen Anfang, keine Mitte und kein Ende. Er weilt in allen Wesen. Er kontrolliert von innen.
Gott ist das Vollkommene. Gott ist die einzige Realität in die sem Universum. Die Dinge existieren durch das Licht Gottes.
Gott ist immer lebendig. Alles beruht auf Ihm. Er ist von nichts abhängig. Er ist die Wahrheit.
Gott ist Eride und Ziel eines jeden sadhana (spiritueller Praxis). Er ist das Zentrum, dem alles zustrebt. Er ist die höchste Absicht und das höchste Gut der Welt. Du hast Hunger. Es gibt Nahrung, um den Hunger zu stillen. Du hast Durst. Es gibt Wasser, um den Durst zu löschen. Du möchtest immer glücklich sein. Es muss etwas geben, um dieses Bedürfnis zu befriedigen. Dieses etwas ist Gott, eine Verkörperung von Glück. Gott, Unsterblichkeit, Freiheit, Vollkommenheit, Frieden, Wonne und Liebe sind gleichbedeutende Begriffe.
-
Was ist Gott?
Was ist Gott? Schwer zu sagen. Aber wenn ich den Fluss Garigä (Ganges), den Jasmin oder den blauen Himmel sehe, das Zwitschern der Vögel höre oder den Honig schmecke, dann weiß ich: Es ist Gott!
Das Höchste ist nicht wirklich erklärbar, dennoch versuchen es die Gelehrten immer wieder. Aber kein intellektuelles Kon strukt kann Gott jemals ganz erfassen bzw. ist absolut wahr.
Jeder Mensch hat seine eigene Vorstellung von Gott. Der Gott eines Kriegers trägt einen Helm. Der Gott eines Chinesen hat eine flache Nase, einen dicken Bauch und Schlitzaugen. Der Gott eines Hindu hat Zeichen auf der Stirn und trägt eine japa mala (Gebetskette) und eine Blumengirlande. Der Gott eines Christen trägt ein Kreuz. Für manche Menschen hat Gott Flügel. Ein Büffel wird denken, Gott ist ein sehr großer Büffel.
Eine solche menschenähnliche Vorstellung von Gott ist natür lich kindisch. Das Größte und Wichtigste auf der ganzen Welt ist es, die richtige Vorstellung von Gott zu entwickeln, denn dein Glaube an Gott lenkt dein ganzes Leben.
63
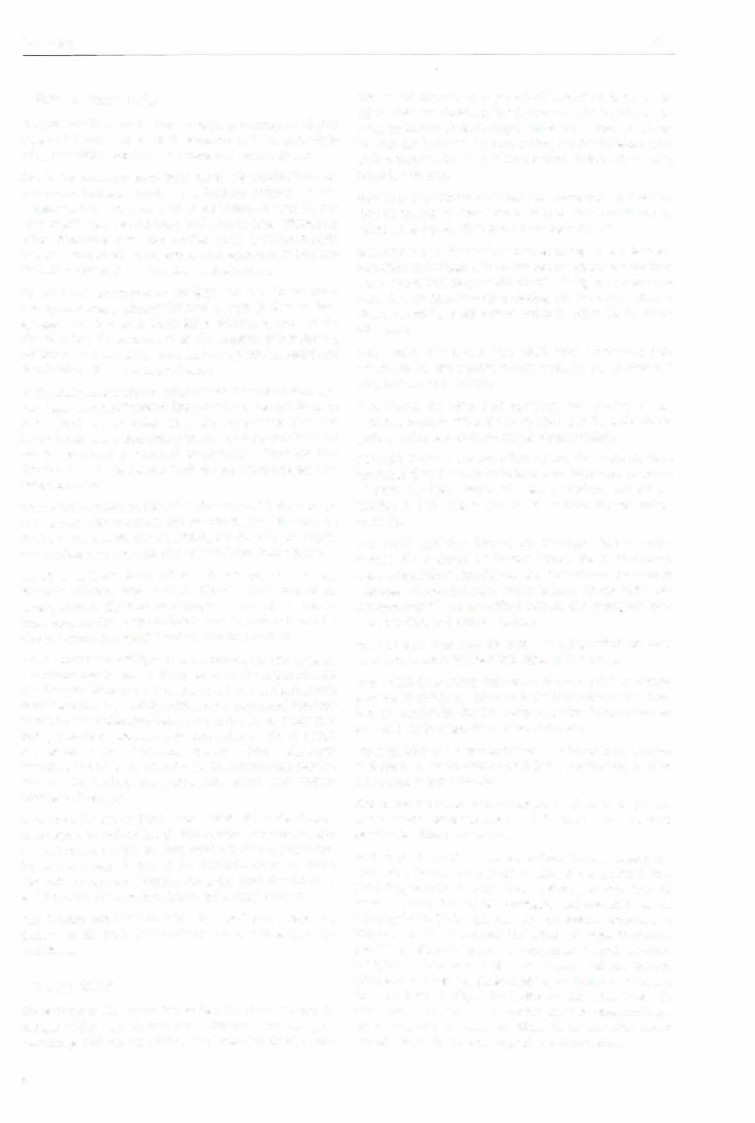
Bhakti-yoga
-
Gibt es einen Gott?
Gott ist jenseits menschlichen Vorstellungsvermögens, aber er ist eine lebendige Wirklichkeit. Brahman ist keine metaphysi sche Abstraktion, sondern das vollste und reellste Wesen.
Die Gotteserfahrung kann nicht durch wissenschaftliche Ex perimente bewiesen werden. Das Absolute sprengt das Fas sungsvermögen auch des größten Gelehrten. Es entzieht sich dem Zugriff auch des stärksten Intellekts. Es wird erfahren als reines Bewusstsein, wo der Intellekt stirbt, Gelehrtheit stirbt und das gesamte Wesen als solches sich vollständig in Ihm ver liert. Alles wird verloren und alles wird gefunden.
Du möchtest Laborbeweise? Wirklich sehr gut! Du möchtest den grenzenlosen, alldurchdringenden Gott in deinem Rea genzglas und in deinen Chemikalien begrenzen. Gott ist die Quelle deiner Chemikalien. Er ist das Substrat deiner Atome, Elektronen und Moleküle. Ohne Ihn bewegt sich kein Atom und kein Elektron. Er ist der innere Lenker.
Gott verleiht unseren Sinnen Kraft, unserem Geist Wahrnehmungs vermögen, unserem Verstand Unterscheidung, unseren Gliedern Kraft. Durch Seinen Willen leben und sterben wir. Aber der Mensch stellt sich selbstgefällig vor, dass er der Handelnde und der Erlebeflde sei. Der Mensch ist ein bloßes Nichts vor dem Allmächtigen, der lenkenden Kraft, die die Bewegung des Uni versums steuert.
Gottes Wille drückt sich überall als Gesetz aus. Die Gesetze der Schwerkraft, der Kohäsion, der Relativität, der Ursache und Wirkung, die Gesetze der Elektrizität, der Chemie, der Physik, alle physikalischen Gesetze sind Ausdruck von Gottes Willen.
Da wir alles in der Natur mit dem Gesetz von Ursache und Wirkung erklären, muss auch die Natur in ihrer Gesamtheit erklärt werden. Sie muss eine Ursache haben. Diese Ursache muss etwas anderes sein als die Wirkung. Es muss sich um eine übernatürliche Wesenheit handeln, nämlich um Gott.
Natur ist nicht ein zufälliges zusammentreffen von Ereignissen, ein Durcheinander von Zufällen, sondern etwas Geordnetes. Die Planeten bewegen sich geordnet in ihren Umlaufbahnen; Samen wachsen regelmäßig zu Bäumen heran; die Jahreszeiten folgen in einer Reihenfolge aufeinander. Nun ist die Natur aber Ja(ja (unbewusst). Sie kann sich nicht selbst regeln. Es bedarf der Existenz eines intelligenten Wesens - Gott - das dafür verantwortlich ist. Sogar Einstein, der Wissenschaftler, war fest von der Erschaffung des Universums durch eine höhere Intelligenz überzeugt.
Obwohl du bei Tag die Sterne nicht siehst, gibt es sie. Obwohl du an einem bewölkten Tag die Sonne nicht sehen kannst, gibt es sie. Ebenso, obwohl du Gott nicht mit deinen physischen Augen sehen kannst, gibt es Ihn dennoch. Wenn du durch Meditationspraxis das göttliche Auge, das Auge der Intuition, erhältst, wirst du Ihn wahrnehmen und „sehen" können.
Gott beweist sich aus sich selbst. Er bedarf keines Beweises, denn Er ist die Basis der Handlung oder des Vorganges des Beweisens.
-
Wo ist Gott?
Wo ist Gott? Es gibt keinen Ort, an dem Er nicht ist. So wie ein einziger Faden alle Blumen einer Girlande durchzieht, so durchdringt auch das eine Selbst alles Lebendige. Er ist in allen
64
Gott
Wesen und Formen verborgen wie Öl in der Saat, Butter in der Milch, Geist im Gehirn, prär:,a (Lebensenergie) im Körper, der Fötus im Mutterschoß, die Sonne hinter den Wolken, das Feuer im Holz, der Dampf in der Atmosphäre, das Salz im Wasser, der Duft in Blumen, der Klang in Schallplatten, Gold im Quarz oder Mikroben im Blut.
Gott ist in allen Wesen als Leben und Bewusstsein vorhanden. Gott ist im Brüllen eines Löwen, im Lied eines Vogels und im Schrei eines Babys. Fühle Seine Gegenwart überall.
Sieh Gott in den Flügeln eines Schmetterlings, in den Buchsta ben Alpha und Omega (,,Im Anfang war das Wort, und das Wort·
war bei Gott, und Gott war das Wort." [Joh 1:11), im Husten eines Patienten, im Rauschen eines Baches, im Klang einer Glocke. Nimm das Wunder von Gottes Antlitz in jedem Objekt dieser Welt wahr.
Jeder Atem, der in der Nase fließt, jeder Herzschlag, jede Arterie, die im Körper pulsiert, jeder Gedanke, der im Geist auf tritt, sagt dir, Gott ist nahe.
Jede Blume, die ihren Duft verströmt, jede Frucht, die dir gefällt, jede sanfte Brise, die weht, und jeder Fluss, der dahin gleitet, spricht von Gott und Seiner Barmherzigkeit.
Der weite Ozean mit seinen hohen Wellen, der große Himälaya mit seinen Gletschern, die helle Sonne und die Sterne am weiten Himmel, der hohe Baum mit seinen Zweigen, die kühlen Quellen in den Hügeln und Tälern erzählen dir von Seiner Allmacht.
Die Musik lieblicher Sänger, die Vorträge eindrucksvoller Redner, die Gedichte berühmter Dichter, die Feststellungen wissenschaftlicher Kapazitäten, die Operationen geschickter Chirurgen, die Äußerungen großer Heiliger, die Gedanken der
,,Bhagavad-gitä" und die Offenbarungen der upanisads spre chen von Gott und Seiner Weisheit.
Alles ist Gott. Das Gute ist Gott. Das Missgeschick ist Gott. Grüße Ihn in allem und verweile friedvoll in Wonne.
Gott erfüllt das gesamte Universum. Er bewegt sich im Bettler gewand. Er stöhnt vor Schmerz in der Verkleidung eines Kran ken. Er wandert im Wald in Lumpen gehüllt. Öffne deine Au gen. Sieh Ihn in allem. Diene allen. Liebe alle.
Fühle die göttliche Gegenwart überall - in jeder Form, in jedem Gedanken, in jedem Gefühl und in jeder Empfindung, in jeder Bewegung, in jeder Emotion.
Gott durch die Sinne wahrgenommen ist Materie. Gott durch den Verstand wahrgenommen ist Geist. Gott durch den Geist gesehen ist ätman, das Selbst.
Gott wohnt in dir. Er ist der antar-yämin (innere Lenker), der dein Leben bestimmt und lenkt. Er ist in dir und du bist in Ihm. Er ist dir ganz nahe. Er ist nicht sehr weit weg, sondern Er ist dir näher als du es dir selbst bist. Anfänglich dachtest du, Er sei nur am Berg Kailäsa (Kailash), in Rämesvaram, Mekka, Jerusalem, im Himmel oder am Firmament. Du hattest sehr vage Vorstellun gen. Dieser Körper ist Sein sich bewegender Tempel. Das Aller heiligste ist dein Herz. Schließ die Augen. Zieh die indriyas (Sinnesorgane) von den Sinnesobjekten ab. Suche Ihn in deinem Herzen mit einpünktigem Geist, Hingabe und reiner Liebe. Du wirst Ihn sicher finden. Er wartet hier mit ausgebreiteten Armen, um dich zu umarmen. Wenn du Ihn hier nicht finden kannst, kannst du Ihn auch nirgendwo anders finden.
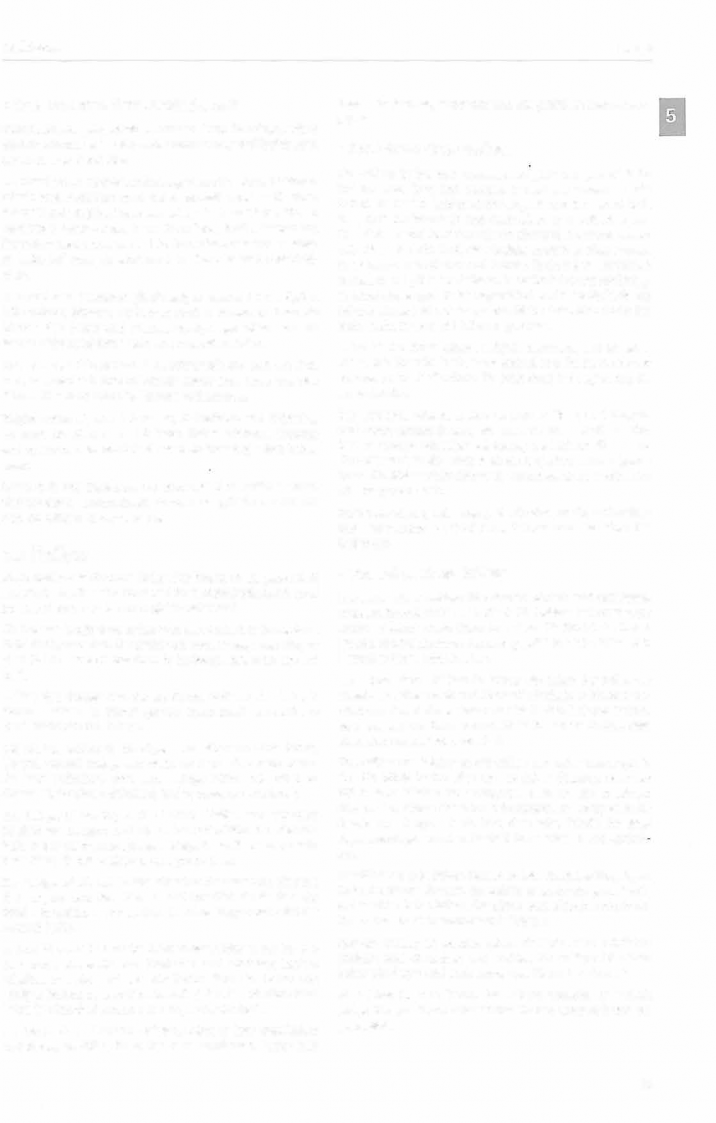
Bhakti-yoga
-
Wie kann man Gott verwirklichen?
Gott ist eine Angelegenheit von Angebot und Nachfrage. Wenn du dich wirklich nach Seinem darsana sehnst, wird Er sich dir in einem Moment enthüllen.
Du brauchst zur Gottverwirklichung weder Kunst noch Wissen schaft, weder Studium noch Gelehrsamkeit, sondern Glauben, Reinheit und Hingabe. Fasse alle Liebe, die du weltlichen Dingen gegenüber hegst - Frau, Sohn, Vermögen, Besitz, Verwandte, Freunde - zusammen und richte dann diese zusammengefass te Liebe auf Gott. Du wirst noch in dieser Sekunde verwirkli chen.
Gott und dem Mammon gleichzeitig zu dienen ist unmöglich. Mit anderen Worten: Du kannst nicht in derselben Tasse die Wonne des Selbst und Sinnesvergnügen genießen bzw. du kannst nicht gleichzeitig Licht und Dunkelheit haben.
Gott verlangt dein ganzes Herz. Schrumpfe vor Gott auf Null. Erst dann wird sich Gott vollständig deiner annehmen und dich führen. Nur dann wird die Hingabe vollkommen.
Vergiss deine eigenen Interessen, Sehnsüchte und Wünsche. Du wirst die Wonne des höchsten Selbst erlangen. Kreuzige und opfere das niedere Selbst, wenn du Einheit mit Gott haben willst.
leere dich von Egoismus. Du wirst mit Gott erfüllt werden. Verliere deine Persönlichkeit. Du wirst das göttliche Leben fin den. Du wirst Gott verwirklichen.
s.s Heilige
Ein/e Heilige/r ist Gott auf Erden. Für ihn/sie ist die ganze Welt nur Stroh. Ihm/ihr sind Gold und Stein gleichbedeutend. Ihm/ ihr sind Freude und Schmerz gleichbedeutend.
Ein Heiliger lebt in Gott. Er hat Gott verwirklicht. Er kennt Gott. Er ist Gott geworden. Er spricht von Gott. Er zeigt den Weg zu Gott. Er ist berauscht von Gott. Er ist Gott selbst. Er ist eins mit Gott.
Heilige sind Gottes Vertreter auf Erden. Gott offenbart sich in einem Heiligen in Seiner ganzen Herrlichkeit, unendlichen Kraft, Weisheit und Wonne.
Die Heiligen bilden für die Pilger eine Leiter zum Altar Gottes. überall, wo sich Heilige und Weise auch nur eine halbe Sekun de lang aufhalten, dort sind heilige Plätze wie Värär:iasT (Benares), Prayäga (Allahabad) und Vrndävana (Vrindavan).
Ein Heiliger ist ein Segen für die Erde. Heilige sind lebendige Zeichen von Religion und die wahren Wohltäter der Mensch heit. In der Geschichte spielten Heilige in der Bewahrung geis tiger Werte in der Welt stets eine große Rolle.
Ein Heiliger ist ein spiritueller Wäscher. Er verwendet die Seife der Hingabe ·und des Wissens und beseitigt die Flecken der Sünde im weltlichen Menschen. In seiner Gegenwart wird der Mensch heilig.
In dem Moment, in dem der Geist an einen Weisen denkt, wer den sofort alle schlechten Begierden und niedrigen Leiden schaften beiseite gewischt. Meditation über das Leben von Heiligen kommt heiliger Gesellschaft gleich. Das Studium ihrer Lehre ist gleichbedeutend mit heiliger Gesellschaft.
Denken an das Leben von Heiligen, Leben in ihrer Gesellschaft und das große Glück, ihren Segen zu empfangen, lenkt einen
Heilige
Regen der Reinheit, Inspiration und des göttlichen Bewusstseins auf dich.
-
-
Das Wesen eines Heiligen
Ein Heiliger ist frei vom Gedanken an „ich" und „mein". Er ist frei von Lust, Zorn und Habgier. Er liebt alle Wesen als sein Selbst. Er besitzt Leidenschaftslosigkeit und Barmherzigkeit. Er spricht die Wahrheit und dient allen. Er meditiert immer über Gott. Er spricht nicht schlecht über andere. Er hat univer selle Sicht. Er sieht DevT, die göttliche Mutter, in allen Frauen. Er ist immer voll Frieden und Freude. Er singt der Herrlichkeit Gottes. Er hat göttliches Wissen. Er ist furchtlos und großzügig. Er bittet nie, er gibt. Er ist majestätisch und herrschaftlich. Ein solcher Mensch ist auf der ganzen Welt selten. Man findet ihn nicht leicht. Er wird nicht überall geboren.
Liebe ist der Atem eines Heiligen. Barmherzigkeit ist seine Natur. Sein Herz fließt über von Mitleid. Er sieht die Fehler der anderen nicht. Er gibt Gutes für Schlechtes und segnet die, die ihn verfluchen.
Das Herz eines Weisen ist eine Flamme der Liebe, und sein gan zes Wesen dürstet danach, die leidende Menschheit zu erhe ben. Er vergisst sich selbst vollständig und lebt nur für andere. Ein Heiliger sieht die ganze Welt als Projektion seiner eigenen Seele. Ein Weiser sieht Einheit in Verschiedenheit. Er wird eins mit der ganzen Welt.
Ein Weiser ist jung mit Jungen, alt mit Alten, mutig mit Mutigen und Kind mit Kindern. Er fühlt den Schmerz und das Leiden der Leidenden.
-
Das Leben eines Heiligen
Das Leben eines Heiligen ist aufrecht, einfach und anziehend. Es ist voll Anmut. Es ist methodisch. Ein Heiliger ist immer guter Laune. Er kennt nichts Böses im Leben. Für ihn ist das Leben Freude. Er wird nicht von Kummer geprüft. Er ist furchtlos. Kein Herrscher hat Macht über ihn.
Das Leben eines Heiligen ist immer ein Leben der Stille, der Einkehr, der Einsamkeit und Abgeschiedenheit. Er bleibt unbe rührt von den Veränderungen der Welt. Kein äußeres Ereignis kann ihn aus der Bahn werfen. Er ist in seinem ätman, dem absoluten Bewusstsein, zentriert.
Ein Heiliger und Weiser ist wunschlos und daher immer glück lich. Ein König besitzt alles und ist daher glücklich. Aber das Glück eines Weisen ist grenzenlos, denn er lebt in seinem ätman, dem Ozean der Wonne brahmans. Ein König ist voller Ängste und Sorgen. Er fürchtet, dass seine Feinde ihn eines Tages bezwingen werden. Deshalb ist er ruhelos und unglück lich.
Das Glück eines befreiten Weisen ist kein sinnliches Vergnügen. Es ist die Wonne ätmans, des Selbst. Er erlebt die ganze Welt gleichzeitig als das Selbst aller Dinge. Sein Glück hat nichts mit Zeit zu tun. Es ist transzendentale Wonne.
Nur ein Weiser ist wirklich reich. Multimillionäre mit Sehn süchten und Wünschen sind Bettler. Ein Heiliger ist einem Kaiser überlegen und auch lndra, dem Herrn des Himmels.
Ein Weiser ist vom Traum des Lebens erwacht. Er genießt ewige Wonne. Einern erleuchteten Weisen unterwirft sich die ganze Welt.
65
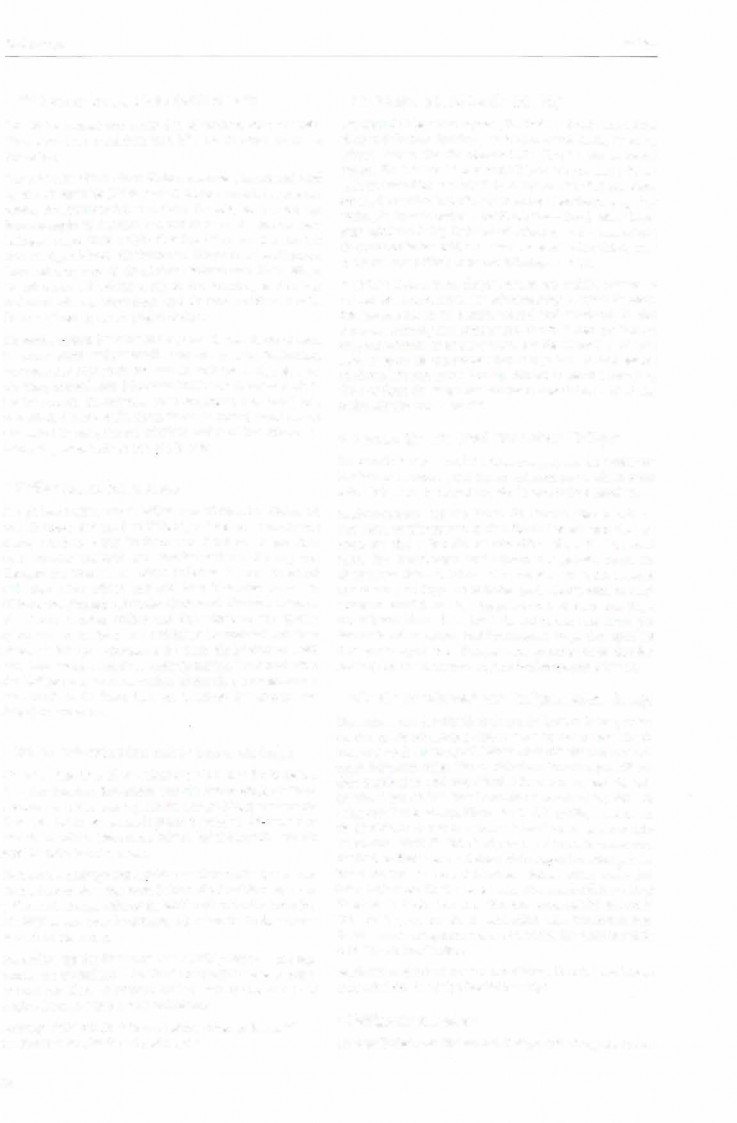
Bhakti-yoga
-
Ein Weiser braucht kein Genie zu sein
Der Weise bewegt sich unter den Menschen, aber er bleibt allen Menschen unsichtbar; man hält ihn für einen normalen Menschen.
Nur ein Weiser kann einen Weisen erkennen. Manchmal wird er wie ein sarvajfia (Allwissender). Manchmal wird er wie ein ajfiönT, ein Unwissender, erscheinen. Er weiß, wann er wie ein brahma-ni�tha zu handeln hat, und wann er sich wie ein Narr betragen muss. Urteile nicht über ihn. Wenn du dich ihm mit dem richtigen bhöva, mit Vertrauen, Hingabe und spirituellem Durst näherst, wird er dir höchstes Wissen vermitteln. Wenn du mit einem schlechten Motiv zu ihm kommst, wird er sich verhalten wie ein Verrückter, und du wirst enttäuscht sein. Dann erleidest du einen großen Verlust.
Ein brahma jfiönT, befreiter Weiser, braucht kein Genie zu sein. Er muss nicht redegewandt, wie ein großer Rhetoriker, Vortragender oder Professor, sein. Meist ist er ruhig, gelassen, wortkarg und still. Sein Schweigen ist höchste Beredsamkeit. Er besitzt samatö (Gleichmut, einen ausgewogenen Geist) und samatö-dr�_ti (universelle Sicht). Er ist ein maunT, mahö-maunT und muni. Er hat göttliche Weisheit und intuitives Wissen. In seiner Gegenwart klären sich alle Zweifel.
-
Heilige haben keine Kaste
Es gibt keine Kaste unter Heiligen und Weisen. Ein Weiser ist wie ein Löwe, der aus dem Käfig ist, frei von den Fesseln von Kaste, Glauben, Beruf, Tradition und Schriften. Schau nicht nach sozialer Herkunft und gesellschaftlicher Stellung von Heiligen und Weisen. Das bringt dir keinen Nutzen. Du kannst dich dann nicht öffnen und von ihren Tugenden lernen. In höherer Religion gibt es weder Kaste noch Glaubensbekennt nis. Schon Schuster, Weber und Unberührbare sind Heilige geworden. Es besteht kein wirklicher Unterschied zwischen einem christlichen Mystiker und einem hinduistischen Heili gen. Ihre AUssagen sind nie widersprüchlich. Die Botschaften der Heiligen sind im wesentlichen identisch. Sie waren immer ein Aufruf an die Menschen, die Weisheit des ötman {des Selbst) zu entdecken.
-
Weise unterscheiden sich in ihrem Verhalten
Die Erkenntnis ist in allen Weisen dieselbe, aber ihr Verhalten ist unterschiedlich. SrT-vasi$tha war ein karma-körJ(;/T, er führte havanas und Opfer aus. Räjä Janaka war ein bhogT; er herrschte über sein Reich; er genoss königliche Freuden. SrT dattätreya war ein avadhüta {Wanderer, Asket). Käkabhü�ur:u;lhi war ein yogT. Manche heiraten sogar.
Weise wie Dattätreya und Jadabharata ziehen glücklich herum. Sie besitzen weder Haus noch Kleider. Alle Dualitäten sind aus gelöscht. Sie können nicht für das Wohlergehen der Welt arbeiten wie Räjä Janaka oder SrT-sarikara. Aber ihre bloße Gegenwart erhebt die Menschen.
Der andere Typ des Weisen ist der wohltätige Weise - wie Räjä Janaka und SrT-sarikara - der für die Solidarität der Welt wirkt. Er fühlt mit allen. Er schreibt Bücher, unterrichtet und baut mathas {Hütten, Tempel etc.) und ösrams.
Du fragst vielleicht: ,,Welche der beiden Arten ist besser?" Die Antwort ist: ,,Beide sind gleich gut."
66
Heilige
-
Ein Weiser ist nicht selbstsüchtig
Unwissende Menschen sagen: ,,Ein Weiser strebt nach seiner eigenen Selbstverwirklichung. Er ist sehr selbstsüchtig. Er bringt keinen Nutzen für die Gesellschaft." Das ist ein schwerer Irrtum. Ein Weiser ist der wohltätigste Übermensch. Er ist äußerst freundlich und mitfühlend. Er erhebt sofort alle Men schen, die mit ihm in Berührung kommen. Des Weiteren gibt er spirituelle Energie weiter - sakti-saficöra - durch seine divya d_r�_ti (göttliche Sicht). Er findet würdige Aspiranten und erhebt sie durch sorika/po-sakti, auch wenn er sich in einer Höhle oder in einem kutTr {Hütte) im fernen Himälaya aufhält.
EinjfiönTist kein selbstsüchtiger Mensch, wie weltliche Personen oft meinen. Seine spirituellen Schwingungen reinigen die Welt. Sein ganzes Leben ist beispielgebend und erhebend. Er gibt anderen Hoffnung und Ermutigung, damit sie den spirituellen Weg aufnehmen. Er ist der einzige, der die Menschen wirklich liebt. Er spürt die Gegenwart Gottes in jedem. Er liebt seinen Nächsten wie sich selbst. Nur ein jfiönT dient wirklich selbstlos, denn er fühlt die Gegenwart Gottes in allen Wesen. Er' ist der wahre Altruist und Humanist.
-
Erlaube dir kein Urteil über einen Heiligen
Du kannst nicht das weltliche Maß anlegen, um die Größe von Heiligen zu messen. Sprich ihnen aufgrund deines üblen Blicks keine Fehler zu. Du kannst ihre Verdienste nicht beurteilen.
Brahma-ni�thas sind wie Feuer. Sie können alles verzehren. Ihre bloße Berührung reinigt alles. Sie sind jenseits von Gut und Böse; sie sind selbst die höchste Güte. Ahme ihr Tun nicht nach. Ihre Handlungen sind seltsam und geheimnisvoll. Sie übersteigen dein Verstehen. Wenn du einen Einbruch begehst und sagst: ,,Hat Kr$r:ia nicht Butter gestohlen?", wirst du hoff nungslos zerstört werden. Kr$r:ia hob den Govardhana-Hügel mit seinem kleinen Finger hoch. Kannst du auch nur einen gro ßen Stein mit all deiner Kraft hochheben? Folge dem upadesa (Unterweisungen) von Heiligen und mahö-puru�as (großen Seelen) und du wirst hier und jetzt brahma jfiöna erlangen.
-
Wie die Gesellschaft von Heiligen Nutzen bringt
Um Nutzen von der Gesellschaft von Heiligen zu haben, musst du dich zuerst vorbereiten. Habe weder irgendeine vorgefasste Meinung noch ein Vorurteil. Nähere dich niit offenem und auf nahmebereitem Geist. Nähere dich ohne Erwartungen. Nähere dich bescheiden und respektvoll. Nimm das an, was dir ent spricht. Wenn ein Teil ihrer Lehre dir nicht entspricht, bilde dir keine voreilige Meinung. Wenn sie dir nicht gefällt, brauchst du sie dir nicht zu Herzen zu nehmen. Was für einen anderen rich tig ist, muss nicht für dich richtig sein. Und doch, in Anbetracht der breiten Basis kann es keinen Meinungsunterschied geben. Wenn du vor das Angesicht eines Weisen trittst, stelle ihm keine Fragen aus bloßer Neugierde. Sitze bescheiden in seiner Gegenwart. Beobachte ihn. Höre ihm vorurteilsfrei zu. Stelle ihm nur Fragen, auf die du tatsächlich eine Antwort suchst. Stelle ihm nur dringende Fragen. Verwickle ihn nicht in Politik oder öffentliches Gezänk.
Meditiere in der Gegenwart eines Weisen. Du wirst das innere Licht erhalten, das deine Zweifel beseitigt.
-
Heilige als Ratgeber
Die Gesellschaft von Weisen und Heiligen hat eine große trans-
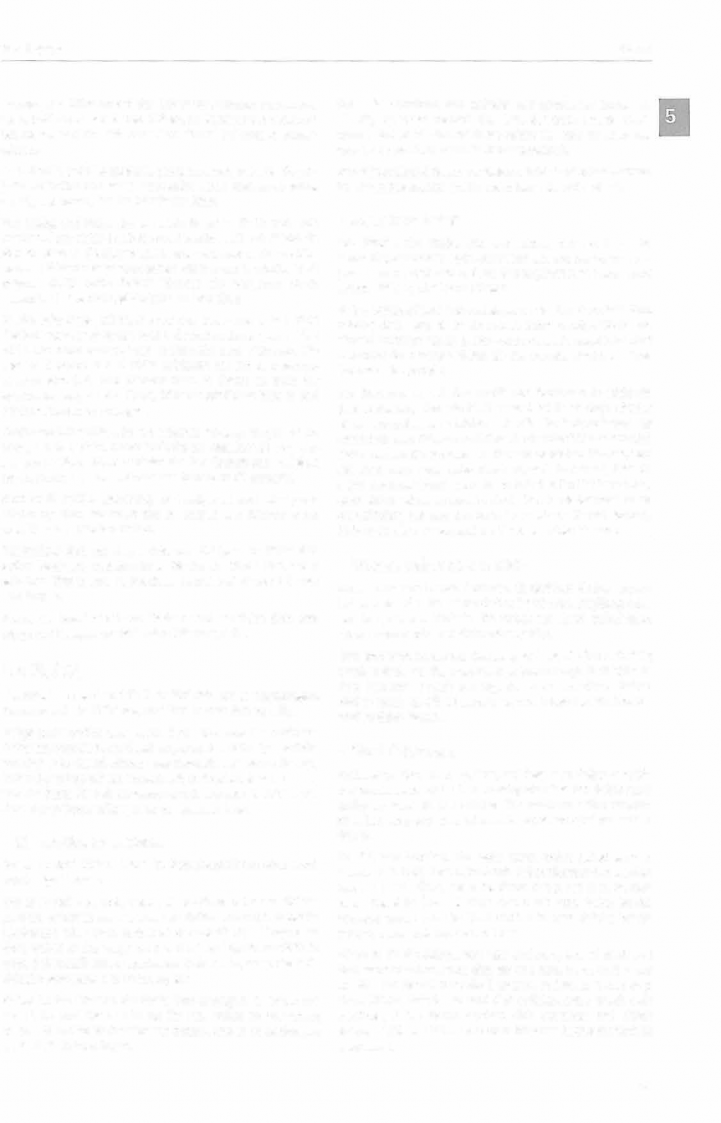
Bhakti-yoga
formierende Wirkung auf das Leben von wirklich Suchenden. Sie erhebt sie zu erhabenen Höhen, zu Reinheit und Spirituali tät. Sie verfehlt ihre Wirkung nicht einmal bei krassen Materi alisten.
Jede Schule, jede Hochschule, jedes Internat, jedes Gefängnis, jede Institution und jedes Haus sollte einen Weisen zu seiner Verfügung haben, der die Mitglieder führt.
Nur Heilige und Weise können echte Ratgeber für Herrschende werden, denn sie sind selbstlos und besitzen höchste Weisheit. Nur· sie können die allgemeine Moral verbessern. Nur sie kön nen den Weg zur Erlangung ewiger Wonne und Unst_ erblichkeit zeigen. Siväji hatte SvämT Rämdäs als Ratgeber. König Dasaratha hatte Mahar$i Vasi$tha als Ratgeber.
Es gibt sehr viele Heilige. Die meisten Menschen haben nicht das Verlangen nach ihnen. Man will nicht zu ihnen gehen. Man will ihnen nicht dienen. Man strebt nicht nach Höherem. Die meisten Menschen sind völlig zufrieden mit ein paar zerbro chenen Muscheln und Glasscherben. In ihnen ist nicht der spirituelle Hunger oder Durst, höheres göttliches Wissen und inneren Frieden zu erlangen.
Spirituelle Möglichkeit ist ein seltenes Privileg. Vergib solche Gelegenheiten nicht. Nimm Zuflucht zur Gesellschaft von Wei sen und Heiligen. Ein Augenblick der Gesellschaft von Heiligkeit ist ein Schiff, um diesen Ozean des Lebens zu überqueren.
Gott ist die größte Läuterung. Ein Heiliger ist auch eine große Läuterung. Gott inkarniert sich in Heiligen und Weisen, wenn man ihrer am meisten bedarf.
Beschäftige dich mit dem Leben von Heiligen. Du fühlst dich sofort inspiriert. Gedenke ihrer Worte. Du fühlst dich sofort erhoben. Tritt in ihre Fußstapfen. Du bist befreit von Schmerz und Sorgen.
Suche die Gesellschaft von Weisen und entwickle dich. Sat sariga mit Heiligen verfehlt seine Wirkung nicht.
-
-
Gebet
Das Kätzchen miaut und die Katze läuft hin, um es wegzutragen. Genauso ruft der Gläubige, und Gott kommt ihm zu Hilfe.
Gebet ist das Sichberufen auf Gott für Hilfe in der Verzweiflung. Gebet ist, Gott die Möglichkeit zu geben, den Gläubigen zu trös ten. Gebet ist das Erleichtern des Gewichts auf deinem Herzen, indem du es Gott öffnest. Gebet heißt, Gott entscheiden zu lassen, was das Beste für dich ist, wenn du dich in einem Konflikt befin dest. Durch Verzweiflung lernt der Mensch beten.
-
Ein mystischer Zustand
Beten ist nicht Bitten. Beten ist Gemeinschaft mit Gott durch aufrichtige Hingabe.
Gebet ist Nähe zu Gott. Gebet ist das Hinwenden des Geistes zu Gott. Gebet ist das Fixieren des Geistes auf Gott. Gebet ist Meditation über Gott. Gebet ist die vollständige Hingabe an Gott. Gebet ist das Aufgehen von Geist und Ego in der Stille in Gott. Gebet stellt einen mystischen Zustand dar, wenn das indi viduelle Bewusstsein in Gott aufgeht.
Gebet ist das Erheben der Seele Gott entgegen. Es ist ein Akt der Liebe und der Verehrung für Ihn. Gebet ist Verehrung Gottes. Gebet ist Verherrlichung Gottes. Gebet ist Danksagen an Gott für Seinen Segen.
Gebet
Gebet ist Anrufung, das Aufrufen der spirituellen Kräfte, die ständig durch das menschliche Herz, den Geist und die Seele fließen. Gebet ist eine mächtige spirituelle Kraft. Es ist so real wie die Schwerkraft oder die Anziehungskraft.
Gebet ist Seele und Essenz der Religion. Es ist das absolute Zentrum im Leben des Menschen. Niemand kann ohne Gebet leben.
-
-
-
-
Jeder kann beten
Der Blinde, der Taube und der Lahme, der Armlose, der Schwache, der Unwissende, der Niedrigste und der Verlorene - jeder kann zu Gott beten, denn Gebet gehört zum Herzen und seinem Fühlen, nicht zum Körper.
Gebet verlangt keine hohe Intelligenz oder Beredsamkeit. Gott möchte dein Herz, wenn du betest. Schon wenige Worte aus einer demütigen reinen Seele - auch wenn sie ungebildet sind
-
werden Gott mehr gefallen als der beredte Wortfluss eines Redners oder pa(lr;/its.
Das Kind kennt nicht Grammatik und Betonung: Es stößt ein paar Laute aus, aber die Mutter versteht! Der indische Butler eines europäischen Offiziers ist kein Englischprofessor: Er spricht ein paar Sätze ohne Zeitwort, aber der Offizier versteht! Wenn andere die Sprache des Herzens verstehen können, was soll man dann vom antar-yämin sagen? Gott weiß, was du sagen möchtest! Auch wenn du im Gebet an Ihn Fehler machst, auch wenn Fehler im mantra sind, den du wiederholst, wenn du aufrichtig bist und das Gebet aus deinem Herzen kommt, hört Er es, denn Er versteht die Sprache deines Herzens.
-
-
Wessen Gebet wird erhört?
Gebet muss von Herzen kommen. Es darf kein bloßes Lippen bekenntnis sein. Ein leeres Gebet ist wie Messingklang oder das Klimpern von Zimbeln. Ein Gebet aus einem aufrichtigen reinen Herzen wird von Gott sofort erhört.
Gott antwortet immer auf die Anliegen derer, die Ihm aufrichtig ergeben sind. Nur der unaufrichtige Mensch sagt, Gott ist taub. Gott hält immer nach den Signalen der Verzweiflung Seiner Kinder Ausschau. Öffne Ihm dein Herz vorbehaltslos. Die Antwort wird sogleich folgen.
-
Die Gebetspraxis
Gott hat dir den Atem gegeben, auf dass er im Gebet verwen det werde. Setze dich hin und bete; aber lass das Gebet nicht aufhören, wenn du dich erhebst. Wahres Gebet währt das gan ze Leben lang, und dein Leben wird zu einem einzigen langen Gebet.
Es gibt kein Problem, das nicht durch Gebet gelöst werden könnte, kein Leid, dass nicht durch Gebet überwunden werden kann, und kein Übel, das nicht durch Gebet behoben werden kann. Gebet ist In-Verbindung-Treten mit Gott. Gebet ist das Wunder, durch das die Kraft Gottes in menschliche Venen strömt. Daher knie nieder und bete.
Wenn in dir die Stürme von Lust und Zorn, von Eitelkeit und Genusssucht toben, setze dich hin und bete. Denn Gott - und nur Er - hat Gewalt über die Elemente. In deinem Flehen liegt deine Stärke. Sein Segen wird dich erfüllen, Seine Gnade dich schützen, Seine Barmherzigkeit dich umgeben und durch Seinen göttlichen Willen auf dem Weg der Rechtschaffenheit anspornen.
67
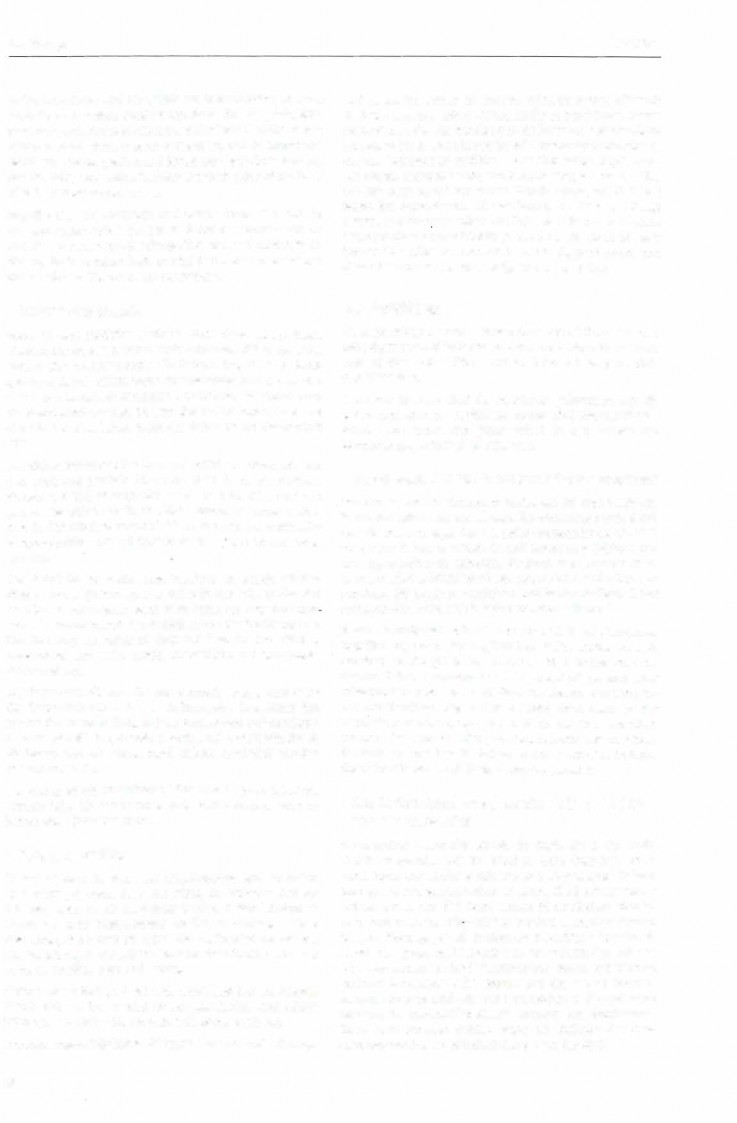
Bhakti-yoga
Daher knie nieder und bete. Nicht um irdische Güter, nicht um himmlische Freuden, sondern um Seine Gnade. ,,Dein Wille geschehe, mein Gott! Ich wünsche nichts", soll dein Gebet sein. Denn du weißt nicht, was für dich gut ist; und du bittest viel leicht um Schwierigkeiten und betest um Verderbnis. Bete um Gnade. Bete, dass Seine Rechtschaffenheit sich auf die Seele aller Menschen senken möge.
Begrüße den Tagesanbruch und verabschiede dich bei der untergehenden Sonne mit einem Gebet der Dankbarkeit; zu erst für den neuen Tag, der dir gewährt wird, und zuletzt für die Gnade, die du erhalten hast. So wird dein Leben gesegnet sein und so wirst du Seinen Segen ausstrahlen.
-
Nutzen des Gebets
Gebet ist eine mächtige spirituelle Kraft. Gebet ist spirituelle Nahrung für die Seele. Gebet ist ein spirituelles Stärkungsmittel. Gebete sind mächtige spirituelle Ströme. Es gibt nichts Reini genderes als das Gebet. Wenn du regelmäßig betest, wird sich dein Leben allmählich verändern und formen. Das Gebet muss zur Gewohnheit werden. Du wirst das Gefühl haben, du kannst ohne Gebet nicht leben, wenn das Gebet dir zur Gewohnheit wird.
Das Gebet erleichtert das Herz und erfüllt den Geist mit Frie den, Kraft und Reinheit. Wenn der Geist durch die Kraft des Gebets rein und sattwig wird, wird der Intellekt scharf und genau. Das Gebet erhebt den Geist. Wenn du betest, verbin pest du dich mit dem unerschöpflichen kosmischen Kraftwerk hira(lya-garbha - und schöpfst Kraft, Energie, Licht und Stärke aus Ihm.
Das Gebet ist der verlässliche Gefährte am beschwerlichen Weg zu mokf?O (Erlösung). Das Gebet ist der Fels, an den sich der Mensch halten kann, wenn er im Ozean von sarnsara unter geht. Das Gebet befreit den Gläubigen von der Furcht vor dem Tod. Es bringt ihn näher zu Gott und lässt ihn das göttliche Bewusstsein und seine wahre, unsterbliche und wonnevolle Natur erfahren.
Das Gebet wirkt Wunder. Das Gebet versetzt Berge. Auch wenn die Ärzteschaft einen Fall als hoffnungslos bezeichnet hat, kommt das Gebet zu Hilfe, und der Patient wird auf wunderba re Weise geheilt. Es gab viele derartige Fälle. Vielleicht bist du dir dessen bewusst. Heilen durch Gebete ist wirklich wunder bar und mysteriös.
Das Gebet ist ein unfehlbares Hilfsmittel in jeder Situation. Oftmals habe ich seine wundervolle Kraft erfahren. Auch du kannst diese Erfahrung machen.
-
Bete und erblühe
Du weinst, wenn in dein Haus eingebrochen wird. Du weinst und wehklagst, wenn dein Kind stirbt. Du krümmst dich vor Schmerz, wenn du dir die Glieder brichst. 0 Räm ! Weinst du jemals um Gott? Weine immer um Ihn. Er wird alles Leiden abwenden. Flehe Gott um Seine Hilfe an. Du wirst frei sein von den Verletzungen des Lebens. Wende diese Methode an und ernte die Früchte. Bete und erblühe.
Nichts in dieser Welt wird dich retten. Gott liebt dich am meisten. Berufe dich auf Ihn. Er wird dir entgegenlaufen. Suche Seine Führung. Lobe Seine Herrlichkeit. Rufe Seine Gnade an.
DraupadT betete inbrünstig. SrT-km1a kam von Dvärakä ange-
68
Avatäras
laufen, um ihr Leiden zu lindern. Gajendra betete glühend; Gott Hari kam mit seinem Diskus, um ihn zu beschützen. Es war MTräs Gebet, das das Nagelbett in ein Rosenlager verwandelte und die Kobra in eine Blumengirlande. Es war Prahlädas Gebet, das das kochende Öl abkühlte, als es über seinen Kopf gegos sen wurde. Nämdev betete, und Vittf:1ala stieg aus seinem Bild, um sein Essen zu sich zu nehmen. Eknäth betete, und Gott Hari zeigte ihm Seine Gestalt mit vier Armen und Händen. DämäjT betete, und SrT-kr�r:ia spielte die Rolle des Dieners und zahlte seine Schulden an den bödsöh (Herrscher). Närada betet noch immer. Was willst du mehr? Bete inbrünstig jetzt sofort, von dieser Sekunde an. Du wirst ewige Wonne erreichen.
-
-
Avatäras
-
Als Jesus geboren wurde, sangen Engel ein schönes Lied zum Lobe Gottes und offenbarten so den Zweck seiner Herabkunft. Ehre sei Gott in der Höhe - und auf Erden Friede, guter Wille den Menschen.
Jesus war in diese Welt der Menschen gekommen, um die wahre und höchste Herrlichkeit Gottes wiederherzustellen - Frieden auf Erden und guten Willen in den Herzen der Menschen gegenüber allen Mitwesen.
-
-
Das Gesetz, das die Herabkunft Gottes bestimmt
Das Gesetz, das die Herabkunft Gottes auf die Erde bestimmt, ist zu allen Zeiten und überall dasselbe. Gott steigt herab, damit der Mensch aufsteige. Das Ziel jedes avatäras ist es, die Welt vor großer Gefahr zu retten, die Schlechten zu vernichten und die Tugendhaften zu schützen. SrT-kr�r:ia sagt: ,,Immer wenn Rechtschaffenheit darnieder liegt, komme Ich. Um die Guten zu schützen, die Bösen zu vernichten und Rechtschaffenheit fest zu begründen, werde Ich in jedem Zeitalter geboren."
Wenn Unehrlichkeit wächst und Ehrlichkeit im Abnehmen begriffen ist, wenn die ungöttlichen Kräfte stärker zu sein scheinen als die göttlichen, wenn das Wort Gottes oder die Gebote Seiner Abgesandten in Vergessenheit geraten oder missachtet werden, wenn religiöser Fanatismus den Buchsta ben der Schriften folgt und ihren Geist tötet, dann ist der Zeitpunkt gekommen, dass sich Gott auf der Erde inkarniert, um den Menschen zu retten, um Rechtschaffenheit zu retten. Er nimmt menschliche Gestalt an, wenn Er auf die physische Ebene herniederkommt. Er wird avatära genannt.
-
Der Unterschied zwischen einem jTvan-mukta und einem avatära
Ein einfacher jTvan-mukta ist wie ein Stern, der in der Nacht strahlt. Er spendet nur ein bisschen Licht. Irgendwie ist er durch tapas und södhana zum anderen Ufer gelangt. Er kann keine große Zahl von Menschen erheben. Wie die Wasser einer kleinen Quelle nur den Durst einiger Pilger löschen können, kann auch dieser kevalajfiänT nur wenigen Menschen Frieden bringen. Wohingegen ein avatära ein mächtiges Wesen ist. Er ist wie der große Mänasarovar-See. Er entfernt den Schleier der Unwissenheit Tausender Männer und Frauen und führt sie ins Land der ewigen Ruhe, Wonne und des ewigen Sonnen scheins. Avatäras sind eins mit dem Höchsten. Sie sind keine Teile wie die individuellen Seelen. Avatäras bzw. Gottinkarna tionen sind Strahlen Gottes. Wenn die Aufgabe des /oko sailgraha vorüber ist, verschwinden sie aus der Welt.
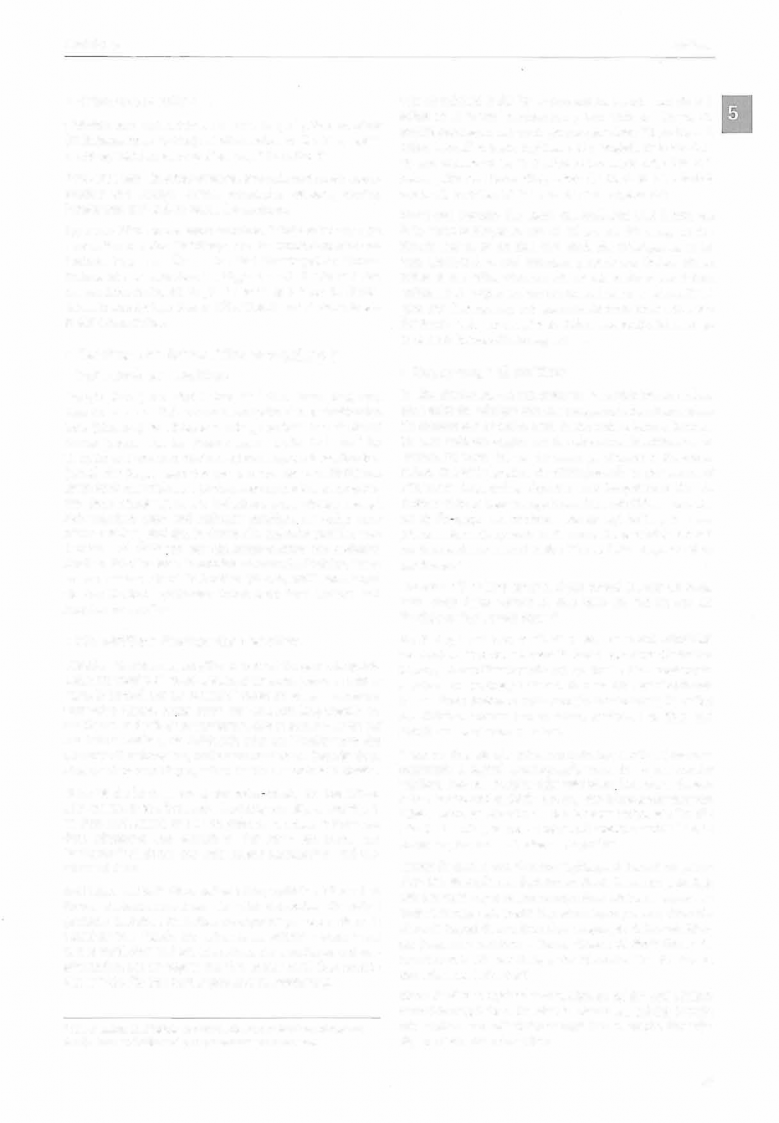
Bhakti-yoga
-
Arten von avatäras
Avatäras sind unterschiedlicher Art. Es gibt pürna-avatäras (Vollinkarnationen Gottes) mit allen kaläs bzw. Strahlen, af"()sa avatäras, Teilinkarnation Gottes, und IT/ä-avatäras*.
Gott Km1a war ein pür,:ia-avatära, Sri-satikaräcärya ein af"()sa avatära und Matsya, Kürma, Narasiryiha, Vämana, Varäha, Parasuräma und andere waren IT!ä-avatäras.
Km1a und Räma waren viJQu-avatäras. Dak?ir:tämürti war eine Inkarnation von Siva. Dattätreya war der trimürti-avatära von Brahmä, Vi?r:tu und Siva - den drei Hauptaspekten Gottes. Brahmä ist der schöpferische, Vi?r:tu der erhaltende und Siva der zerstörende Aspekt. Es gibt keinen Polytheismus im Hindu ismus. Brahmä, Vi?r:tu, Siva und Shakti sind verschiedene Aspek te des einen Gottes.
-
Der Grad von Gottes Offenbarwerdung in verschiedenen avatäras
Die rJis (Seher) von einst haben die Lehrmeinung dargelegt, dass der Herr des Universums in sechzehn sich ausbreitenden kaläs (Strahlen) der Offenbarwerdung existiert, dass ein Strahl Seines Lebens sich im Pflanzenreich manifestiert, zwei im Tierreich und zwischen fünf und acht im menschlichen Bereich, gemäß der Regel, nach der wir uns von der Primitivität am einen Ende der Skala zum höchstentwickelten Stand am ande ren Ende hinbewegen. Das Offenbarwerden Gottes bewegt sich zwischen neun und sechzehn Strahlen. Die vollen oder pürna-avatäras sind die, in denen alle sechzehn Strahlen vor handen sind. SrT-krsr:ia war ein pürna-avatära mit sechzehn Strahlen. SrT-räma war ein avatära mit vierzehn Strahlen. T heo sophen nennen ebenfalls Strahlen (sieben, zwölf etc.), wenn sie das Stadium spiritueller Entwicklung ihrer Meister und Adepten beschreiben.
-
Die göttliche Gestalt eines avatäras
Manche Menschen sagen: ,,Wie können wir Kr?r:ta als bhagavän (,,den Ehrwürdigen", Gott) ansehen? Er wurde geboren und er starb. Er ist doch nur ein Mensch." Das ist die Aussage eines un wissenden Kindes. Krsr:ia nahm nur eine Zeit lang Gestalt an, um Dienst an der Welt zu verrichten, also in Seiner Mission auf der Erde zu wirken, die Solidarität oder das Wohlergehen der Menschheit zu bewirken, und verschwand dann. Kr?r:ta ist Gott, eine Verkörperung Vi?r:,us, selbst. Darüber besteht kein Zweifel.
Räma ist die höchste Seele, der antar yämin, der Beschützer aller Wesen. Er ist allwissend, allmächtig und allgegenwärtig. Er ist Gott Hari (Vi?r:tu). Er war nie geboren worden. Er starb nie. Gott offenbarte sich einfach in der Form von Räma, um Rechtschaffenheit auf der Erde wieder herzustellen, und ver schwand dann.
Gott Kr?r:ia und Gott Räma hatten keine physischen Körper. Ihre Körper bestanden nicht aus den fünf Elementen. Sie hatten göttliche Gestalten. Sie hatten cinmaya-Körper, wenn sie auch aussahen wie Fleisch. Sie hatten keine wirkliche Geburt und keinen wirklichen Tod wie Menschen. Sie erschienen und ver schwanden, wie ein yogTes tut. Ihre Körper verblieben nicht in dieser Welt. Für ihre Körper gibt es keine Zerstörung.
-
Ulä-avatäras sind Teilinkarnationen, die eine Vielzahl von Aktivitäten durchführen und dabei voller transzendentaler Freude sind.
Avatäras
Wie ein Schneider, der für andere Mäntel macht, auch für sich selbst einen Mantel machen kann, kann Gott, der Körper für andere geschaffen hat, auch genauso gut einen Körper für sich selbst erschaffen. Darin liegt keine Schwierigkeit. Er ist allmäch tig und allwissend. Da Er Kontrolle über mäyä hat, ist Er sich Seiner göttlichen Natur völlig bewusst, obwohl Er eine Gestalt annimmt. Trotzdem ist Er unendlich und ungebunden.
Manchmal besucht der König das Gefängnis und betritt die Zelle eines Gefangenen, um zu sehen, wie die Dinge im Ge fängnis laufen. Er tut dies zum Wohl der Gefangenen. Er ist ganz ungebunden, und trotzdem geht er aus freiem Willen selbst in die Zelle. Genauso nimmt ein avatära aus freiem Willen einen Körper an, um die Menschen zu erheben. Er ist ganz ungebunden und hat absolute Kontrolle über mäyä wie der König; während der )Tva ein Sklave von avidyä ist, solange er keine Selbstverwirklichung hat.
-
-
-
Begegnung mit avatäras
Es gibt Menschen, die mit avatäras in Kontakt treten wollen, ohne dafür die richtigen Voraussetzungen zu haben. Selbst wenn ein avatära vor dir steht, wirst du ihn nicht erkennen können. Du hast nicht die Augen, um Ihn als solchen identifizieren zu können. Du wirst Ihn nur für einen gewöhnlichen Menschen halten. Wie viele konnten die Göttlichkeit SrT-kr?r:ias erahnen? Erkannten Jaräsandha, Si?upäla und Duryodhana Ihn als avatära Gottes? Sehr wenige Menschen, wie BhT?ma, erkann ten in SrT kr?r:ia den avatära. Deshalb sagt Gott: ,,Die Toren erkennen Mich nicht, wenn Ich in menschlicher Gestalt erschei ne, denn sie kennen nicht Meine höchste Natur als großer Herr der Wesen."
Nur ein Heiliger kann einen Heiligen verstehen. Nur ein Jesus kann einen Jesus verstehen. Wie kann ein Patient um die Verdienste eines Arztes wissen?
Ein Anfänger auf dem spirituellen Weg muss sich allmählich vorbereiten. Er muss von verschiedenen upa-gurus (Assistenz lehrern, Sekundärunterweisern) spirituelle Unterweisungen erhalten und sie streng befolgen. Er muss sich darauf vorberei ten, zu einem brahma-niJtha-guru (Wahrheitslehrer, der selbst die Wahrheit erkannt hat) zu gehen, Meditation zu üben und Gott in der Meditation zu sehen.
Wenn du über die vier Mittel zur Befreiung verfügst (sädhana catuJtaya, s. Kapitel „Jiiäna-yoga"), wenn du so brennendes vairägya hast wie Buddha oder Räjä Bhartrhari, wenn du ver geben kannst und geduldig bist wie der avanti-brähma,:w von Ujjain, wenn du Hingabe an den Meister besitzt wie Trotaka oder Padmapäda, kannst du sofort mit avatäras und Heiligen in Berührung kommen - in diesem Augenblick.
Kannst du dienen wie Florence Nightingale? Kannst du gehor chen wie ein Soldat auf dem Schlachtfeld? Kannst du großzügig sein wie Ranti Deva? Kannst du schlaflose Nächte in Hingabe an Gott verbringen wie MTrä? Kannst du tapas (Askese) üben wie Dhruva? Kannst du zu deinen Überzeugungen stehen wie Man sür (Mansoor) und Sams-e TabrTzT (Shams Tabriez)? Kannst du furchtlos sein wie der Heilige, der Alexander den Großen an den Ufern des Indus traf?
Wenn du all dies bejahen kannst, wirst du auf der Stelle Selbst verwirklichung haben. Du wirst in diesem Augenblick Kontakt mit avatäras und vollerblühten yogTs haben. Mache dich wür dig und dann stelle Ansprüche.
69
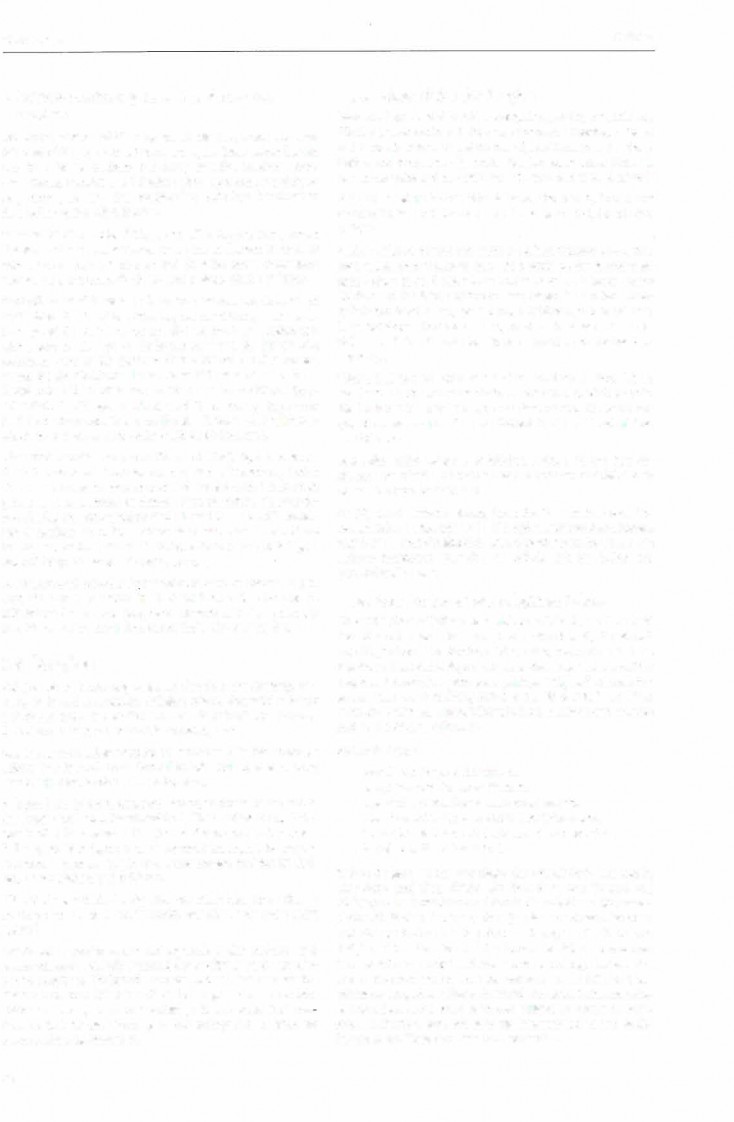
Bhakti-yoga
-
Gottverwirklichung durch Verehrung von avatäras
Du kannst Gottverwirklichung durch die Verehrung von ava täras wie SrT-kr�r:ia und SrT-räma erlangen. Viele haben bereits auf diese Weise Gottverwirklichung erreicht. Tukäräm, Räm däs, Sürdäs, MTräbäT und TulsTdäs haben Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Ihre machtvollen Schriften beschreiben ihre hohen spirituellen Erfolge.
Verehre SrT-räma oder SrT-kr�r:ia zu allen Zeiten, von ganzem Herzen und aus ganzer Seele. Preise Ihn in deinem Herzen. Er wird sich dir bald offenbaren und du wirst Seine Gegenwart fühlen. Du wirst Unsterblichkeit und ewiges Glück erreichen.
Gott offenbart sich denen, die an Ihn glauben, auf vielerlei Art und Weise. Er nimmt die Form an, die der Gläubige zur Vereh rung gewählt hat. Wenn du Ihn als Hari mit vier Händen ver ehrst, wird Er als Hari zu dir kommen. Wenn du Ihn als Siva anbetest, wird Er dir darsana (Seine Vision) als Siva geben. Wenn du Ihn als Mutter Durgä oder KälT verehrst, wird Er als Durgä oder KälT zu dir kommen. Wenn du Ihn als Räma, Kr�r:ia oder Gott Dattätreya anbetest, wird Er als Räma, Kr�r:ia oder Dattätreya kommen. Wenn du Ihn als Christus oder Allah ver ehrst, wird Er als Christus oder Allah zu dir kommen.
Alles sind Aspekte des einen isvara (Gottes). Egal in welcher Gestalt, man verehrt immer nur den Einen. Verehrung richtet sich an den innewohnenden Gott in der Gestalt. Im Hinduismus gilt es als Unwissenheit, zu denken, eine Gestalt sei einer ande ren überlegen. Alle Gestalten sind ein und dasselbe. Alle vereh ren denselben Gott. Die Unterschiede sind nur Unterschiede im Namen, bedingt durch die Unterschiede in den Gläubigen, aber nicht im Gegenstand der Verehrung.
Der wahre Christus oder Krsr:ia wohnt in deinem Herzen. Er lebt
-dort für immer. Er wohnt in dir. Er ist immer dein Partner. Es gibt keinen Freund, wie den, der in dir wohnt. Verlasse dich auf Ihn. Nimm Zuflucht bei Ihm. Verwirkliche Ihn und sei frei.
s.s Religion
Religion ist die Beziehung zwischen den drei Grundprinzipien - Gott, Welt und Individuum. Religion tröstet den müden Pilger auf dieser Erde. Sie erklärt ihm das Geheimnis des Lebens. Sie zeigt den Weg zur unsterblichen Wohnstatt.
Religion ist nicht Lebensverzicht. Sie ist Lebensfülle. Sie ist ewiges Leben. Der Mensch wird durch Disziplin, Selbstbeherrschung und Meditation zu Gott. Das ist Religion.
Religion besteht darin, anderen Menschen Gutes zu tun und in der Praxis von Liebe, Barmherzigkeit, Wahrhaftigkeit und Rein heit in allen Lebenslagen. Religion ist Philosophie in der Praxis; Philosophie ist Religion in der Theorie. Philosophie ist immer währendes Suchen, Fragen und Untersuchen. Religion ist Spü ren, Verwirklichen und Erfahren.
Kühe sind verschiedenfarbig, aber die Milch hat immer diesel be Farbe oder anders ausgedrückt, dieselbe Jacke passt nicht jedem!
Individuelle Charaktere und Hintergründe in der Tradition sind unterschiedlich. Deshalb entstand das Bedürfnis nach verschie denen religiösen Weltanschauungen. Jeder Weg, der zur Be freiung bzw. zum Höchsten führt, ist so gut wie der andere. Gottes-verehrung kann auf vielfältige Weise praktiziert wer den. Vielfalt ist die Ordnung in der Schöpfung. Religion ist davon nicht ausgenommen.
70
Religion
-
Das Wesentliche der Religion
Wahre Religion besteht nicht aus engstirnigen Dogmen, blindem Glauben, willkürlichem Gefühl und trockener Theologie. Sie ist nicht nur ein kleines Gebet für das eigene Wohl bzw. für Krank heiten und Probleme allgemein. Religion ist in erster Linie ein Leben der Güte und des Dienens - sie ist Leben in Meditation!
Religion ist Leben in Gott. Wer liebevoll, freundlich, fromm und wahrhaftig ist und Glauben und Hingabe besitzt, ist wirklich religiös.
Wahre Religion drückt sich nicht in Äußerlichkeiten und extre men asketischen Übungen aus, wie beispielsweise stundenlan gem Stehen in der heißen Sonne oder im kalten Wasser, einem Zeichen auf der Stirn, verfilztem Haar, einem langen Bart, oran gefarbigen Gewändern, geschorenen Schädeln, Glockenläuten, Muschelblasen, Zimbelspiel etc., sondern in einem Leben der Güte, der Reinheit und des Dienens inmitten weltlicher Ver suchungen.
Wahre Religion ist nicht nur Reden, sondern in Gott leben. Intellektuelle Zustimmung allein macht nicht wirklich religiös. Sie ist jenseits aller Theorie und Argumente. Sie kann nur gelebt werden - innerlich und äußerlich. Sie ist Verwirklichen und Werden.
Lasse dich nicht, wegen persönlichen Neigungen und Konven tionen, von religiösen Praktiken von Fanatikern und Sektierern begrenzen bzw. beeinflussen.
Es gilt, durch Unterscheidungskraft das Wesentliche vom Un wesentlichen in Religion und Philosophie auseinanderzuhalten. Nur dann kannst du glücklich sein. Das Wesentliche ist in allen wahren Religionen dasselbe, es drückt sich im Außen nur unterschiedlich aus.
-
Der Gewinn aus einem religiösen Leben
Ein aufrichtiges religiöses Leben ist der größte Segen. Es erhebt den Menschen aus dem Sumpf von Weltlichkeit, Unreinheit und Unglauben. Der Verstand ist wertlos, wenn ihn nicht die Religion erleuchtet. Religion (ein allumfassender Lebensstil) tut das, was Philosophie (eine pure geistige Tätigkeit) niemals tun kann. Wenn du in Einklang mit den Regeln der Religion lebst, wirst du Weisheit, Unsterblichkeit, immerwährenden Frieden und ewige Wonne erlangen.
Wahre Religion:
-
befreit von Sorge und Schmerz.
-
bringt immerwährenden Frieden.
-
macht den Menschen vollkommen und frei.
-
macht unabhängig vom Weltlichen (Mammon).
-
verbindet die Seele mit brahman, dem Absoluten.
-
befreit von Geburt und Tod.
Wahre Religion ist die Grundlage der Gesellschaft, die Quelle aller Güte und allen Glücks, die Grundlage von Tugend und Wohlstand im Individuum und durch die Individuen der ganzen Nation. Zivilisation, Ordnung, Moral (all dies erhebt den Menschen und gibt der Nation Frieden) sind der Ertrag aus der Praxis von Religion. Ohne Religion hat das Leben des Menschen keinen Sinn, es wird zu einer trostlosen Verschwendung. Nur Religion macht die menschliche Existenz wertvoll. Sie erfüllt den Geist mit Liebe, Hingabe, Gelassenheit und Frohsinn. Keine materiel le und atheistische Kraft kann den religiösen Drang im Men schen aufhalten, egal wie sehr die Massenmedien und sozio kulturelle Einflüsse etc. dies auch versuchen.
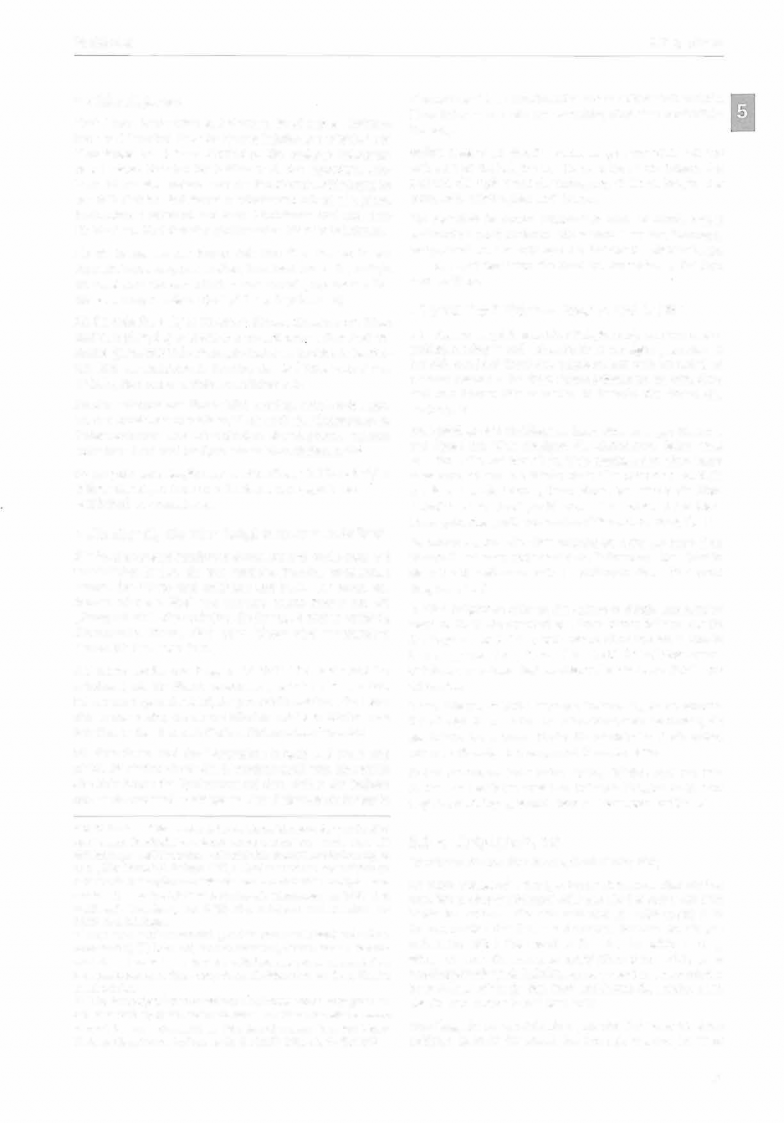
Bhakti-yoga
-
Weltreligionen
Hinduismus, Zoroastrismus, Judentum, Buddhismus, Christen tum und Islam sind die sechs großen Religionen der Welt.* Der Hinduismus hat keinen Begründer. Alle anderen Religionen haben einen Gründer. Sie heißen nach den Gründern. Jain ismus ist nur eine andere Form des Buddhismus. Sikkhismus ist hauptsächlich im Hinduismus begründet und teilweise im _Islam. Brahmoismus entstand aus dem Hinduismus und aus dem Christentum. Und dasselbe gilt für andere kleinere Religionen.
Als die Menschen vor langer Zeit alles über den vedischen Monotheismus vergessen hatten, kam Zarathustra. Er predigte die Verehrung des einen Gottes, Ahuramazda, und verurteilte die Verehrung von devas (Halbgöttern, Engelswesen).
Als die vedische Religion zu einem blinden Einhalten von Riten und Tieropfern degenerierte und die brähmanas (Priester) die südras (gemeines Volk; niedrigste Kaste) verächtlich behandel ten, kam der mitleidsvolle Buddha, der dem Töten von Tieren Einhalt gebot und den Status der südras hob.
Als die Judenpriester überheblich wurden, erhob sich Jesus, um den Judaismus zu reinigen.** Als auch das Christentum zu Bilderverehrung und Aberglauben degenerierte, tauchte Mohammed auf und predigte seinen Monotheismus.***
So war jede neue Religion nur ein Bemühen, die ältere Religion in ihrer damaligen Form zu reformieren und gegen ihren Missbrauch zu protestieren.
-
Die Einheit, die allen Religionen zugrunde liegt
-
Alle Propheten sind Sendboten Gottes. Sie sind große Yogis und verwirklichte Seelen, die eine göttliche, intuitive Gottesschau hatten. Ihre Worte sind unfehlbar und heilig. Der Koran, das Awesta oder die Bibel sind genauso heilige Bücher wie die
,,Bhagavad-gTtä". Alle enthalten die Essenz göttlicher Weisheit. Ahuramazda, Tsvara, Allah oder Jehova sind verschiedene Namen für den einen Gott.
Die letzte Quelle der Religion ist Gott. Die fundamentalen Prinzipien, die ihr Wesen ausmachen, wurden den r�is bzw. Sehern am Beginn der Schöpfung von Gott offenbart. Sie finden sich in den vedas, die als die ältesten religiösen Bücher oder Schriften in der Menschheitsbibliothek anerkannt werden.
Die Grundlagen und das Wesentliche in allen Religionen sind gleich. Sie sind so alt wie das Menschengeschlecht. Eine wirkli che Erfindung oder Entdeckung auf dem Gebiet der Religion gab es nie und wird es nie geben. Kein Religionsgründer hat je
* Zu Zeiten Swami Sivanandas hatte der Zoroastrismus - der von Zarathu stra (griech. Zöroastres) gegründet wurde und bei dem heute etwa 135 000 Anhänger gezählt werden - offensichtlich eine größere Bedeutung, da er in „Bliss Divine" (5. Auflage 1997, S. 353) zur sechsten Weltreligion ge zählt wurde. Heute gibt es fünf Weltreligionen: Christentum (ca. 2,260 Mrd. Anhänger}, Islam (ca. 1,800 Mrd. Anhänger}, Hinduismus (ca. 0,940 Mrd. Anhänger}, Buddhismus (ca. 0,460 Mrd. Anhänger} und Judentum (ca. 0,015 Mrd. Anhänger.
** Jesus Christus inkarnierte sich (.,Und das Wort ward Fleisch und wohne te unter uns [...]") [Joh 1:14], um den Judaismus, der zur leblosen Tradition mutiert war, zu reinigen und die alttestamentarischen messianischen Prophezeiungen zu erfüllen, nach denen die Menschen von ihren Sünden erlöst würden.
••• Um dem Polytheismus der Griechen und Römer etwas entgegenzuset zen, aber auch um gegen Juden und vor allem Christen handfest zu oppo nieren*, begann Mohammed im Nahosten eine neue Form von Mono theismus (Islam) zu verbreiten. [al-Qur'än 4:157; 5:32, 43, 47, 82; 9:29]
MOrtyupäsana
eine neue Religion erfunden oder eine neue Wahrheit enthüllt. Diese Gründer sind alle nur Vermittler, nicht aber tatsächliche Erschaffer.
Wahre Religion ist eins. Sie ist die Religion von Wahrheit und Liebe. Sie ist die Religion des Herzens. Sie ist die Religion des Dienens, des Opfers und der Entsagung. Sie ist die Religion der Güte, Liebenswürdigkeit und Toleranz.
Die Wahrheit ist weder hinduistisch noch islamisch, weder buddhistisch noch christlich! Die Wahrheit ist eins, homogen, ewige Substanz. Der Anhänger der Religion der Wahrheit geht auf dem Pfad des Lichts, des Friedens, der Weisheit, der Kraft und der Wonne.
-
Verfall der Religion - Ursache und Abhilfe
Der Mensch vergisst alles über Religion aufgrund von Unwis senheit, Machtgier und Habsucht. Er ist unreligiös geworden. Er hat sich quasi auf Tierniveau begeben. Sein Sinn für Moral ist verloren gegangen. Er wütet, richtet Schaden an, mordet, plün dert und brennt Häuser nieder. Es herrscht das Gesetz des Dschungels.
Viele predigen den Buddhismus, kaum einer aber gibt Wünsche und hifT)sä auf. Viele predigen das Christentum, kaum einer aber übt Liebe und Verzeihen. Viele predigen den Islam, kaum einer aber erkennt die Brüderschaft aller Menschen an. Viele predigen den Hinduismus, kaum einer aber erkennt die Gött lichkeit in allem. Predigen ist zum Lebensunterhalt des Men schen geworden, während das Praktizieren Verachtung findet.
So kommt es, dass die Welt schlecht ist, nicht aus Mangel an Wahrheit und auch nicht wegen der Religionen; aber leider ist sie schlecht, weil es an wahren Anhängern dieser ideale und Religionen fehlt.
In allen Religionen müssen die Anhänger richtig unterwiesen werden. Stelle die praktischen Lehren deiner Religion vor die Anhänger dieser Religion, und ersinne Mittel und Wege, die sie in die Lage versetzen, diese Lehren im täglichen Leben auszu drücken. Ohne Praxis lässt Idealismus im Menschen Fatalismus entstehen.
Wenn Erkenntnis nicht lebensverändernd ist, ist sie nutzlos. Selbstlosigkeit und Liebe sind keine Glaubensbekenntnisse, die gelehrt werden, sondern ideale, die beispielgebend sein sollen, und die aufgezeigt und ausgestrahlt werden sollen.
Daher praktiziere jeder seine eigene Religion und tue sein Bestes, um das Ziel zu erreichen. Möge die Religion Heilige und yogTs hervorbringen, anstatt Tempel, Moscheen und Kirchen.
5.9 Mürtyupäsana
(Verehrung Gottes über Statue, Symbol oder Bild)
Ein Stück weißes oder farbiges Papier ist wertlos. Man wirft es weg. Wenn aber der Stempel oder das Bild des Königs auf dem Papier ist - wenn es also eine Banknote ist - wird es sicher im Portemonnaie oder Koffer aufbewahrt. Genauso ist ein ge wöhnliches Stück Stein wertlos für dich. Du wirfst es weg. Wenn du aber die steinerne mürti (Statue) von SrT-kr�r:ia in Par:ic;Jharpür oder jede beliebige andere mürti in einem Schrein betrachtest, neigst du den Kopf und faltest die Hände, denn der Stempel Gottes ist auf dem Stein.
Eine Flagge ist nur ein Stückchen gefärbter Stoff, aber für einen Soldaten steht sie für etwas, das ihm sehr wertvoll ist . Er ist
71
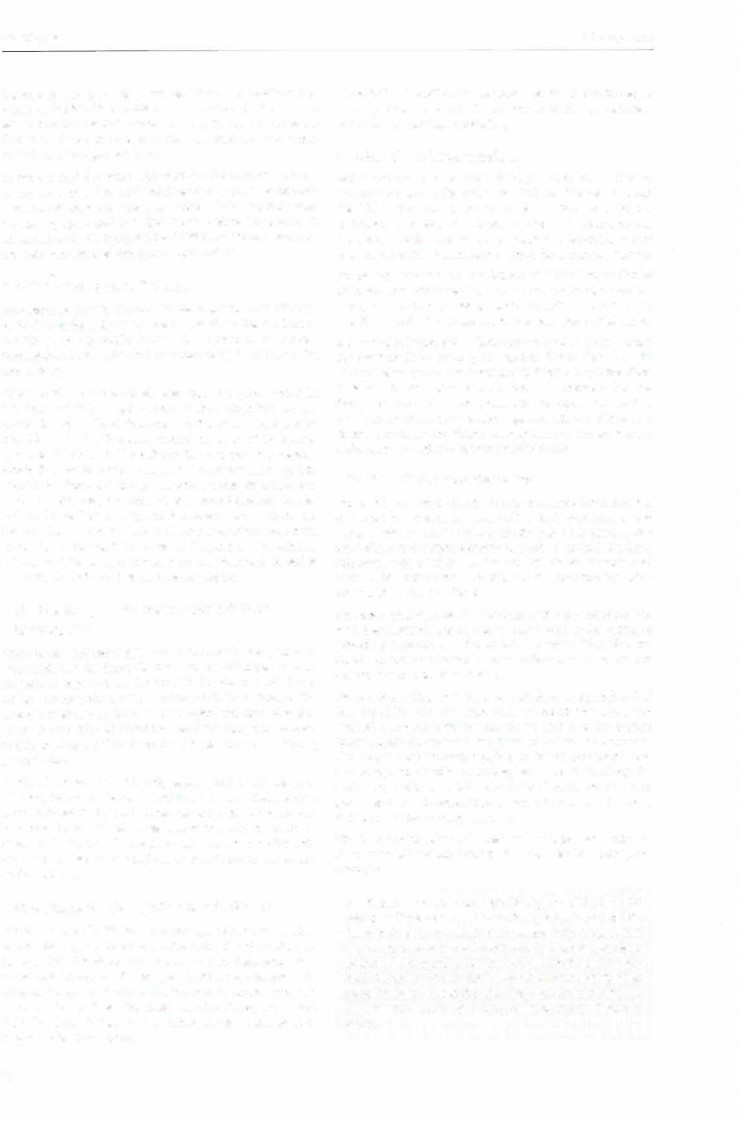
Bhakti-yoga
bereit, sein Leben zu geben, um die Fahne zu verteidigen. Ge nauso ist das Bild für den Gläubigen sehr wertvoll. Es spricht in seiner Sprache der Frömmigkeit zu ihm. So wie die Fahne im Soldaten Kriegsgeist entstehen lässt, so lässt das Bild Fröm migkeit im Gläubigen entstehen.
So wie ein Kind den mütterlichen bhäva der zukünftigen strei chelnden, sorgenden und schützenden Mutter entwickelt, wenn es mit dem aus Fetzen gemachten Spielzeugkind seiner Vorstellung spielt und das Kind in seiner Vorstellung stillt, so entwickelt auch der Gläubige das Gefühl der Hingabe, wenn er die mürti verehrt und sich darauf konzentriert.
-
-
Mürti - ein Symbol für Gott
Eine mürti ist nur ein Symbol für das Göttliche. Der Gläubige sieht darin keinen Block aus Stein oder einen Haufen Metall. Für ihn ist sie ein Abbild Gottes. Sie ist wertvoll, da sie das Kennzeichen Gottes trägt und für etwas steht, das für ihn heilig und ewig ist.
Wenn du eine mürti verehrst, sagst du nicht: ,,Diese mürti ist aus Jayapura (Jaipur) gekommen. Prabhu Singh hat sie ge bracht. Sie wiegt fünfundzwanzig Kilo. Sie ist aus weißem Mar mor. Sie hat mich fünfhundert Rupien gekostet." Du überla gerst alle Attribute Gottes auf das Bild und betest: ,,0 antar yämin (innerer Herrscher)! Du bist alldurchdringend. Du bist allmächtig, allwissend und gnadenvoll. Du bist die Quelle von allem. Du bist aus dir selbst. Du bist sac-cid-änanda. Du bist ewig und unveränderlich . Du bist das Leben meines Lebens, die Seele meiner Seele! Gib mir Licht und Erkenntnis. Lass mich immer in dir bleiben." Wenn deine Hingabe und Meditation intensiv und tief wird, siehst du nicht das Steinbild. Du siehst nur Gott, der caitanya (reines Bewusstsein) ist.
-
Ein Medium, um Gemeinschaft mit Gott herzustellen
Götterbilder sind nicht eitle Launen von Bildhauern, sondern leuchtende Kanäle, durch die das Herz des Gläubigen zu Gott hingezogen wird und auf Ihn zufließt. So wie man die Klang wellen von Menschen aufder ganzen Welt über einen Radio empfänger einfangen kann, ist es möglich, mit dem allgegen wärtigen Gott über das Medium des Götterbildes zusammen zu sein. Die Statue selbst bleibt eine Statue, aber die Verehrung erreicht Gott.
Es gibt Menschen, die leichtfertig sagen: ,,Gott ist ein allgegen wärtiges, formloses Wesen. Wie kann Er auf diese Statue beschränkt sein?" Sind sich diese Menschen jemals seiner All gegenwart bewusst? Sehen sie immer Ihn, und Ihn allein, in allem? Nein. Ihr Ego hält sie davon ab, sich vor den Götterbil dern zu verneigen, und bringt aus diesem Grund diese hinken de Ausrede vor.
-
Eine Stütze für den spirituellen Anfänger
Mürti-Verehrung ist für Anfänger eine große Hilfe. Es ist nicht jedem möglich, den Geist auf das Absolute oder Unendliche zu fixieren. Gott überall wahrzunehmen und die Gegenwart Got tes zu praktizieren, ist für den gewöhnlichen Menschen nicht möglich. Die große Mehrheit braucht eine konkrete Form, um Konzentration zu üben. Der Geist will eine Stütze, wo er sich festhalten kann. Er kann in den Anfangsstadien keine Vorstel lung vom Absoluten haben.
72
Mürtyupäsana
Die mürti ist eine Stütze für den Anfänger. Sie ist eine Stütze für seine spirituelle Kindheit. Sie erinnert an Gott. Das materielle Bild bringt die geistige Vorstellung.
-
Jeder ist ein Bilderverehrer
Bilderverehrung gibt es nicht allein im Hinduismus. Christen verehren das Kreuz. Sie haben das Bild des Kreuzes im Geist. Die Mohammedaner haben im Geist das Bild des al-Ka 'ba Steins, wenn sie sich zum Beten hinknien. Alle Menschen auf der ganzen Welt - außer einigen yagTs und vedäntins - sind Bilderverehrer. Sie stellen sich das eine oder das andere Bild vor.
Das geistige Bild ist auch eine Art von Bild. Der Unterschied ist nicht ein Unterschied der Art, sondern nur des Grades. Alle Ver ehrer, egal wie intellektuell sie auch sein mögen, schaffen sich eine Form im Geist und lassen den Geist auf diesem Bild ruhen.
Jeder verehrt Bilder. Bilder, Zeichnungen usw. sind nur Formen der pratimä (Götterstatue). Ein grobstofflicher Geist braucht ein konkretes Symbol als älambana (Stütze); ein subtiler Geist verlangt ein abstraktes Symbol. Auch ein vedäntin hat das Symbol �, um seinen umherschweifenden Geist festzuhalten. Nicht nur die Bilder oder Darstellungen aus Stein und Holz sind Bilder. Dialektiker und Führer werden auch zu Idolen. Warum sollte man also mürti-Verehrung verdammen?
-
Wenn mürtis lebendig werden
Der Gott in dir hat die Kraft, die schlummernde Göttlichkeit in der mürti zu erwecken. Regelmäßige püjä (Verehrung) und andere Formen, unser inneres Gefühl der Anerkennung der Göttlichkeit in der mürti sichtbar zu machen, enthüllt die darin schlummernde Göttlichkeit. Das ist wirklich ein Wunder und Mirakel. Die mürti wird lebendig, spricht, beantwortet deine Fragen, löst deine Probleme.
Für einen Gläubigen ist die mürti eine Fülle von caitanya (rei nem Bewusstsein). Der Gläubige erfährt Gott in der mürti. Er schöpft Inspiration aus der mürti. Die mürti führt ihn. Sie spricht zu ihm. Sie nimmt eine menschliche Gestalt an, um ihm auf verschiedenste Art zu helfen.
Die mürti von Siva im Tempel von Madurai in Südindien half dem Holzfäller und der alten Frau. Die mürti im Tempel von Tirupati nahm menschliche Gestalt an und legte im Gericht Zeugenschaft ab, um ihren Verehrern zu helfen. Die Statuen in den Tempeln von Tirupati, Pai:ic;Jharpür, PalanT, Kathirgama usw. sind pratyak�a-devatäs (mächtige, sichtbare Gottheiten). Sie erfüllen den Gläubigen Wünsche, heilen ihre Krankheiten und gewähren ihnen darsana. Wunderbare IT/äs werden mit diesen Gottheiten in Verbindung gebracht.
Für einen bhakta oder Weisen gibt es keinja(ia, keine unbeleb te Materie: Väsudevah sarvam iti - ,,Alles ist Väsudeva (bzw. caitanya)".
NarsT Mehtä wurde vom räjä (König) geprüft. Der räjä sagte: ,,0 NarsT, wenn du ein aufrichtiger Verehrer von SrT kr�i:ia bist, wenn du sagst, dass die mürti SrT-kr�i:ia selbst ist, mach, dass sich die mürti bewegt." Dem Gebet NarsT Mehtäs gehorchend bewegte sich die mürti. Der heilige Stier NandT aß vor der mürti Sivas die Speisen, die TulsTdäs geopfert hatte. Die mürti von Kr�i:ia spielte mit MTräbäT. Für sie war sie voll Leben und caitanya (reinen Bewusst seins).
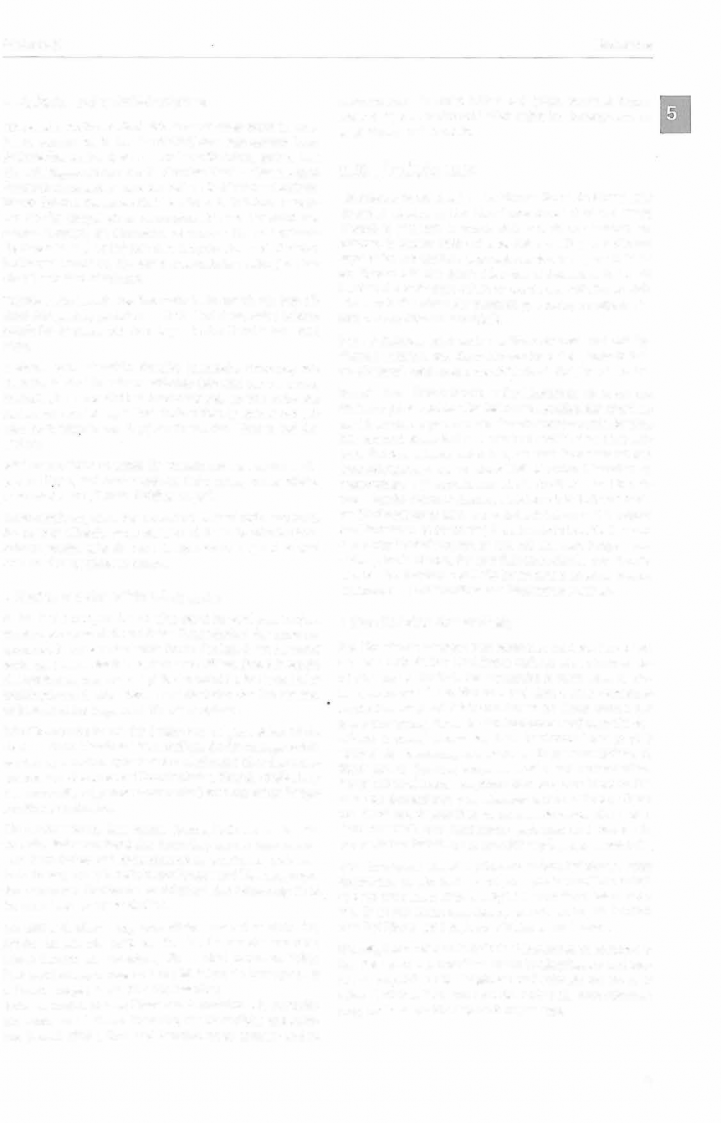
Bhakti-yoga
-
Vedänta und mürti-Verehrung
Ein Pseudo-vedantT schämt sich, sich vor einer miJrti im Tem pel zu verbeugen. Er hat das Gefühl, dass sein advaita (non dualistischer Zustand) sich dadurch verflüchtigen könnte. Lies die Lebensgeschichten der berühmten Tamil-Heiligen Appar, Sundarar, Sambandhar usw. Sie hatten die höchste advaitische Verwirklichung. Sie sahen Gott Siva überall. Und doch besuch ten sie alle Tempel Sivas, verbeugten sich vor der mürti und sangen Hymnen, die aufgezeichnet wurden. Die dreiundsech zig Nayanär-Heiligen kehrten den Tempelboden und zündeten im Tempel Lichter an. Sie waren Analphabeten, erlangten aber die höchste Verwirklichung.
Tulsidäs hatte kosmisches Bewusstsein. Er sprach mit dem all durchdringenden, gestaltlosen Gott. Und doch, seine Leiden schaft für Sri-räma mit dem Bogen in der Hand verschwand nicht.
Tukäräm hatte ebenfalls dieselbe kosmische Erfahrung wie Tulsidäs. Er singt in seinem abhariga (ein Lied zur Verehrung Gottes): ,,Ich sehe Gott alldurchdringend, so wie Süße das Zuckerrohr durchdringt." Und doch spricht er immer von sei nem Gott Vitthala von Pa,:ic;lharpür mit den Händen auf den Hüften.
Mirä verwirklichte ebenfalls ihr Einssein mit dem alldurchdrin genden Kr$,:ia, und doch wurde sie nicht müde, immer wieder zu wiederholen: ,,0 mein Giridhar Nägar".
Mürti-Verehrung steht der vedantischen Sicht nicht entgegen. Sie ist eher hilfreich. Wenn ein Mensch in der Meditation Fort schritte macht, geht die Form im Formlosen auf, und er wird eins mit der gestaltlosen Essenz.
-
Stufen auf der spirituellen Leiter
-
Es ist nicht falsch, zu Beginn eine mürti zu verehren. Der/die Verehrende muss Gott und Seine Eigenschaften der mürti zu sprechen. Er muss an den antar-atman denken, der in der mürti verborgen ist. Schließlich beginnt er zu fühlen, dass der Aspekt
.des Göttlichen, den er verehrt, in der mürti ist, im Herzen aller Geschöpfe und in allen Namen und Gestalten des Universums. Er beginnt Seine Gegenwart überall zu spüren.
Mürti-Verehrung ist nur der Beginn von Religion. Sicher ist sie nicht das Ende. Dieselben Hinduschriften, die für Anfänger mürti Verehrung vorsehen, sprechen von Meditation über das Unbe grenzte und Absolute und Kontemplation über die Bedeutung des maha-vakya (,, großen Ausspruchs") tat tvam asi für fortge schrittene Aspiranten.
Die Hindus wissen, dass mürtis, Kreuze, Halbmonde etc. ein fach eine Reihe von Symbolen darstellen, um den Geist am An fang festzuhalten und Konzentration zu entwickeln, viele kon krete Haken, um spirituelle Vorstellungen und Überzeugungen fest zu machen. Das Symbol ist nicht für jeden notwendig. Es ist im Hinduismus nicht verbindlich.
Ein fortgeschrittener yogT oder Weiser braucht es nicht. Das Symbol ist wie die Tafel, die für den Jungen der untersten Klasse nützlich ist. Diejenigen, die es nicht brauchen, haben kein Recht zu sagen, dass es falsch ist. Wenn sie behaupten, es sei falsch, zeigen sie nur ihre Unwissenheit.
Jedes kennzeichnet eine Phase des Fortschritts. Die menschli che Seele macht diverse Versuche, das Unendliche und Abso lute je nach Stärke, Grad und Entwicklung zu erfassen und zu
Hinduismus
verwirklichen. Sie steigt höher und höher, sammelt immer mehr Kraft, verschmilzt schließlich selbst im Höchsten und er langt Einheit und Identität.
-
-
Hinduismus
Hinduismus ist die Religion der Hindus. Sie ist die älteste aller lebenden Religionen. Der Hinduismus wurde nicht von einem Menschen gemacht. Er wurde nicht von einem einzelnen ge gründet. Er basiert nicht auf einer Reihe von Dogmen, die von einer Reihe von Lehrern gepredigt werden. Er begann nicht als ein System wie der Islam oder das Christentum. Er ist ein Produkt der vedischen Seher. Er wurde von Zeitalter zu Zeit alter durch die Lehren der avataras, r!?is, vedas, upani?ads, der Gitä und der itihasas entwickelt.
Der Hinduismus wird auch sanatana-dharma und vaidika dharma genannt. Sanatana-dharma bedeutet „ewige/s Reli gion/Gesetz". Vaidika-dharma steht für die Religion der vedas.
Gemäß dieser Überlieferung ist der Hinduismus so alt wie die Welt und gilt als Mutter aller Religionen. Buddha, der innerhalb der Hindureligion geboren und danach erzogen wurde, brachte hier und dort einige Veränderungen an und ließ eine neue Reli gion, den Buddhismus, entstehen, um dem Temperament und Entwicklungsstand der zu dieser Zeit lebenden Menschen zu entsprechen. Der Buddhismus ist ein Ausläufer des Hinduis mus. Manche Forscher glauben, dass Jesus in Kasmir und Bena res (Värä,:iasi) tapas übte und dabei mit Lehren und Prinzipien des Hinduismus in Berührung kam. Mahävira brachte hier und dort einige Veränderungen an und ließ eine neue Religion ent stehen, den Jainismus, der ebenfalls ein Ausläufer des Hinduis mus ist. Den Parsismus und alle Ismen kann man unter diesem Blickwinkel als Abkömmlinge des Hinduismus ansehen.
-
Eine Religion der Freiheit
Der Hinduismus gestattet dem rationalen Geist des Menschen absolute Freiheit. Der Hinduismus verlangt keine sinnlose Ein schränkung der Freiheit des menschlichen Verstandes. Er bie tet dem menschlichen Verstand und dem Herzen weitestge hende Freiheit hinsichtlich von Fragen zur Natur Gottes, zur Seele, Schöpfung, Form des Gottesdienstes und zum Ziel des Lebens. Er zwingt niemanden dazu, bestimmte Dogmen oder Formen der Verehrung anzunehmen. Er gestattet jedem, zu überlegen, zu forschen, Fragen zu stellen und nachzudenken. Daher haben alle Arten religiösen Glaubens, verschiedene For men von Gottesdienst oder sadhana und verschiedene Arten von Ritual und Gebräuchen nebeneinander einen ehrenvollen Platz innerhalb des Hinduismus gefunden und werden in harmonischer Beziehung zueinander gepflegt und entwickelt.
Der Hinduismus nimmt, anders als andere Religionen, nicht dogmatisch für sich in Anspruch, dass die letztendliche Befrei ung nur mit seinen Mitteln möglich ist und durch keine ande ren. Er ist nur Mittel zum Zweck, und alle Mittel, die letztlich zum Ziel führen, sind in gleicher Weise anzuerkennen.
Die religiöse Gastfreundschaft des Hinduismus ist sprichwört lich. Sein grundlegender Wesenszug ist allumfassend und libe ral. Er respektiert alle Religionen und schmäht sie nicht. Er erkennt Wahrheit an und ehrt sie, woher sie auch stammen mag, und welches Kleid sie auch tragen mag.
73
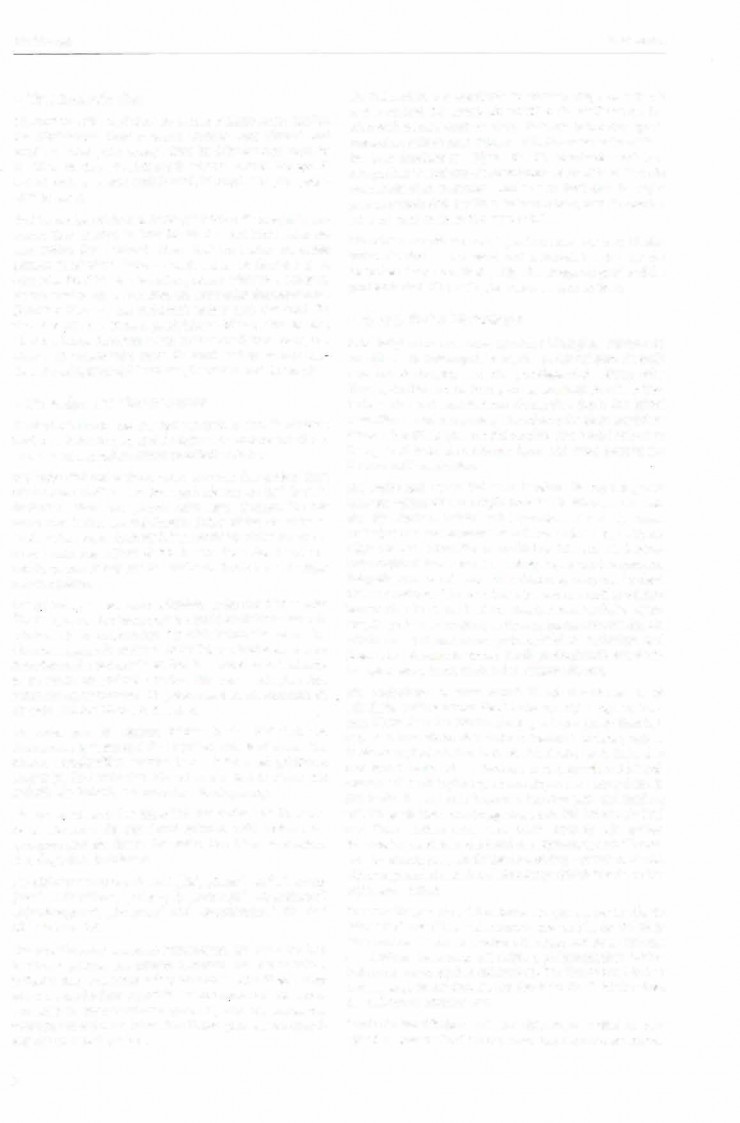
Bhakti-yoga
-
Die Hinduschriften
Die sruti und die smrti sind die beiden maßgeblichen Quellen des Hinduismus. Sruti bedeutet wörtlich „das Hören", und smrti bedeutet „Erinnerung". Sruti ist Offenbarung; smrti ist Tradition. Das in der Meditation Geschaute ist sruti. Eine upani
$Od ist sruti. Das, was erzählt wird, ist smrti. Die „Bhagavad g1tä" ist smrti.
Sruti ist direkte Erfahrung. Große ($iS hörten die ewigen Wahr heiten über Religion in ihrer Meditation und berichteten sie zum Wohle der Nachwelt. Diese Berichte bilden die vedas (älteste überlieferte Texte Indiens). Daher ist sruti die erste Autorität. Smrti ist eine Sammlung dieser Erfahrung. Daher ist sie von zweitrangiger Autorität. Die smrti oder dharma-söstras (Schriften über rechtes Verhalten) stehen nach der sruti. Sie sind ebenfalls von Weisen geschriebene Bücher, aber sie sind nicht von letzter Autorität. Wenn in einer smrti etwas steht, was einer sruti widerspricht, muss die sm.rti zurückgewiesen wer den. Die „Bhagavad-g1tä" und das „Mahäbhärata" sind smrti.
-
Die vedas und die upani�ads
Die sruti wird veda bzw. ömnöya genannt. Es sind die direkten intuitiven Enthüllungen und sie gelten als apauru$eya (über menschlich) und haben keinen spezifischen Autor.
Die vedas sind ewige Wahrheiten, die Gott den großen alten r!?iS Indiens enthüllte. Das Wort ($i bedeutet „Seher". Er sieht Gedanken, diese sind jedoch nicht seine eigenen. Die ($iS
sahen bzw. hörten die Wahrheiten. Daher zählen die vedas zu sruti, zu dem, was gehört wird. Der ($i schrieb nichts auf und er schuf nichts aus seinem Geist. Er sah einen Gedanken, der bereits da war. Er war nur der spirituelle Entdecker und Träger des Gedankens.
Der rsi hat den veda nicht erfunden. Er ist nur Mittler oder Überbringer, um den Menschen die intuitiven Erfahrungen mit zuteilen, die er erhalten hat. Die Wahrheiten der vedas sind Offenbarungen. Alle anderen Weltreligionen beziehen sich auf Autoritäten, die von speziellen Sendboten Gottes an bestimm te Personen übermittelt wurden. Die vedas schöpfen ihre Autorität von niemandem. Sie gelten selbst als dieAutorität, da sie ewig und das Wissen Gottes sind.
Die vedas sind die ältesten Bücher in der Bibliothek des Menschen. Die vedas sind die Urquellen, auf die alles religiöse Wissen zurückgeführt werden kann. Religion ist göttlichen Ursprungs. Sie wurde dem Menschen von Gott in früher Zeit enthüllt. Sie findet in den vedas ihre Verkörperung.
Die upanisads sind der letzte Teil der vedas, das Ende der vedas. Die Lehre, die sich darauf gründet, heißt vedönta. Die upani$ads sind die Essenz der vedas. Sie bilden die absolute Grundlage des Hinduismus.
Die wichtigsten upani$ads sind: ,,Tsa", ,,Kena", ,,Ka1;ha", ,,Mur:i
<;Jaka", ,,Mändükya", ,,Aitareya", ,,Taittir,ya", ,,Chändogya",
„Brhadärar:,yaka", ,,Kau$1taki" und „Svetäsvatara". Sie sind höchste Autorität.
Die verschiedenen indischen Philosophen, die den einzelnen Schulen angehören wie advaita, Monismus mit Eigenschaften (visi!?tödvaita), Dualismus, reiner Monismus, bhedöbheda usw. erkennen die höchste Autorität der upanisads an. Sie haben ihre eigenen Interpretationen gebracht, aber sie haben der Autorität gehorcht. Sie haben ihre Philosophie auf die Grund lage der upani$ads gestellt.
74
Hinduismus
Die Philosophie der upani$ads ist erhaben, tief, eindrucksvoll und ergreifend. Die upani$ads enthüllen die subtilsten spiritu ellen Wahrheiten. Auch westliche Gelehrte haben den upani shadischen Sehern ihren Tribut gezollt. Sie waren erstaunt über die beeindruckenden Höhen, die die upani$ads erreichen. Schopenhauer studierte die upani$ads und meditierte über die upanishadischen Gedanken, bevor er zu Bett ging. Er sagte:
„Die upani$ads sind der Trost meines Lebens, und sie werden mir auch nach meinem Tod Trost sein."
Die Lehren der ($iS von einst gehören nicht nur dem Hindu ismus. Sie sind allumfassend und universal. Sie sind für die Menschen der ganzen Welt gültig. Die „Bhagavad-g,tä" und die upani$ads sind Bücher für Menschen der ganzen Welt.
-
Hinduistische Mythologie
Jede Religion hat drei Teile, nämlich Philosophie, Mythologie und Ritual. Die Philosophie ist die Essenz der Religion. Sie stellt ihre Grundprinzipien auf, die grundlegenden Lehren oder Thesen, das Ziel und die Mittel, um es zu erreichen. Die Mytho logie erklärt und illustriert die Philosophie durch das Mittel legendärer Leben von großen Menschen oder übernatürlichen Wesen. Das Ritual gibt der Philosophie eine noch konkretere Form, damit jeder sie verstehen kann. Das Ritual besteht aus Formen und Zeremonien.
Die Mythologie ist ein Teil jeder Religion. Die Mythologie ist konkrete Philosophie. Die Mythologie ist die Wissenschaft, wel che die Mythen, Fabeln und Legenden untersucht, denen Ereignisse aus lang vergangener Zeit zugrunde liegen, im Spezi ellen aus der frühen Zeit menschlicher Existenz. Die Mytho logie inspiriert den Leser durch Lebensregeln und lobenswerte Beispiele und spornt dazu an, Vollkommenheit, das höchste Ziel, zu erreichen. Die abstrakte Lehre und die subtilen Gedan ken werden durch das Kleid von Geschichten, Parabeln, Legen den, Allegorien und Erzählungen überaus interessant gemacht. Die erhabenen und abstrakten philosophischen Gedanken und ideale des Hinduismus finden durch eindrucksvolle Geschich ten geradewegs in die Herzen der Massen Eingang.
Die Mythologie ist etwas vermischt mit Geschichte. Es ist schwierig, exakt zwischen Geschichte und Mythologie zu tren nen. Hinter der alten Hindumythologie stehen große Wahrhei ten. Man kann etwas nicht einfach deshalb ignorieren, weil es in einem mythologischen Kleid steckt. Streite nicht. Halte dei nen Mund. Halte deinen Verstand in respektvollem Abstand, wenn du dich mit Mythologie beschäftigst. Der Verstand ist ein Hindernis. Er wird dich täuschen. Gib Arroganz und Eitelkeit auf. Pflege die Liebe zum Imaginären. Setz dich hin wie ein Kind und öffne einfach dein Herz. Dann wirst du die großen Wahrheiten verstehen, die durch die Mythologie enthüllt wer den. Du wirst in das Herz der ($iS und Weisen vorstoßen, die die Mythologie aufschrieben. Du wirst dann wirklich Freude an der Mythologie haben.
Du lernst Geographie mit Landkarten. Es gibt auf der Landkarte keine wirklichen Länder oder Städte, aber es hilft dir, viel über die einzelnen Länder zu erfahren. Genauso verhält es sich mit den Mythen. Man kann die subtilen philosophischen Wahr heiten nur durch Mythen ausdrücken. Das Thema von Mythos und Legende ist nur dazu da, um den Geist für die Wahrheiten der Religion zu interessieren.
Durch die Beschäftigung mit der Mythologie erhältst du ver schiedene gegenständliche Lektionen, um deinen Charakter zu
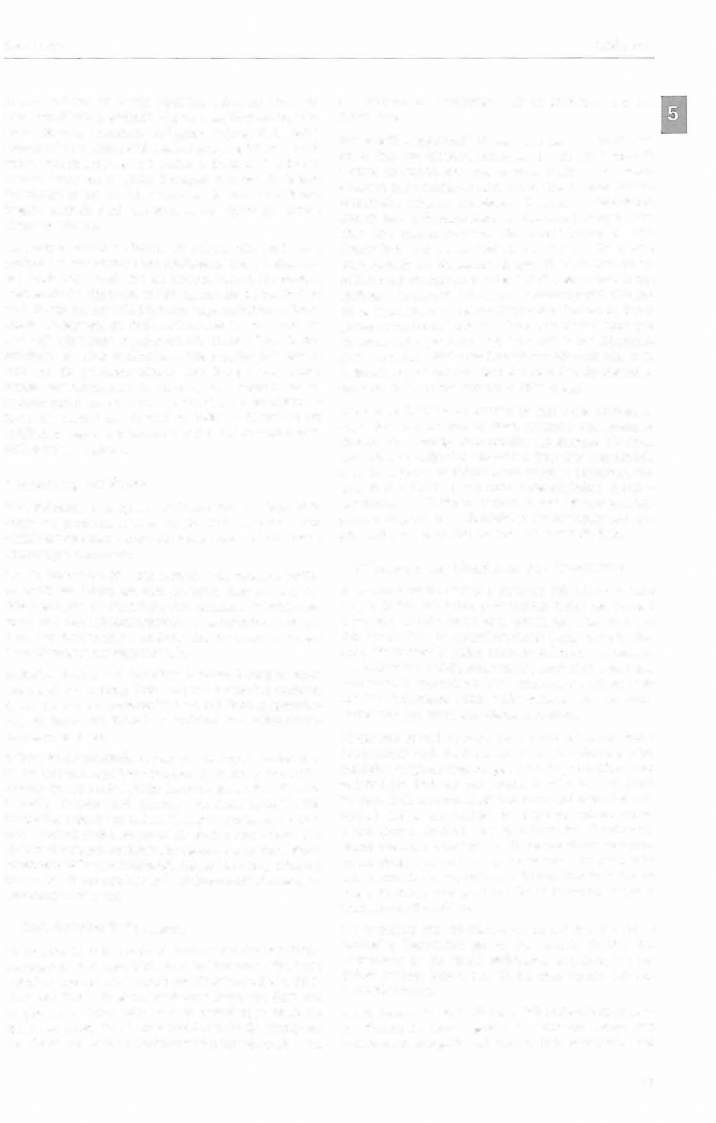
Bhakti-yoga
formen und um ein ideales göttliches Leben zu leben. Die Leben von SrT-räma, SrT-kr�r:ia, BhT�ma, ·Nala, Hariscandra, Lak� ma,:ia, Bharata, Hanumän, Yudhi�thira, Arjuna, STtä, SävitrT, DamayantT oder Rädhä sind Quellen großer spiritueller Inspi ration, um dein Leben, dein Verhalten und deinen Charakter zu formen. Wenn du in einem Zwiespalt bist, was in heiklen Situationen zu tun ist, oder wenn ein Konflikt der Pflichten besteht, wirst du durch das Studium der Mythologie genaue Lösungen erhalten.
Die purärias enthalten Mythen. Die Religion wird durch diese purärias auf sehr einfache und interessante Weise weitergege ben. Auch heute noch sind die purärias beliebt. Die purärias erzählen die Geschichte längst vergangener Zeit. Sie beschreiben auch die für das normale physische Auge unsichtbaren Berei che des Universums. Sie sind sehr interessant zu lesen und ste cken voll Informationen jeder Art. Die Kinder hören die Ge schichten von ihren Großmütter· n. Die parir;fitas (rel. Gelehr ten) und die purohitas (äsram- bzw. Hauspriester) halten kathäs (Veranstaltungen) in Tempeln, an Flussufern und an anderen wichtigen Orten. Bauern, Arbeiter und Basarhänd-ler hören die Geschichten. So wird der Geist der Menschen mit erhabenen idealen und Gedanken erfüllt und zu großen spiri tuellen Höhen inspiriert.
-
Betonung der Praxis
Der Hinduismus versorgt mit spiritueller Nahrung. Yoga ist in erster Linie praktisch. In keiner Religion findet man eine solche Vielfalt von Praktiken und die Darlegung einer solch erhabenen einzigartigen Philosophie.
Der Hinduismus hat für jeden Menschen das passende sädha na (spirituelle Praxis), um dem jeweiligen Temperament, den Fähigkeiten, den Geschmäckern, dem spirituellen Entwicklungs stand und den Lebensumständen zu entsprechen. Dies gilt auch dem Straßenkehrer, Schuster etc. , der seiner normalen Beschäftigung in der Welt nachgeht.
Vedänta-, Hindu-, und Yogalehrer betonen besonders tapas wie Selbstbeherrschung, Entsagung und praktisches sädhana, das am besten dazu geeignet ist, Geist und Sinne zu kontrollie ren, die innere Göttlichkeit zu entfalten und Selbstverwirk lichung zu erreichen.
Religion ist der praktische Aspekt von Philosophie. Philosophie ist der rationale Aspekt von Religion. Die Philosophie des Hin duismus ist keine Lehnsesselphilosophie. Sie ist nicht für intel lektuelle Neugier und sinnlose Debatten gedacht. Die Hinduphilosophie ist ein Lebensstil. Der Hinduphilosoph reflek tiert ernsthaft nach dem Hören der sruti, macht ätma-vicära (Selbsterforschung), meditiert ständig und erlangt dann ätma säk�ätkära (Selbstverwirklichung). Mok�a (Befreiung, Erlösung) ist sein Ziel. Er versucht hier und jetztji"van-mukti (Befreiung zu Lebzeiten) zu erlangen.
-
Hinduistische Strömungen
Ein Fremder ist äußerst erstaunt, wenn er von den verschiede nen Glaubensrichtungen hört, die es im Hinduismus gibt. Diese Vielfalt ist aber nur ein Schmuck des Hinduismus. Sie ist sicher nicht sein Fehler. Es gibt verschiedene Arten von Geist und Temperament. Daher sollte es auch verschiedene Glaubens richtungen geben. Das ist nur natürlich. Das ist die Hauptthese des Hinduismus. Es ist im Hinduismus Platz für jede Seele - von
Hinduismus
der höchsten zur niedrigsten - für ihr Wachstum und ihre Entwicklung.
Der Begriff „Hinduismus" ist sehr dehnbar. Er schließt eine große Zahl von Glaubensrichtungen ein, die miteinander in Verbindung stehen, sich aber in vielen Punkten auch unter scheiden. Der Hinduismus hat in seinem Gefolge verschiedene vedantische Schulen, Shaivismus, Shaktismus, Vishnuismus usw. Er hat verschiedene Kulte und Glaubensrichtungen. Er ist eher eine Bruderschaft von Glaubensrichtungen als eine Einzelreligion mit einem bestimmten Glauben. Er ist eine Gemeinschaft von Glaubensrichtungen. Er ist ein Zusammen schluss von Philosophien. Er entspricht allen Menschen. Er gibt spirituelle Nahrung für jeden, je nach seiner Qualifikation und seiner Entwicklung. Das ist das Schöne des Hinduismus. Daher gibt es keinen Konflikt zwischen den verschiedenen Kulten und Glaubensrichtungen. Kr�r:ia sagt sinngemäß in der „Bhagavad gTtä": ,,In welcher Weise der Mensch sich Mir auch nähert, so heiße Ich ihn willkommen, denn der Weg, den die Menschen von jeder Richtung her aufnehmen, führt zu Mir."
Alle Unterschiedlichkeiten werden im Körper des Hinduismus organisiert und zusammengefasst. Anhänger des sanätana dharma, ärya samäja, deva-samäja, des Jinismus, Sikhismus und brähma samäja sind alle Hindus. Trotz aller Unterschiede in metaphysischen Doktrinen, Arten religiöser Disziplinen, For men ritueller Praktiken und sozialen Gewohnheiten, die es in der Hindugesellschaft gibt, herrscht in allen Hindugruppierun gen grundlegende Gleichförmigkeit in der Konzeption von Reli gion und in den Ansichten über das Leben und die Welt.
-
-
Gründe für das überleben des Hinduismus
Mohammedanische Herrscher regierten siebenhundert Jahre lang in Indien. Die Briten beherrschten Indien zweihundert Jahre lang. Manche traten zwangsweise zum Islam über. Die Zahl der Muslime im ungeteilten Indien betrug neunzig Milli onen. Die Christen in Indien sind zehn Millionen. Die muslimi schen Herrscher und die Briten waren jedoch nicht in der Lage, ganz Indien zu konvertieren. Der Hinduismus besteht nach wie vor. Die hinduistische Kultur bleibt weiterhin vorherrschend. Nichts kann ihre Größe und Wurzel erschüttern.
Hinduismus ist weder Asketentum noch Schwärmerei, weder Polytheismus noch Pantheismus. Er ist eine Synthese aller möglichen religiösen Erfahrungen. Er ist ein ganzheitlicher und vollständiger Blick auf das Leben. Er zeichnet sich durch Toleranz, tiefe Menschlichkeit und hohe spirituelle Ziele aus. Deshalb hat er die Angriffe der Anhänger anderer großer Weltreligionen überlebt. Der Hinduismus ist allumfassend, liberal, tolerant und flexibel. Der Hinduismus ist sehr streng und unnachgiebig, wenn es um die grundlegende Lehre geht. Er ist sehr flexibel in der Anpassung an äußere Umstände und an Dinge, die nicht grundlegend sind. Das ist der Grund, warum er Jahrtausende überlebt hat.
Die Grundlage des Hinduismus wurde auf den Grundstein spiritueller Wahrheiten gelegt. Die gesamte Struktur des Hindulebens ist auf ewige Wahrheiten aufgebaut, die r�is (Seher) erfahren hatten. Deshalb hat diese Struktur Jahrtau sende überdauert.
Der Hinduismus ist hinsichtlich der Tiefe und Großartigkeit sei ner Philosophie herausragend. Seine ethischen Lehren sind hochstehend, einzigartig und erhaben. Er ist sehr flexibel und
75

Bhakti-yoga
an jedes menschliche Bedürfnis angepasst. Er hat viele große Heilige, Patrioten, Herrscher und pati-vratäs hervorgebracht. Je mehr man darüber weiß, desto mehr wird man ihn schätzen lernen. Je mehr man davon lernt, desto mehr wird er erleuch ten und das Herz zufriedenstellen.
-
-
Jesus von Nazaret
Vor rund zweitausend Jahren inkarnierte sich Gott auf diesem Planeten, um der Menschheit den Pfad zum ewigen Leben zu zeigen, indem Er göttliches Leben auf dieser Erde vorlebte.
Jesus [hebr. Yesüa - Erlösung, Errettung, Heil] war kein gewöhn licher Mensch. Er war die göttliche Kraft und Liebe, die sich auf dieser Erde mit einer bestimmten göttlichen Absicht inkarniert hatte. Seine Herabkunft stand im Zeichen der Erfüllung des göttlichen Plans zum Ablauf dieser Welt. Das wird aus der Art Seiner Geburt und ihrem Hintergrund deutlich.
-
Die Art der Geburt Christi und ihre Bedeutung
Zeit und Umstände der Geburt Jesu enthüllen ein tiefes spiritu elles Gesetz. Jesus Christus [hebr. Maschiach - Gesalbter] wur de nicht in einem großartigen Palast geboren. Er hatte keine reichen oder gebildeten Eltern. Er wurde auch nicht im strah lenden Tageslicht vor den Augen der ganzen Menschheit gebo ren. Jesus wurde an einem einfachen, bescheidenen Ort gebo ren - in der Ecke eines Stalls. Er wurde einfachen, armen Eltern geboren, die nichts hatten, dessen sie sich hätten rühmen kön nen, außer ihres makellosen Charakters und ihrer Heiligkeit. Auch wurde Er in Dunkelheit geboren, in der dunkelsten Stun de der Mitternacht, als wirklich niemand etwas davon wusste, außer einigen wenigen von Gott gesegneten Menschen.
Diese Umstände stehen dafür, dass spirituelles Erwachen zu dem Suchenden kommt, der:
-
vollkommen bescheiden, demütig und „schlicht im Gei ste" ist. Wahre Demut ist eine unerlässliche Grundlage auf dem spirituellen Weg.
, auf jeden Wunsch nach weltlichem Wohlstand und auf den Stolz der Gelehrsamkeit verzichtet und stattdessen ein einfaches und frommes Leben führt.
-
unter ähnlich bescheidenen Umständen wie Jesus geboren wurde, d. h. ohne dass die Welt davon Kenntnis hatte; in der Finsternis der Nacht.
So findet die Herabkunft des Christusbewusstseins nicht im Außen, sondern im Innern statt, wenn die selbstbezogene Individualität erlischt, in der Verneinung des relativen Ichs. Das ist die Geburt zum göttlichen Leben. Vom Geheimnis dieser
76
Jesus von Nazaret
Geburt sprach Jesus in sanften Worten zu Nikodemos (Gelehrter, heimlicher Anhänger Jesu). Der gute Mann ver stand nicht ganz, was Jesus meinte, als Er ihn lehrte, dass der Mensch wiedergeboren werden müsse, um das Reich Gottes zu erreichen. ,,Wie kann das sein?", fragte Nikodemos. Darauf hin erklärte ihm Jesus, dass diese Geburt im Innern stattfindet, dass sie nicht den Körper betrifft, sondern den Geist. Eine sol che innere geistige Geburt ist die Grundlage, auf der das Höchste erreicht und wahres Glück erfahren wird.
-
-
-
Die Einfachheit und Kraft der Worte Jesu
Die Art, wie Jesus lebte und lehrte, war einfach und trotzdem erhaben. Seine Lehrmethode war etwas Besonderes. Jesus war kein par:,<;lita {Gelehrter) im klassischen Sinne - Er hatte weder akademische Grade noch einen Doktortitel. Nach außenhin war Er bloß ein einfacher Handwerker, doch sobald Er sprach, hör ten die Menschen Ihm zu. Seine Reden und Aussagen waren knapp und prägnant formuliert - fast wie Aphorismen. Sie waren von außergewöhnlicher Kraft und Weisheit, die nicht von dieser Welt ist. Die Worte Jesu waren lebendig und glühend. Sie brannten sich in die Tiefen des Bewusstseins Seiner Hörer.
Wenn Jesus sprach, kamen Seine Worte aus den Tiefen einer grenzenlosen Liebe und eines unendlichen göttlichen Mitge fühls, das immer und immer wieder durchdrungen war von einem allesverzehrenden, mächtigen Verlangen, den Menschen Gutes zu tun, zu dienen, zu helfen und sie zu erlösen. Dieses Mitgefühl, die Menschen zu reinigen, zu erheben und zu ret ten, stellt wahrlich das heilige Herz Jesu dar. Diese Liebe beleb te Seine Worte mit einer göttlichen Kraft, die Seine Worte im Herzen derer, die das Glück hatten, Ihn zu hören, fest verwur zelte.
-
Das Christentum
Im Christentum gibt es keine komplizierte Philosophie oder sädhana {spirituelle Praktiken). Das hat seinen Grund. Jesus hatte es überwiegend mit einfachen Menschen aus Galiläa zu tun. Er gab ihnen in erster Linie moralische Unterweisungen und zeigte ihnen den Weg rechtschaffenen Lebens. Er ließ jede schwer verständliche philosophische Theorie und subtile intel lektuelle Untersuchungen beiseite und lehrte den Menschen, wie er leben, was er denken und tun soll. Zu diesem Zweck klei dete Er auch die höchsten Wahrheiten spirituellen Lebens in einfache Erzählungen und Parabeln, die auch der einfache Mann von der Straße leicht begreifen konnte. Jesus brachte die tiefste Weisheit spirituellen Lebens in die Form einfacher Gleichnisse und brachte sie so den Menschen nahe.
Jesus erklärte die wahre Natur Gottes, des Menschen und der Welt, in der der Mensch lebt. Er lehrte die Menschen, ihre Sichtweise der Welt und der Dinge zu verändern. Er lehrte sie zu erkennen, dass die Welt, in der sie leben, das Königreich Gottes ist, wenn sie ihre Sicht des Lebens vom materialisti schen zum spirituellen Aspekt hin ändern.
Jesus hinterließ keine geschriebenen Aufzeichnungen Seiner großartigen Lehren. Er übermittelte all Seine Lehren mündlich. Seine Worte wurden ein paar Generationen später niederge schrieben.*
Obwohl Jesu Worte später oft missverstanden, verfälscht oder unvollständig wiedergegeben wurden, haben sie trotzdem zweitausend Jahre überlebt, weil sie so machtvoll waren und aus dem Herzen eines verwirklichten Meisters kamen.
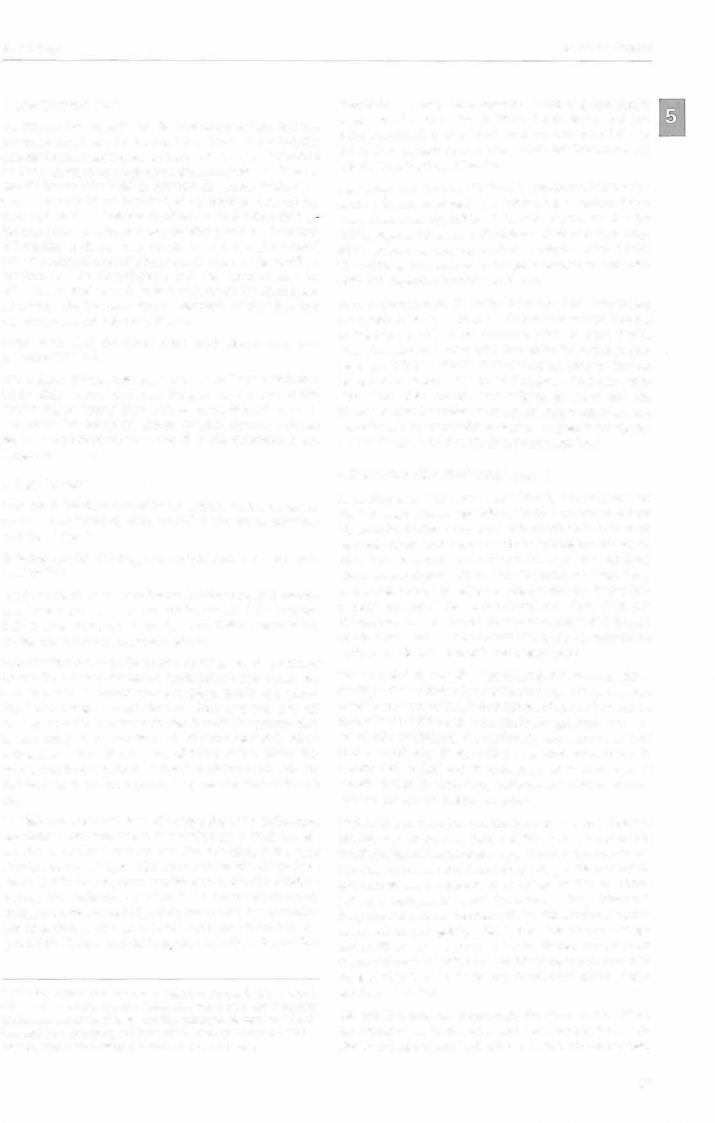
Bhakti-yoga
-
Die Stimme Jesu
Die Stimme Jesu ist wahrhaft die Stimme des ewigen Wesens. Durch Ihn drückt sich der Ruf des Unendlichen an das Endliche aus, des kosmischen Wesens an das Individuum, der Ruf Gottes an den Menschen. Seine göttliche Stimme ist deshalb dieselbe wie die Stimme aller heiligen Schriften der großen Weltreligio nen. Im Grunde ist die Botschaft, die Er predigte, eins mit der Botschaft all dieser heiligen Schriften. Es ist der Weg der Ver leugnung des rein Körperlichen, Relativen, und der Betonung des Geistes. Es ist der Weg, das niedere Selbst zu „kreuzigen", um eine ruhmvolle Auferstehung des Geistes und die letztliche Erhebung in. die Unendlichkeit und das Hinübertreten ins Göttliche zu erreichen. Es ist kein anderer als der upanishadi sche Weg, die Überwindung des anätman (Nichtselbst) und das Annehmen des Lebens in ätman.
Jesus sagt: ,,[...] Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon." [Mt 6:24)
Mit anderen Worten beinhaltet Jesu Lehre: Trenne dich; ver binde dich. Trenne dich vom Hängen an den materiellen Dingen dieser vergänglichen Welt. Verbinde dich mit dem ewi gen spirituellen Schatz des ätman. Christus lehrt uns auf diese Weise den großartigen Weg, uns über alle Relativitäten und Sorgen zu erheben.
-
Jesu Leben
Jesus ist die Verkörperung all Seiner Lehren. In Jesus sehen wir vollkommene Heiligkeit, Güte, Freundlichkeit, Gnade, Sanftmut und Gerechtigkeit.
Er sagte: ,,Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben;
[ ...]." [Joh 14:6)
Er ist die Verkörperung des Besten, Erhabensten und Schöns ten. Er ist das vollkommenste Vorbild, das Ideal der Mensch heit. Er ist ein Philosoph, Prophet, Lehrer, Heiler, Reformer etc. Immer praktizierte Er das, was Er lehrte.
Eine überirdische, makellose Reinheit ruhte wie ein göttlicher Mantel über Seiner erhabenen Persönlichkeit. Sein Leben war eine wundervolle Kombination von jfiäna, bhakti und karma. Eine ideale integrale Entwicklung von Kopf, Herz und Hand hat Sein Leben zu einem Beispiel für die Menschheit gemacht, dem in alle Ewigkeit nachzueifern ist. Christus war sich seiner untrennbaren Einheit mit dem höchsten Selbst immer be wusst. Trotzdem drückte sich Seine tiefe Hingabe und Liebe für den Vater in Form von Gebeten, Lobpreis und Verherrlichung aus.
Im täglichen Leben war Jesus die wahrhaftige Personifizierung des Geistes von karma-yogo. Sein Wirken als Mensch war ein ununterbrochener Dienst an den Notleidenden. Seine Füße strebten stets dorthin, wo Hilfe gebraucht wurde. Wenn Seine Hände sich bewegten, dann geschah es nur, um den Bedräng ten und Unterdrückten zu helfen. Seine Zunge sprach sanfte, honiggleiche Worte des Mitgefühls, des Trostes, der Inspiration und Erleuchtung. [Er konnte jedoch auch gerechten Zorn zei gen, als die Händler und Geldwechsler am heiligen Tempel ihre
* Das Neue Testament besteht aus 27 Schriften, die ursprünglich in griechi scher und Aramäischer Sprache festgehalten wurden: Die vier Evangelien, die Apostelgeschichte, 21 Briefe und die Apokalypse. Sie wurden alle recht kurz nach Jesu Kreuzigung und Auferstehung niedergeschrieben - als viele Zeugen, darunter auch einige der zwölf Jünger, noch lebten.
Jesus von Nazaret
Geschäfte machten]. Jesus erweckte, erhob und verwandelte all jene, die Ihn anblickten. Er fühlte, dachte, sprach und han delte ausschließlich zum Wohle anderer. Inmitten all dessen weilte Er im ungebrochenen Bewusstsein der Erkenntnis: ,,Ich und der Vater sind eins." IJoh, 10,301
Sein Leben war das eines Heiligen in sahaja-samädhi (andau erndem Überbewusstsein). Jesu Wirken legt angesichts Seiner entschlossensten Opposition, Seiner Verfolgung und des Ihm entgegengebrachten Unverständnisses stillen und doch höch sten Heroismus an den Tag. Er dient als reinstes Beispiel dafür, wie spirituell Suchende Verlockungen widerstehen und Wün sche und Begierden überwinden können.
Jesus war Gott selbst! Die heilige Schrift der Bibel erinnert uns immer wieder an diese Tatsache. Doch warum musste Er so viel an Verfolgung und Leiden erdulden? Hätte Er _Seine Feinde nicht durch Seinen bloßen göttlichen Willen überwältigen kön nen? Ja, natürlich hätte Er das jederzeit tun können, aber als höchste Inkarnation der Liebe gehörte Jesu Leiden zum göttli chen Plan. Sein makel- und selbstloses Leben soll die Menschen zum Nacheifern anregen, deswegen trat Er auf und handelte wie ein menschliches Wesen - in diesem Tun verkör pert Er die große Predigt, die Er auf dem Berge hielt.
-
Jesus und der moderne Mensch
Jesus blutete und litt unaussprechliche Qualen am Kreuz um der Erlösung der Menschen willen. Heute-von Seinem ewigen Sitz im Reich Gottes aus - blutet Sein mitfühlendes Herz noch sehr viel stärker. Jesus wurde nicht nur zu Lebzeiten von vielen Menschen verkannt und verleugnet. Auch der moderne Mensch wandelt weiterhin im Dunkeln (trotz der heiligen Bibel, welche Sein Leben und Wirken sowie den Weg der Rechtschaf fenheit strahlend hell beleuchtet), auf dem Pfad der Untugenden und des Elends. Wenn das mitfühlende Herz Jesu für die Unwissenden schon so sehr blutet, wie viel mehr blutet es für jene, die Sein Licht willentlich ignorieren?
Willst du wirklich, dass die Menschheit dem Retter und Erlöser (Yesüa) auf diese Weise ihre Dankbarkeit erweist? Nein, gewiss nicht! Es ist nie zu spät, sich Gott zuzuwenden. Lies (erneut) die Evangelien! Meditiere über die strahlende göttliche Form von Jesus! Wie mitfühlend, wie sanftmütig und liebevoll Er war! Und dennoch war Er sich selbst gegenüber ohne Milde. Er wandte sich radikal von Versuchungen ab - nicht, weil Er jemals wirklich in Versuchung hätte geführt werden können, sondern um uns ein Beispiel zu geben.
Prüfungen und Versuchungen kommen nur, um vom Tapferen überwunden zu werden. Tests und Situationen, in denen die Ernsthaftigkeit deines Strebens erprobt wird, kommen, um dei nen Geist zu stärken und dein Herz zu reinigen. Sie sind gleich sam eine Weise, um Jesus in dir zu entdecken. Diesen Prüfun gen zu unterliegen ist Schwäche. Fasten, beten, Unterschei dung üben und die Hindernisse mit der Hilfe der Gnade Gottes zu überwinden, ist geistiges Heldentum. Den Sieg zu erringen und zu fühlen, zu erkennen und zu verkünden, dass dich die Gnade Gottes dazu befähigte -das ist wahre Demut. Demut ist Tugend; Schwäche ist Fehlschlag. lerne diese große Lektion aus dem Leben Jesu.
Lies immer wieder die Bergpredigt. Meditiere darüber. Nimm die Anweisungen Gottes eine nach der anderen, Monat für Monat und sei sorgsam bestrebt, sie in die Praxis umzusetzen.
77
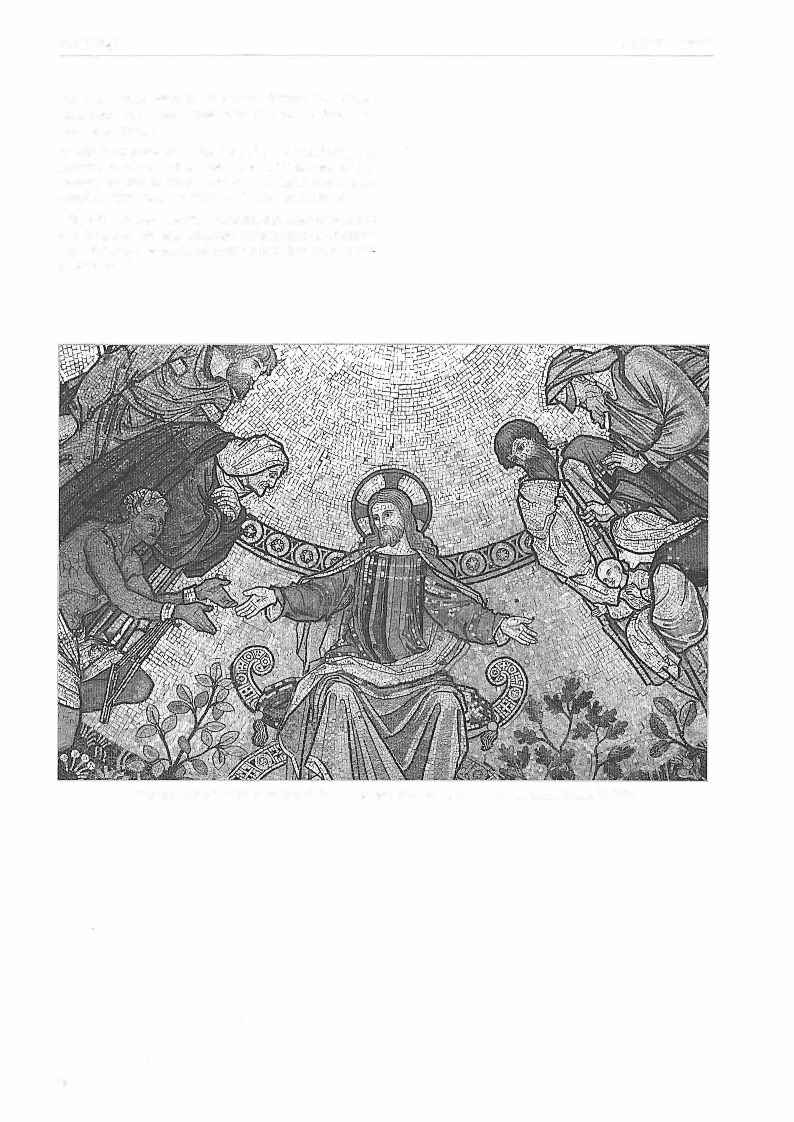
Bhakti-yoga Jesus von Nazaret
Auf diese Weise wirst du zu einem würdigen Kind Gottes heranwachsen. Auf diese Weise wirst du Jesus in deinem eige nen Herzen finden.
Es gibt heutzutage viele, die aufrichtig und wahrhaftig den Lehren Jesu folgen. In ihren Herzen hat sich Jesus wieder ver körpert, um dich zu führen und dich zum Reich Gottes (zum Vater) zu leiten, wo Jesus Christus höchster Wohnsitz ist.
Möget ihr olle auf dem Pfad wandeln, den Jesus vorgegeben hat! Möget ihr alle eine lebendige Verkörperung der Bergpre digt sein! Möget ihr das Reich Gottes in euch hier undjetzt ver wirklichen!
Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. [Mt is,201
78
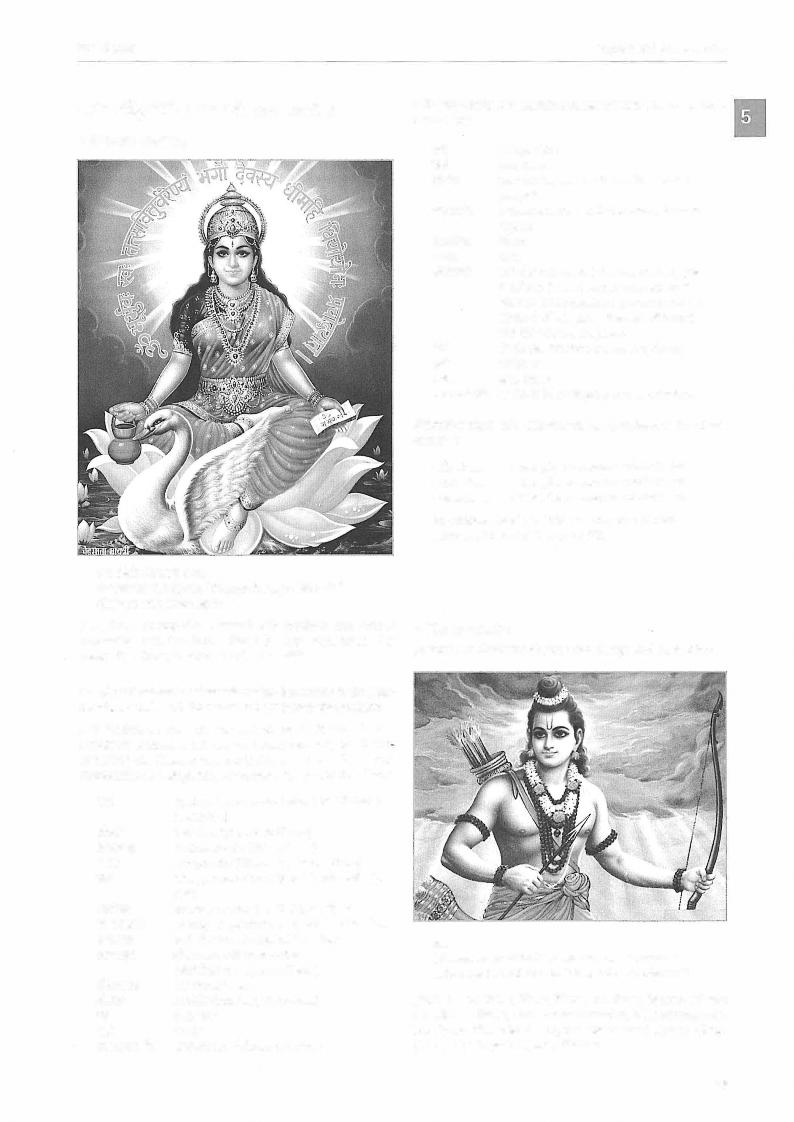
Bhakti-yoga
-
-
-
GäyatrT- und räma-mantra
-
Gäyatri- und räma-mantra
Wörtliche Herleitung einzelner Sanskrit-Worte von ihrem Wort stamm her:
-
GäyatrT-mantra
orn tad savitr
vareoya
bhargas deva dhimahi
heilige Silbe das; dieses
hervorbringend; auch Bez. für den Son nengott
wünschenswert, erstrebenswert, hervor ragend
Glanz Gott
von der Wurzel dhä (setzen, stellen), ,,wir möchten [in uns] setzen, aufnehmen"; spätere Interpretation: ,,wir möchten an etwas denken, über etwas meditieren", von der Wurzel dhi/ dhyä.
dhT Gedanke, Einsicht, Schau, Eingebung yab welcher
nab uns, unser
pracodayät er möge in Bewegung setzen, antreiben
Gäyatri-mantra mit anuloma-viloma-prär_,äyäma (Wechsel atmung):
-
Einatmen
-
Anhalten
-
Ausatmen
-
1 Mal gäyatri-mantra wiederholen 4 Mal gäyatri-mantra wiederholen 2 Mal gäyatri-mantra wiederholen
orn bhür bhuvab svab
tat savitur varef)yam 'bhargo devasya dhimahi I dhiyo yo nab pracodayät II
,,Om, Erde, Atmosphäre, Himmel. Wir möchten dies erstre benswerte Licht des Gottes Savitr [in uns] aufnehmen, der unsere Eingebungen anregen soll." [Kirtana 610]
Der gäyatri-mantra in seiner spirituellen Bedeutung in der Inter pretation von Swami Sivananda und moderner Yogameister:
„Wir meditieren über die Herrlichkeit des Schöpfers, der das Universum erschaffen hat, der Verehrung verdient, der die Ver körperung des Wissens und des Lichts ist, der alle Fehler und Unwissenheit beseitigt. Möge Er unseren Verstand erleuchten!"
Visualisiere dabei ein Licht, das von oben in dich hineinstrahlt und dich ganz erfüllt.
-
Räma-mantra
(mantra zur Wiedergewinnung von Energie und Inspiration)
orn
bhür bhuvab svab tat
savitur varer:iyam bhargo devasya
dhimahi dhiyo yo
nab pracodayät
Symbol des para-brahman (des höchsten Absoluten)
bhü-loko (physische Ebene)
ontarik?a-loka (Astralebene)
svarga-/oka {Himmels-, Kausalebene) 'Das', param-ätman (das höchste Selbst),
Gott
isvara {persönlicher Gott), Schöpfer würdig, angebetet und verehrt zu werden Befreier von Unwissenheit; Glanz glänzend, Jnäna-sva-rüpa
(Weisheit der eigenen Natur) wir meditieren
buddhi (Intellekt, Verstehen) der; wer
unser
erleuchten, führen, antreiben
om
sri-räma räma rämeti 'rame räme mano-rame I sahasra-näma tat tu!yam 'räma-näma varänane ff
,,'Glückhafter Räma, Räma, Räma', mit diesen Worten erfreue ich mich an Räma, dem Herzerfreuenden, o Herzerfreuende. Der Name Rämas ist der Hymne der tausend Namen Vi?r:ius gleich, o Schöngesichtige." [Kirtana 609]
79
Bhakti-yoga Götter und Göttinnen

-
-
Götter und Göttinnen
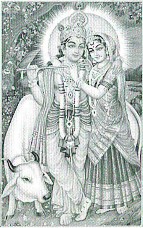
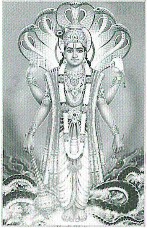
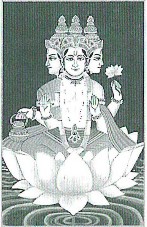
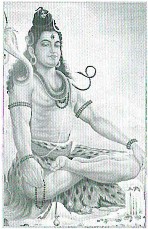
Km1a & Rädhä Vi�r:iu Brahmä Siva
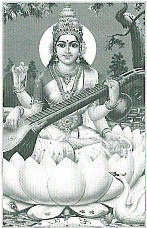
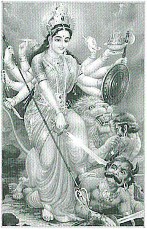
r
,Q.J..
-
V,
3_,
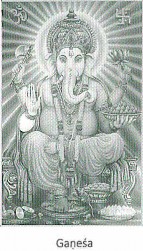
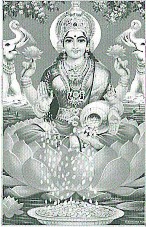 SarasvatT Durgä
SarasvatT Durgä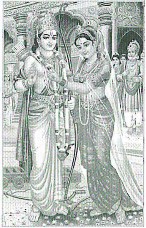
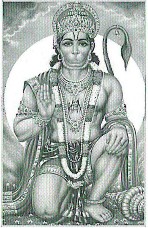
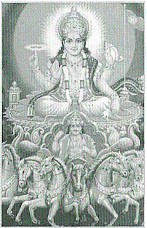
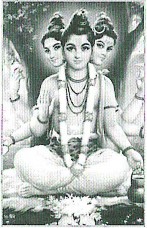
Räma & STtä Hanumän Sürya Dattätreya
80
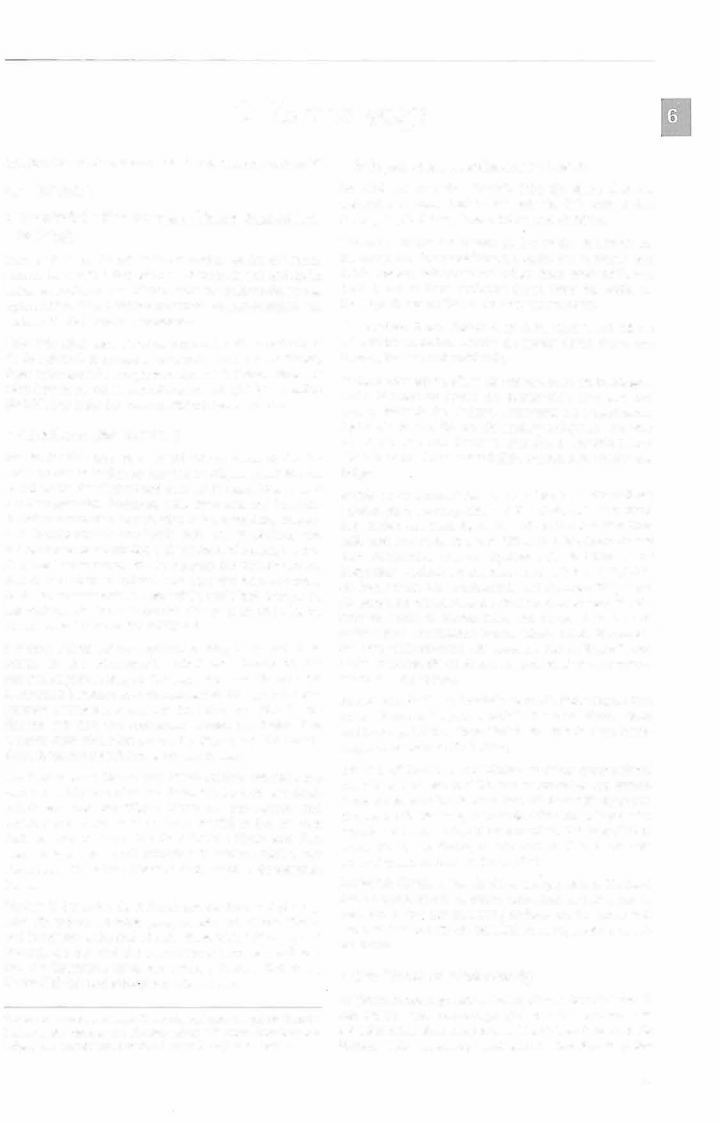
-
Karma-yoga
(vgl. ,,Swami Sivanandas Inspiration & Weisheit für Menschen von heute")*
-
-
Dienen
-
Der göttliche Plan zur menschlichen Entwicklung ist Arbeit
Liebe zu Gott und Dienst für den Menschen ist das Geheimnis wahren Lebens. Der Sinn wahren Lebens ist Dienst und Opfer. Leben ist bestimmt zum Dienen, nicht zur Selbstsucht. Bringe Opfer! Erfülle deine Pflichten ordentlich, mit Aufrichtigkeit. Die Vorteile für dich kommen ungebeten.
Halte dein Leben zum Dienst an anderen bereit. Je mehr Ener gie du aufwendest, um andere zu erheben und ihnen zu dienen, desto mehr göttliche Energie wird durch dich fließen. Diene. Du wirst herrschen. Diene den Menschen mit göttlichem bhava (Gefühl). Der Krebs der Individualität wird verschwinden.
-
Selbstloses Dienen reinigt
-
-
-
-
-
Was ist das Ziel von seva (Dienen)? Warum dienst du den Ar men und der leidenden Menschheit im Allgemeinen? Warum dienst du der Gesellschaft und dem Land? Durch Dienen wird das Herz gereinigt. Egoismus, Hass, Eifersucht und Überheb lichkeit verschwinden. Demut, reine Liebe, Sympathie, Toleranz und Barmherzigkeit entwickeln sich. Die Vorstellung des Getrenntseins verschwindet. Selbstsucht wird beseitigt. Deine Sicht des Lebens weitet sich. Du beginnst das Einssein und die Einheit des Lebens zu spüren. Dein Herz wird weit, und deine Ansichten werden weit und großzügig. Schließlich erlangst du Selbsterkenntnis. Du erkennst das Eine in allem und alles im Einen. Deine Freude ist überwältigend.
Der erste Schritt auf dem spirituellen Weg ist der selbstlose Dienst an der Menschheit. Selbstloses Dienen ist der Schlüsselbegriff am Weg zur Rettung. Selbstloser Dienst an der Menschheit bereitet den Aspiranten auf die Erlangung des kos mischen Bewusstseins und auf das Leben von Einheit und Einssein mit Gott vor. Aspiranten müssen am Beginn ihre gesamte Aufmerksamkeit auf die Beseitigung von Selbstsucht durch fortgesetztes selbstloses Dienen richten.
Durch selbstloses Dienen und Barmherzigkeit entwickle das Herz und reinige den niedrigen Geist. Reinige dein Herz durch selbstlosen und demütigen Dienst an den Armen und Bedrängten und mache es zu einem tauglichen Sitz, um Gott darin wohnen zu lassen. Nur der selbstlose Dienst kann dein Herz reinigen und es mit göttlichen Tugenden erfüllen. Nur Menschen, die reinen Herzens sind, werden Gottesschau haben.
Wachse in der Liebe, der Reinheit und der Selbstaufopferung. Lebe für andere. Du wirst gesegnet sein. Selbstloses Dienen und kosmische Liebe sind wie die Flüsse Gariga (Ganges) und Yamuna, die das Feld des menschlichen Herzens bewässern und die überreiche Ernte von Frieden, Freude, Wohlstand, Unsterblich-keit und atma Jnana reifen lassen.
-
Anm.: Die Ratschläge Swami Sivanandas beziehen sich auf die Situation Indiens in den vierziger und fünfziger Jahren. Mit etwas Vorstellungsver mögen kann man sie jedoch auch auf unsere heutige Zeit beziehen.
-
-
Gelegenheiten zu selbstlosem Dienen
Die Welt bist du selbst. Deshalb liebe alle, diene allen, sei freundlich zu allen, beziehe alle mit ein. Sieh Gott in den Armen, Unglücklichen, Unterdrückten und Niedrigen.
Werde ein Diener der Menschen. Das ist das Geheimnis zur Erlangung von Gottverwirklichung. Suche den Niedrigen und Bekümmerten; heitere sie auf, bringe ihnen einen Strahl von Trost, indem du ihnen großzügig dienst. Tröste die Mutlosen. Beruhige die Verzweifelten. Du wirst gesegnet sein.
Diene deinen Eltern, älteren Menschen, Lehrern und Gästen mit göttlichem bhava. Wasche die Kleider deiner Eltern, von Älteren, Kranken und mahatmas.
Speise die Hungrigen, pflege die Kranken, tröste die Bedrängten und erleichtere die Sorgen der Sorgenvollen. Gott wird dich segnen. Bekleide die Nackten. Unterrichte die Ungebildeten. Speise die Armen. Erhebe die Niedergeschlagenen. Die Welt brennt vor Leid und Kummer. Erwache, o Mensch! Diene! Diene liebevoll. Diene unermüdlich. Gelange zum Frieden des Ewigen.
Erwirb dir Grundkenntnisse in einfachen (und alternativen) Hausrezepten, Homöopathie und Naturheilkunde. Nun diene den Kranken und Bedürftigen. Und mit der Kenntnis über Erste Hilfe leiste stets Erste Hilfe in Notfällen. Hole Medikamente aus dem Krankenhaus oder der Apotheke für die hilflosen und bedürftigen Nachbarn. Gehe, wenn es dir möglich ist, täglich in ein Krankenhaus oder wöchentlich, und kümmere dich, so gut du kannst, um die Kranken, die nicht bezahlen können. Verteile Orangen, wenn du kannst. Setze dich zu den Patienten und sprich einige ermutigende Worte. Lächle dabei. Wiederhole das Vi?r:,u-sahasra-nama (die „tausend Namen Vi?r:,us") oder andere mantras, die du kennst. Sage, du wirst morgen wieder kommen - und komme.
Sammle alte Kleider und verteile sie an die Bedürftigen. Wenn du die Straße entlanggehst, verteile Essen an Lahme, Blinde und hungrige Mäuler. Diene täglich eine Stunde ohne Bezah lung in einer sozialen Einrichtung.
Triff dich mit Freunden und Mitgliedern deiner Gruppe einmal pro Woche oder alle zwei Wochen zu sat-sanga und kTrtana. Entwickle ein verständnisvolles Herz. Hilf deinen jüngeren Brü dern am spirituellen Weg. Erhebe sie. Wirf Licht auf ihren Weg. Erwarte von ihnen keine Vollkommenheit. Sei freundlich zu ihnen. Sie tun ihr Bestes, so wie auch du dein Bestes tust. Du wirst wachsen, wenn du ihnen hilfst.
Schließlich überlege, wie du deine Energie, deinen Verstand, deine Bildung, deinen Reichtum, deine Kraft und alles, was du hast, am besten zur Besserung anderer, die im Leben weit unten stehen, und für die Gesellschaft im Allgemeinen einset zen kannst.
-
Kein Dienst ist minderwertig
Es gibt im karma-yogo keinen hochwertigen oder minderwerti gen Dienst. Unter karma-yogTs gibt es keine besseren oder schlechteren. In einer Maschine sind der kleinste Bolzen und die kleinste Feder wesentlich, damit sich die Maschine als großes
81
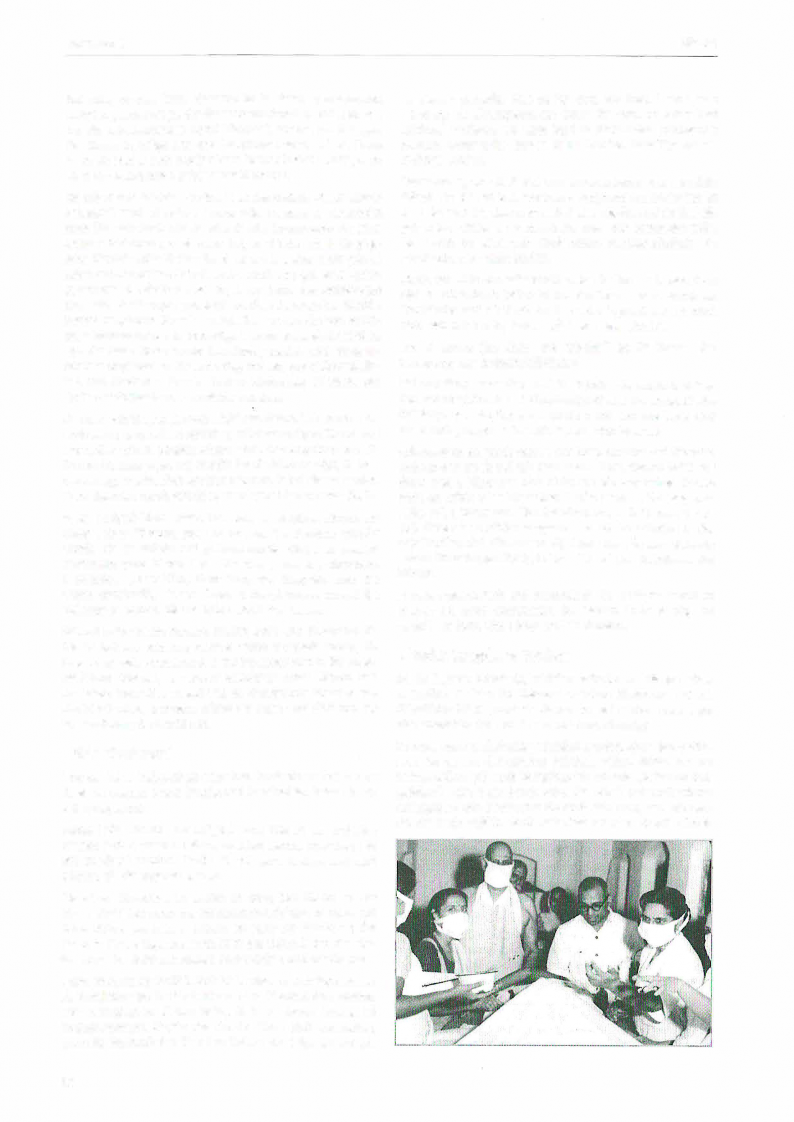
Karma-yoga
Rad ruhig drehen kann. Genauso ist in einem gemeinsamen Unterfangen derjenige, der die geringste Arbeit macht oder sich um ein unbedeutendes Detail kümmert, ebenso am Gelingen der Sache beteiligt wie der Hauptorganisator selbst. Denn wenn ein Fehler auch nur in einem kleinen Detail auftritt, kann nicht der vollständige Erfolg erreicht werden.
Ein roher, ungebildeter Aspirant hat das Gefühl: ,,Mein Lehrer behandelt mich wie einen Diener oder Lakaien. Er verwendet mich für unbedeutende Arbeiten." Wer karma-yaga in seiner wahren Bedeutung verstanden hat, wird jede Arbeit als yogi sche Aktivität oder Gottesdienst sehen. In seiner Sicht gibt es keine minderwertige Arbeit. Jede Arbeit ist püja, eine Opfer zeremonie, die du Gott darbringst. Im lichte des karma-yaga sind alle Handlungen geheiligt. Der/die Aspirant/in, der/die immer ungeheure Freude an Arbeiten findet, die von weltli chen Menschen als minderwertige Dienste angesehen werden, und der diese Dinge immer bereitwillig macht, wird ein dyna mischer yogTwerden. Er wird völlig frei sein von Selbstgefällig keit und Egoismus. Er wird keinen Rückschlag erleiden. Der Krebs des Stolzes kann ihm nichts anhaben.
Lies die Autobiographie von Mahatma GändhT. Er macht nie mals einen Unterschied zwischen minderwertigem Dienst und wertvoller Arbeit. Straßenkehren und Latrinenputzen war für ihn der höchste yaga. Das war für ihn die höchste püja, Gottes verehrung. Er selbst hat Latrinen geputzt. Er hat dieses unwirk liche kleine Ich durch verschiedenartigstes Dienen ausgelöscht.
Viele hochgebildete Menschen kamen in seinen asram, um unter seiner Führung yaga zu lernen. Sie dachten, GändhT würde sie irgendwie auf geheimnisvolle Weise in seinem Privatraum yaga lehren, ihnen Stunden geben in prar:,ayamo, Meditation, Abstraktion, Erweckung der kur:,r;JolinT usw. Sie waren enttäuscht, als von ihnen verlangt wurde, zuerst die Toiletten zu putzen. Sie verließen sofort den asram.
GändhT selbst flickte Schuhe, mahlte Mehl und übernahm die Mahlarbeit von anderen, wenn sie nicht imstande waren, die ihnen zugeteilte Arbeit für den Tag im asram zu tun. Wenn ein gebildeter Mensch, ein neuer Bewohner seines asram, sich zum Getreidemahlen zu gut war, tat GändhT vor seinen Augen die Arbeit selbst, und dann führte der Mann vom nächsten Tag an bereitwillig die Arbeit aus.
-
Wie dient man?
Lass dir keine Gelegenheit entgehen, anderen zu helfen und ihnen zu dienen. Diene freudig und bereitwillig. Zeige nie ein Märtyrergesicht.
Nutze jede Minute bestmöglich zum Dienst an anderen. Erwarte nichts, wenn du einem anderen dienst, oder wenn du ein Geschenk machst. Danke für die gute Gelegenheit zum Dienen, die dir gegeben wurde.
Dienst an Menschen ist Dienst an Gott. Der Dienst an der Menschheit darf nicht nur mechanisch erfolgen. Er muss mit atma-bhavo geschehen. Dienen ist yoga zur Reinigung des Herzens für die folgende Herabkunft des Lichts. Jeder, der tätig ist, muss den Geist mit diesem bhavo drillen und bearbeiten.
Diene anderen im Gefühl, Gott ist in allen, nimmt dein Dienen als Verehrung an. Die Welt ist nur eine Manifestation Gottes. Den Menschen zu dienen heißt, Gott zu dienen. Dienen ist Gottesverehrung. Vergiss das nie. Du dienst Gott am besten, wenn du Ihn durch den Dienst an Seinen Geschöpfen verehrst.
82
Dienen
Im Dienen bedenke, dass du für Gott arbeitest. Mache jede Handlung als Tsvararpor:,o, ein Opfer für Gott. Du wirst bald spirituell wachsen. Du wirst bald in Göttlichkeit verwandelt werden. Untersuche immer deine Motive. Beseitige selbst süchtige Motive.
Denke daran, dass Gott dich vom Inneren heraus zum Handeln drängt. Du bist nur Sein Werkzeug. Aufgrund von lchdenken ist man der Ansicht, dass man selbst alles macht, und ist deshalb gebunden. Wirke im Bewusstsein, dass der kosmische Wille dich treibt. Du wirst mehr Kraft haben, weniger Eitelkeit. Die Arbeit wird dich nicht binden.
Durch das Licht des selbststrahlenden Gottes in dir kannst du wirken. Fühle das in jedem Moment deines Lebens. Handle als Treuhänder und nicht als Besitzer oder Eigentümer. Du wirst nicht gebunden sein, denn es gibt dann kein „Mein".
Ora et labora (/at. ,,bete und arbeite") ist die Formel des
karmo-yagT zur Gottverwirklichung.
Hilf und diene, aber kämpfe nicht. Schaffe Harmonie und Frie den und nicht Zwietracht, Unstimmigkeit und Trennung. Stecke Beleidigungen ein, wenn du auf sie triffst. Lob und Tadel sind nur Schwingungen in der Luft. Erhebe dich über sie.
Arbeite stets, so gut du kannst, mit Konzentration und Hingabe. Gehe in der Arbeit auf. Gib dein ganzes Herz, deinen Geist und deine Seele. Kümmere dich nicht um die Ergebnisse. Denke nicht an Erfolg oder Misserfolg. Denke nicht an Vergangenes. Habe volles Vertrauen. Übe Selbstvertrauen. Sei immer freud voll. Habe einen kühlen ausgewogenen Geist. Arbeite um der Arbeit willen. Sei kühn und mutig. Dann wirst du ganz sicher in jedem Unterfangen Erfolg haben. Das ist das Geheimnis des Erfolgs.
Arbeite systematisch und methodisch. Sei begierig darauf zu dienen. Sei auch aufmerksam im Dienen. Ruhe wenig und schlafe nur kurz. Ohne Schmerz kein Gewinn.
-
Verhaftungsloses Wirken
Es ist äußerst schwierig, wirklich selbstlos zu dienen. V iele Menschen steigen im Gewand selbstlos Wirkender auf die öffentliche Bühne, aber sie dienen nur sich selbst. Auch man che sannyasins tun das. Ist das nicht sehr traurig?
Es muss ohne Verhaftung gehandelt werden, ohne das Gefühl, man tut es um der eigenen Reinheit willen. Wirke nur um Gottes willen, gib auch Verhaftungen auf wie „Möge es Gott gefallen". Man muss bereit sein, die Arbeit jederzeit wieder aufzugeben, wie interessant sie auch sein mag, und wie sehr sie dir auch gefällt. Auch Anhaften an eine Arbeit bindet.
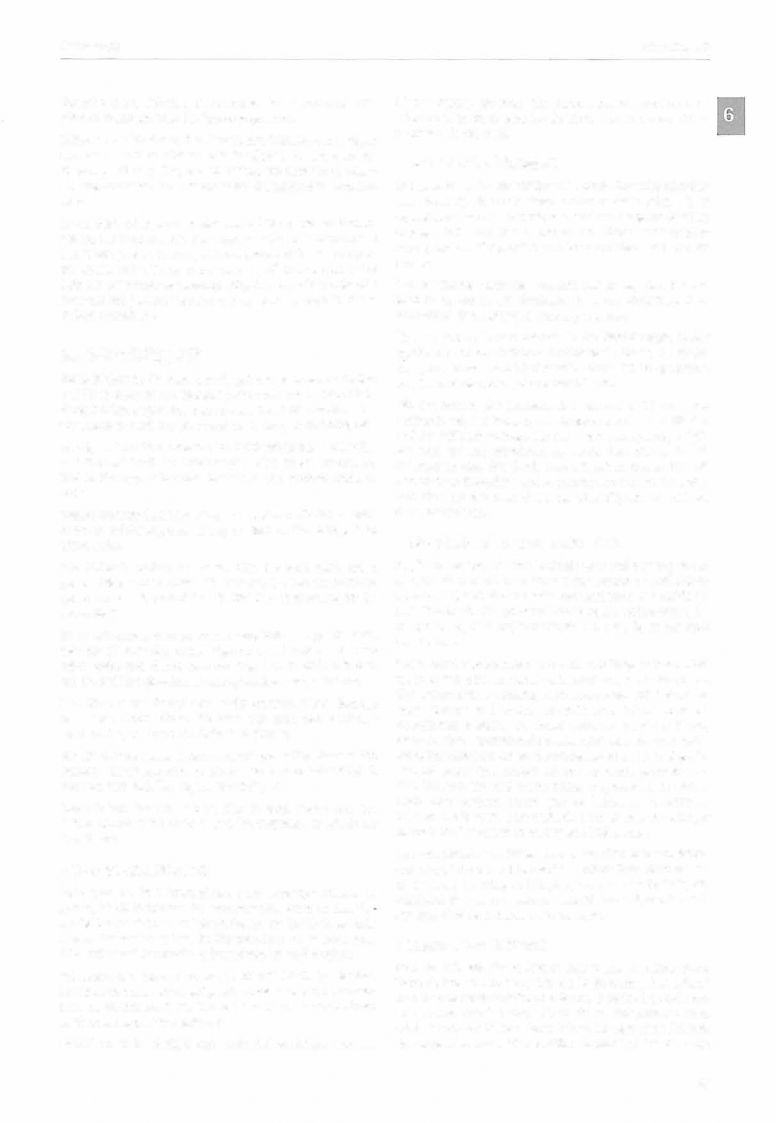
Karma-yoga
Verstehe diese subtilen Geheimnisse des karma-yoga und schreite mutig am Weg des karma-yoga voran.
Möge es dein Ideal sein, den Armen, den Kranken, den Heiligen und dem Land zu dienen; die Gefallenen zu erheben; die Blinden zu führen; alles, was du besitzt, mit anderen zu teilen; den Verzweifelten Trost zu spenden; die Leidenden aufzuhei tern!
Es sei dein Schlagwort, vollkommenes Vertrauen zu Gott zu haben; den Nächsten wie dein eigenes Selbst zu lieben; Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit dem ganzen Geist und der gan zen Seele; Kühe, Tiere, Kinder und Schwächere zu schützen! Dein Ziel sei Gottverwirklichung! Möget ihr alle als wundervolle
}Tvan-muktas (lebend Befreite) und dynamische yogTs in dieser Geburt erstrahlen!
-
-
Wohltätigkeit
Wohltätigkeit ist die Bereitschaft, gut von anderen zu denken und ihnen Gutes zu tun. Wohltätigkeit ist universelle Liebe. Sie ist Großzügigkeit gegenüber den Armen. Sie ist Wohlwollen. Das, was gegeben wird, um die Armut zu lindern, ist Wohltätigkeit.
Im allgemeinen Sinn bedeutet Wohltätigkeit Liebe, Wohlwollen und Freundlichkeit. Im theologischen Sinn ist sie universelles Wohlwollen gegenüber den Menschen und höchste Liebe zu Gott.
Wahre Wohltätigkeit ist der Wunsch, anderen nützlich zu sein, ohne an Belohnung oder Ertrag zu denken. Wohltätigkeit ist tätige Liebe.
Wohltätigkeit beginnt zu Hause. Aber sie muss nach außen gehen. Die ganze Welt ist dein Zuhause. Du bist ein Weltbür ger. Entwickle ein großzügiges Gefühl des Wohlwollens für die ganze Welt.
Es ist eine Sünde, Geld zu horten. Aller Reichtum gehört Gott. Wer nur als Verwalter seines Eigentums lebt und sein Geld als milde Gabe gibt, denkt, dass das Eigentum in Wahrheit Gott gehört und lebt glücklich. Er erlangt mok?a, ewigen Frieden.
Das Wasser der Gariga wird nicht weniger, wenn durstige Menschen davon trinken. So kann sich auch dein Reichtum nicht verringern, wenn du Wohltätigkeit übst.
Gib ein Zehntel deines Einkommens für wohltätige Zwecke. Gib freudig, schnell und ohne zu zögern. Verschiebe Wohltätigkeit nicht bis zum Tod. Übe täglich Wohltätigkeit.
Beten bringt dich auf halbem Weg zu Gott, Fasten zum Tor Seines höchsten Wohnsitzes und Wohltätigkeit verschafft dir den Einlass.
-
Was ist Wohltätigkeit?
Jede gute Tat ist Nächstenliebe. Dem Durstigen Wasser zu geben, ist Wohltätigkeit. Ein ermunterndes Wort an den Ver zweifelten zu richten, ist Wohltätigkeit. Ein bisschen Medizin einem Kranken zu geben, ist Wohltätigkeit. Einen Dorn oder Glassplitter auf der Straße zu beseitigen, ist Wohltätigkeit.
Freundlich und liebevoll zu sein, ist Wohltätigkeit. Ein bisschen Schaden, den man dir zugefügt hat, zu vergessen und zu verge ben, ist Wohltätigkeit. Ein freundliches Wort, das man einem Leidenden sagt, ist Wohltätigkeit.
Wohltätigkeit beschränkt sich nicht auf Maßstäbe von der
Wohltätigkeit
Menge Geldes, die man gibt. Schicke positive Gedanken an leidende Menschen. Bete für ihr Wohl. Das wird mehr Gutes bewirken als viel Geld.
-
-
-
-
Arten der Wohltätigkeit
Die beste Form der Wohltätigkeit ist vidyä-däna (das Mitteilen von Weisheit). Wenn du einem Armen zu essen gibst, will er erneut essen, wenn er hungrig wird. Weisheit hingegen beseitigt Unwissenheit, den Grund, warum ein Körper angenommen wurde, und zerstört gänzlich alle Arten von Elend und Leid für immer.
Die zweitbeste Form der Wohltätigkeit ist es, den Kranken Medizin zu geben. Die drittbeste Form von Wohltätigkeit ist anna-däna, den Hungrigen Nahrung zu geben.
Übe am Anfang Unterscheidung in der Wohltätigkeit. Später praktiziere unterschiedslose Wohltätigkeit. Wenn du fühlst, dass jedes Wesen eine Manifestation Gottes ist, ist es unmög lich, festzustellen, wer gut und wer böse ist.
Gib den Armen, den Kranken, den Hilflosen und jenen ohne Hoffnung. Gib den Waisen, den Altersschwachen, den Blinden und den hilflosen Witwen. Gib den sädhus, sannyäsins, religiö sen und sozialen Einrichtungen. Danke dem Mann, der dir Gelegenheit gibt, ihm durch Wohltätigkeit zu dienen. Gib mit der richtigen Einstellung und verwirkliche Gott durch Mildtätig keit. Ehre sei den Menschen, die Wohltätigkeit im richtigen Geist praktizieren.
-
Die Erhabenheit einer stillen Gabe
Es gibt Menschen, die Wohltätigkeit üben und begierig darauf sind, ihre Namen mit ihren Fotos in den Zeitungen veröffentlicht zu sehen. Dies ist eine tamasige (unreine) Form der Wohltätig keit. Dies ist überhaupt keine Wohltätigkeit. Wohltätigkeit, die für sich wirbt, hört auf, Wohltätigkeit zu sein. Es ist nur Stolz und Protzerei.
Preise deine Nächstenliebe und dein wohltätiges Wesen nicht an. Es darf in deinem Herzen kein Jubel sein, wenn Menschen dich wegen deines wohltätigen Wesens preisen. Nächstenliebe muss spontan und uneingeschränkt sein. Geben muss zur Gewohnheit werden. Du musst äußerste Freude erfahren, wenn du gibst. Du darfst nicht denken: ,,Ich habe eine sehr wohl tätige Tat vollbracht. Ich werde Glückseligkeit im Himmel genie ßen. Ich werde im nächsten Leben reich wiedergeboren wer den. Die gute Tat wird meine Sünde wegwaschen. In meiner Stadt oder meinem Bezirk gibt es keinen so wohltätigen Menschen wie mich. Man weiß, dass ich ein sehr wohltätiger Mensch bin." Protzerei ist niedrig und bedauerlich.
Übe Wohltätigkeit im Stillen. Mache sie nicht bekannt. Brüste dich nicht. Was die rechte Hand tut, soll die linke nicht wissen. Es ist leicht, im Krieg zu kämpfen, aber es ist schwierig, ein Geschenk im Stillen zu machen, ohne Stolz und Eigenlob zu zei gen und ohne es anderen weiterzusagen.
-
Niedere Wohltätigkeit
Prof. Dr. XYZ gab einem Armen eine Decke als milde Gabe. Dann dachte er: ,,Ich hätte ihm die Decke nicht geben sollen." Sein Herz war aufgewühlt und belastet. Er wollte die Decke von dem Armen wiederhaben. Wenn du so Wohltätigkeit übst, wirst du keinerlei Nutzen davon haben. Du wirst keine Reinheit des Herzens erlangen. Viele weltlich eingestellte Menschen tun
83
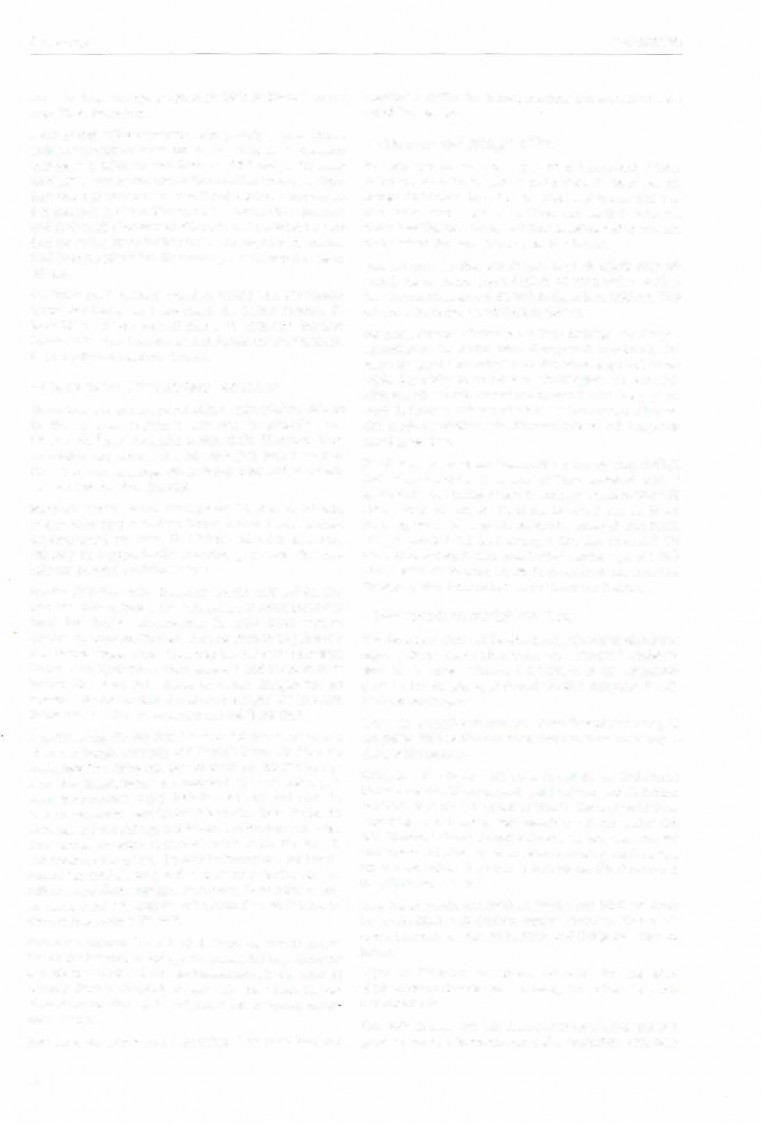
Karma-yoga
nur gute Taten von dieser Art. Diese Welt ist übervoll von so mildtätigen Menschen.
Jeder ist sich selbst gegenüber sehr großzügig. Viele trinken erstklassige Milch oder den besten Tee, bieten ihren Freunden zweitklassige Milch an und Fremden drittklassige. Sie essen erstklassige Früchte und bieten die verfaulten Freunden, Nach barn und Bediensteten an. Man findet solche herzzerreißen den Zustände in vielen Häusern reicher Leute. Wie schändlich sind doch solche Menschen! Wie klein und verhärtet ihr Herz doch ist! Ihr Los ist tatsächlich nicht nur beklagenswert, sondern auch höchst bedauerlich. Sie wissen gar nicht, was sie eigent lich tun.
Gib Freunden, Nachbarn, Fremden, Gästen und Dienstboten immer das Beste, das beste Essen, die besten Früchte, die beste Milch und die beste Kleidung. Du wirst eine immense Freude, Stärke und immenses Glück daraus ziehen. Praktiziere das und erkenne selbst den Nutzen.
-
Die tragische Lage geiziger Menschen
Die meisten Menschen sind heutzutage selbstsüchtig. Geld ist ihr Blut. In ihren Gesichtern liest man Freudlosigkeit und Hässlichkeit. Ärger, Habsucht, Leidenschaft, Eifersucht, Hass, Depression und andere üble Eigenschaften haften an dem Menschen, der das geizige Wesen in sich trägt, und sie verzeh ren das Innerste seines Herzens.
Wenn ein geiziger Mensch fünfzigtausend Rupien besitzt, wird er sich nicht über sein Geld freuen, sondern noch weitere hunderttausend ersehnen. Ein Millionär wird sich wünschen, Milliardär zu werden. Solche Menschen geben aus Nächsten liebe nicht einmal ein Stück Kuchen.
Sie sind Geizhälse erster Klasse. Sie horten Geld auf die eine oder die andere Weise. Ihr Geld geht für Arztrechnun-gen drauf. Ihre Kinder verschwenden ihr Geld durch Trinken, Spielen und ausschweifendes Leben. Sie sterben an gebroche nem Herzen wegen eines Misserfolgs bei der Bank oder eines Fehlers beim Spekulieren. Beklagenswert und bedauerlich ist ihr Los. Sie haben nicht einmal an einem einzigen Tag gut gegessen. Sie haben nicht einmal einen einzigen Tag lang gute Kleider getragen. Sie sind eigentlich nur Geldbewacher.
Es gibt Beamte, die sich vom Dienst zurückziehen und an den Ufern der Gangä, Narmadä und Yamunä leben. Sie üben ein wenig japa (Wiederholung eines mantra) und Meditation und lesen das „Yogaväsi�tha", die upani�ads etc. und meinen, sie seien }Tvan-muktas. Dabei befinden sie sich weiterhin im Zustand von moha (Verblendung) bezüglich ihrer Kinder. Sie hinterlassen ihren Söhnen und Enkeln ihre Pension und geben nicht einmal ein Stück Kuchen als milde Gabe. Sie sind die Verkörperung des Geizes. Sie sind hoffnungslose, getäuschte Seelen! Ein Geizhals kann auch in tausend Geburten nicht an Selbstverwirklichung denken. Jesus sagt: ,,Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, denn dass ein Reicher ins Reich Gottes komme." [Mk 10:2s1
Geiz ist ein schwerer Fluch. Er ist ein Feind der Einheit und ein Freund der Selbstsucht. Geizige Menschen sind ungeeignet für den spirituellen Pfad. Schon das Beisammensein mit ihnen ist höchst gefährlich für geistig ausgerichtete Menschen. Sie ver giften die ganze Atmosphäre aufgrund ihrer korrupten, verhär teten Herzen.
Man muss ein sehr weites Herz haben. Nur dann kann das
84
Wohltätigkeit
advaitische Gefühl der Einheit, samadhi und kosmische Liebe entwickelt werden.
-
Wie man Wohltätigkeit übt
Teile mit anderen das, was du hast. Führe immer einige Süßig keiten in deiner Tasche mit dir und verteile sie täglich an die Armen. Praktiziere dies sofort. Im Teilen liegt Freude und Frie den. Teilen erzeugt kosmische Liebe und zerstört Habsucht. Teilen beseitigt Selbstsucht und lässt Selbstlosigkeit entstehen. Teilen reinigt das Herz. Teilen entwickelt Einheit.
Teile mit anderen alles, was du hast, physisch, geistig oder spi rituell. Das ist wahrer yajfia (Opfer). Du wirst größer werden. Du wirst das Einssein und die Einheit des Lebens erfahren. Dies wird zu advaitischer Verwirklichung führen.
Du musst danach dürsten, jeden Tag wohltätige Handlungen auszuführen. Du darfst keine Gelegenheit versäumen. Du musst Gelegenheiten schaffen. Es gibt keinen yoga und keinen yajfia, der größer ist als sattwige Wohltätigkeit spontaner Art. Almosen müssen mit der rechten inneren Einstellung gegeben werden. Almosen müssen reichlich gegeben werden. Almosen dürfen nie bescheiden sein. Almosen müssen mit Sympathie gegeben werden.
Das Essen, das du einem Gast anbieten kannst, mag dürftige Kost sein, aber wenn du es ihm mit Liebe anbietest, wird es große Kraft, Nahrhaftigkeit und Geschmack erhalten. Wenn du deinen Gast mit reichen Gerichten bewirtest und sagst: ,,In Ordnung, wenn du schon einmal da bist, schlag dir den Bauch voll", verwandelt sich die Nahrung in Gift. Egal ob es sich um einen Verwandten, Freund oder Bettler handelt, egal von wel cher Qualität die Nahrung ist, die du gibst, gib sie mit Liebe und Zuneigung. Gastfreundschaft ist die Essenz der Nahrung.
-
Nächstenliebe reinigt das Herz
Negatives kann durch Nächstenliebe ausgelöscht werden. Jesus sagte: ,,Nächstenliebe überwindet viele Sünden." Nächsten liebe ist ein starker Läuterer des Herzens. In der „Bhagavad gTtä" findest du: ,, Yajfia, Nächstenliebe und Mäßigung sind die Läuterer der Klugen."
Wenn ein Mensch sein geiziges Wesen überwinden kann, ist ein großer Teil des sadhana getan. Dann ist etwas Grundlegen des erreicht worden.
Entwickle diese Eigenschaft. Dann kannst du ein König unter Königen werden. Wenn du gibst, gehört dir der ganze Reichtum der Welt. Geld wird dir zufließen. Dies ist das unabänderliche, unerbittliche, erbarmungslose Gesetz der Natur. Daher gib. Gib. Unseren Lebensunterhalt bestreiten wir aus dem, was wir von anderen erhalten, unseren Lebenssinn aber aus dem, was wir anderen geben. Das ist das Geheimnis des Überflusses und des göttlichen Lebens.
Viele haben Macht, Berühmtheit, Frieden und Glück nur durch ihr großmütiges Herz erreicht. Geizige Menschen können nie davon träumen, all dies zu besitzen und Erfolg im Leben zu haben.
Wenn du Reichtum und Kinder wünschst, übe viel Mild tätigkeit. Wenn du weise werden willst, diene alten Menschen und mahatmas.
Sieh Gott überall. Teile mit allen. Der Großteil sollte anderen gegeben werden. Vernichte den tief verwurzelten Geiz. Dein
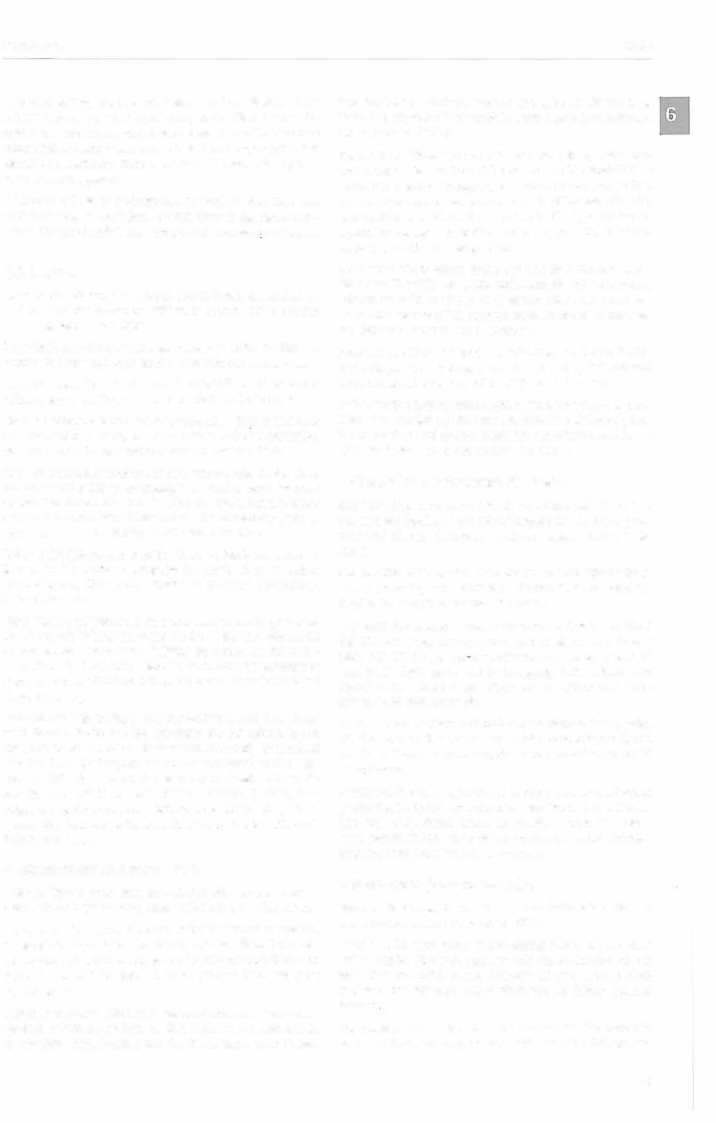
Karma-yoga
Herz wird weit werden. Du wirst einen breiten Blickwinkel des Lebens haben. Du wirst eine neue, weite Sicht haben. Du kannst die Hilfe fühlen, die dir vom Bewohner deines Herzens zuteil wird. Du kannst eine unbeschreibliche Erregung göttlicher Ekstase und spiritueller Wonne erfahren. Dies wird dir ungeheu re innere Stärke geben.
0 Mensch! Gib viel in Wohltätigkeit. Du wirst Frieden, Reichtum und Wohlstand hier genießen. Du wirst später in den Himmel ein gehen. Du wirst Reinheit des Herzens und auch moksa erlangen.
-
-
Liebe
-
Liebe ist das Gesetz des Lebens. Lieben heißt, das .Gesetz zu erfüllen. Und das Gesetz zu erfüllen, bedeutet ewigen Frieden und immerwährendes Glück.
Diese Welt kam aus der Liebe. Sie besteht in Liebe. Sie löst sich letztlich in Liebe auf. Liebe ist die Triebkraft des Universums.
Liebe ist Leben. Liebe ist Freude. Liebe ist Wärme. Liebe ist das goldene Band, das Herz an Herz und Seele an Seele bindet.
Liebe ist konstruktiv und schöpferisch. Liebe bindet und baut auf. Liebe ist das Prinzip der Erneuerung. Liebe ist tatsächlich eine Substanz, die man vertrauensvoll verwenden kann.
Liebe ist etwas, das konkret existiert. Wer das Gesetz der Liebe mit wissenschaftlicher Genauigkeit anwendet, kann Wunder wirken. Das Gesetz der Liebe ist eine viel großartigere Wissen schaft als jede moderne Wissenschaft. Das Gesetz der Liebe ist vorherrschend unter Heiligen und guten Menschen.
Leben heißt lieben. Lieben heißt leben. Du lebst, um lieben zu lernen. Du liebst, um zu lernen, im Ewigen zu leben. Ein Leben ohne Glauben, Liebe und Hingabe ist trostlose Vergeudung. Es ist wahrer Tod.
Keine Tugend ist größer als die Liebe; kein Schatz ist größer als die Liebe; kein Wissen ist größer als die Liebe; kein dharma ist größer als die Liebe; keine Religion ist größer als die Liebe; denn Liebe ist Wahrheit; Liebe ist Gott. Gott ist verkörperte Liebe. In jedem Zoll Seiner Schöpfung kannst du wahrlich Seine Liebe erkennen.
Liebe ist der unmittelbare Weg zur Wahrheit und dem König reich Gottes. Sie ist das Lebensprinzip der Schöpfung. Sie ist der höchste Ausdruck von Seelenkraft. Sie ist die Gesamtheit aller Pflichten der Religion. Sie ist der Zauberstab in den Hän den des Gläubigen, durch den er die ganze Welt erobert. Sie war die Triebkraft hinter Mirä, Rädhä, Tukäräm, TulsTdäs, Gau räriga, den gottberauschten safts, Mansoor (Abü 1-MughTth al Husain ibn Mansür al-Hallädsch), Shams Tabriez (Shams-i Tabr1z1) und Jesus.
-
Leidenschaft und reine Liebe
Liebe zu Körper oder Haut ist Leidenschaft. Liebe zu Gott ist
prem, Hingabe. Sie ist reine Liebe. Liebe um der Liebe willen.
Jemanden zu lieben, um einen selbstsüchtigen Vorteil zu erzielen, ist selbstsüchtige Liebe. Sie bindet dich an diese Erde. Alle Lebewesen mit näräya,:ia-bhöva als Manifestationen Gottes zu lieben, ist reine Liebe. Reine Liebe ist göttliche Liebe. Sie führt zur Befreiung.
Mancher Ehemann liebt seine Frau nicht um seiner Frau willen, sondern er liebt sie um seiner selbst willen. Er ist selbstsüchtig. Er erwartet Sinnesfreuden von ihr. Wenn Lepra oder Pocken
Liebe
ihre Schönheit zerstören, endet seine Liebe zu ihr. In seiner Liebe liegt physische Leidenschaft. Darin liegt tiefe Selbstsucht. Diese Liebe ist käuflich.
Bei käuflicher Liebe kann es zwischen den beiden, Liebendem und Geliebter, kein wahres Glück geben. Das ist selbstsüchtige Liebe. Ohne wahre Zuneigung aus tiefem Herzen gibt es kein Element des Opfers. Also kommt es zu Streitigkeiten, Kämpfen und Unfrieden im Haus. Es herrscht ein ständiges Tauziehen. Irgendwie machen sie weiter und schleppen sich in einem trost- und freudlosen Leben dahin.
Auch Prostituierte zeigen einige Zeit lang ihren Kunden gegen über eine überfülle von Liebe, süßes Lächeln und Honigworte, solange sie Geld von ihnen zu erwarten haben. Kann man das Liebe oder wahres Glück nennen? Sage ehrlich. Es ist Schurke rei, Taktieren, Gaunerei und Heuchelei.
Jede irdische Liebe ist hohl, hat Misstöne, versteckte Zweifel und Mängel. Aber wahre, reine Liebe ist reich, tief, voll und fehlerlos. Sie ist ewig, unveränderlich und unbegrenzt.
Selbstsüchtige Leidenschaft sucht Befriedigung durch andere. Aber reine göttliche Liebe versucht, den/die Geliebte(n) glück lich zu machen und schöpft Glück aus dem Glück des anderen. Liebe ist Opfer. Lieben heißt teilen und dienen.
• Dienen ist der Ausdruck der Liebe
Liebe schwingt in Form von Dienst, Barmherzigkeit, Großzügig keit und Wohlwollen. Dayä (Wohltätigkeit) ist ein aktiver posi tiver und ahif!)sä (Nichtverletzen) ein passiver Ausdruck der Liebe.
Passive Güte allein genügt nicht. Aktive, positive Güte ist über aus notwendig, um spirituelle · Fortschritte zu machen. Der/die Aspirant/in muss stets tätig sein.
Der Geist des Dienens muss in dir verwurzelt sein. Der Geist des Dienens muss dir angeboren und zu eigen sein. Es darf nicht nur ein bloßes Zur Schau-Stellen sein. Jeder Dienst ist leer, wenn darin keine Liebe, Zuneigung, Aufrichtigkeit und bhäva (reine Hingabe) ist. Wenn du mit bhäva und Liebe dienst, steht Gott hinter dir.
Buddha, Jesus, Sarikara und Mohammed dienten. Diene, liebe, gib. Wer sich an diese Anweisungen hält, kann schwere Zeiten und harte Tage durchmachen, da er vom himmlischen Strahl erleuchtet wird.
Bemühe dich, andere glücklich zu machen, und du wirst selbst glücklich sein. Sprich ein aufmunterndes Wort. Lächle freund lich. Tue etwas Gutes. Diene ein wenig. Trockne die Tränen eines Verzweifelten. Ebne einem Menschen einen steinigen Weg. Du wirst große Freude empfinden.
• Visva-prem (kosmische Liebe)
Verehre die Armen, Unterdrückten und Bedrängten. Sie sind deine Götter. Sie sind deine ersten Götter.
Liebe alle. Du wirst mehr Nutzen daraus haben, als aus einer Million yajfias (Opfern), Askesen und vratas (Gelübden) der Welt. Sieh das Glück deines Nächsten als dein eigenes Glück und sieh den Schmerz deines Nächsten als deinen eigenen Schmerz.
Der Mensch ist eins. Gott ist eins. Liebe ist eins. Das Gesetz ist eins. Die Verwirklichung ist eins. Wir alle sind Früchte des
85
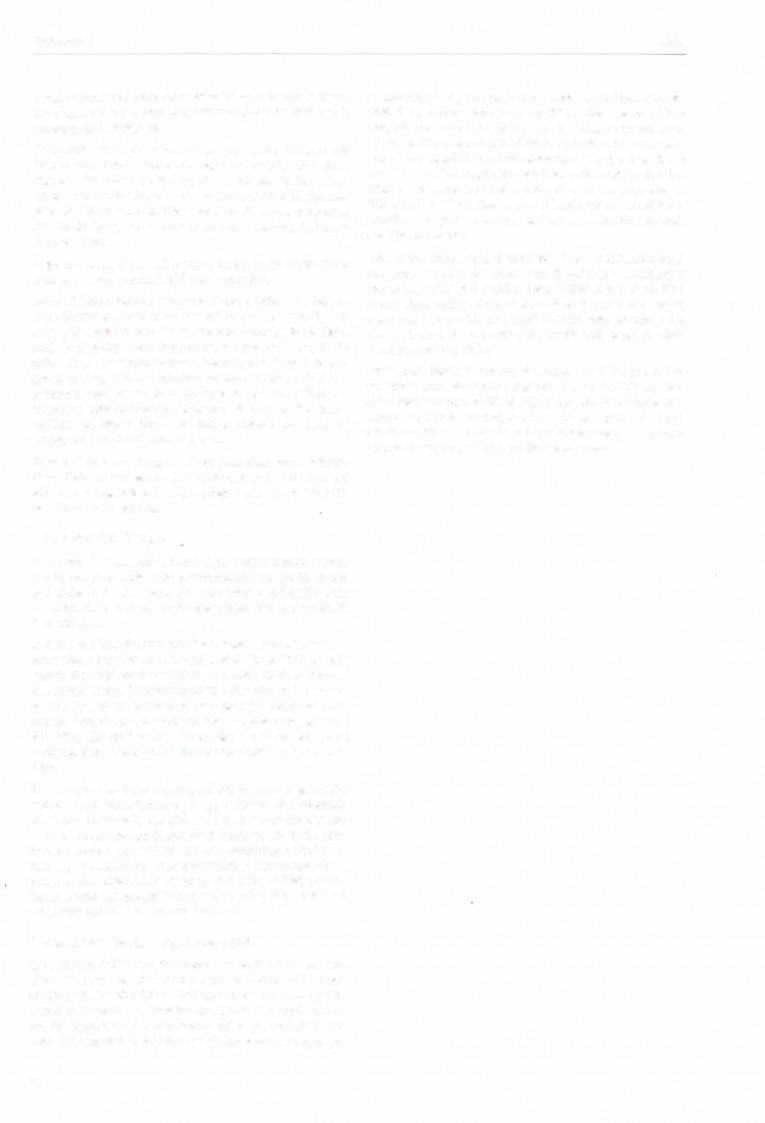
Karma-yoga
einen Baumes und Blätter des einen Zweiges. Es gibt in dieser Welt keine Fremden oder Unbekannten. Jeder ist Gott, der in Entwicklung begriffen ist.
Fühle dich eins mit allem Lebendigen. Lebe friedlich mit Freund und Feind. Alle Menschen sind Glieder des einen Körpers. Die ganze Schöpfung ist die Familie Gottes. Liebe Gottes gesamte Schöpfung. Liebe auch das Blatt eines Baumes; liebe die T iere; liebe die Vögel; liebe die Pflanzen; liebe alles. Das ist der Weg, um das Geheimnis zu erkennen, das allem zugrunde liegt.
Folge der Religion der Liebe, ganz egal ob du ein Christ, Jude, Moslem, Hindu, Buddhist, Sikh oder Parse bist.
Wahre Religion besteht nicht aus rituellen Bräuchen, Bädern und Pilgerreisen, sondern aus der reinen Liebe zu allen. Kosmi sche Liebe schließt alles ein und ist allumfassend. Reine Liebe schließt niemanden von ihrer warmen Umarmung aus. Sie ist offen genug, um auch den Bescheidensten auf dieser Erde mit einzubeziehen, von der winzigen Ameise bis zum mächtigen Elefanten, vom verurteilten Gefangenen bis zum mächtigen Herrscher, vom schlimmsten Schurken bis zum berühmtesten Heiligen auf dieser Erde. Hass trennt Mensch von Mensch, Nation von Nation und Land von Land.
Stolz und Egoismus trennen einen Menschen vom anderen. Hass, Stolz und Egoismus sind Schöpfungen des Geistes. Sie sind nur das Ergebnis von Unwissenheit. Sie können vor der rei nen Liebe nicht bestehen.
• Der Ruf der Stunde
Hass erzeugt Hass. Liebe erzeugt Liebe. Furcht erzeugt Furcht. Das ist das unveränderliche psychologische Gesetz. Es ist das natürliche Recht der Liebe, der Kraft Gottes, auf dieser Erde vorzuherrschen und alle Kräfte des Hasses und des Bösen zu überwältigen.
In der Liebe liegt die Rettung aller Wesen. Liebe ist die Hoff nung dieser dunklen und einsamen Welt. Diese Welt braucht Führer, die erfüllt sind mit Wohlwollen, dem Geist der Zusam menarbeit, Liebe, Opferbereitschaft, Mitgefühl und Toleranz. In der Pflege dieser kosmischen Liebe liegt der individuelle spi rituelle Fortschritt, das Wohlergehen der Gemeinschaft und der Friede der ganzen Welt. Mach dich daher ans Werk und verbreite diese Botschaft der kosmischen Liebe in der ganzen Welt.
Gehe an jeden moha/lä (Nachbarschaft), in jedes Haus. Mache ki"rtana. leite Gemeinschaftsgebete. Verbreite die Botschaft der Liebe, der Einheit, des Wohlwollens, des Dienens, des Op fers, der Zusammenarbeit und der Sympathie. Möge die spiri tuelle Botschaft der Einheit und des Göttlichen aufrufen zu Einheit, Freundschaft, freundschaftlicher Zusammenarbeit, möge sie die Herzen aller erreichen und Liebe und Brüderlich keit im Busen der Menschheit erwecken. Möge die ganze Welt von einem liebevollen Herz umgeben sein.
• Selbstlose Liebe - das Lebensziel
Die Heiligen, Seher und Propheten der Welt haben von der Liebe als dem Ziel, der Absicht und dem Sinn des Lebens gesprochen. Die räsa IT/ä von SrT-kr$r:ia ist voll prem und göttli cher Geheimnisse. Das Zerreißen der Kleider der gopTs bedeu tet die Zerstörung des lchdenkens. SrT-kr$r:ia hat mit Seiner Flöte Liebe gepredigt. Buddha war ein Meer von Liebe, er gab
86
Liebe
seinen Körper hin, um den Hunger eines Tigerbabies zu stillen. Räjä Sibi gab aus seiner Brust ein Stück, das ebenso schwer war, wie das Fleisch der Taube, um den Hunger des Falken zu stillen. Welch edle Seele! Gott Räma lebte ein Leben der Liebe und zeigte Liebe in jedem Zoll seines Tuns. Meine lieben Kinder der Liebe, schöpft Inspiration aus ihrer Lehre. Beschreitet den Pfad der Liebe, verbindet euch mit Gott und gelangt zur ewigen Wohnstatt der Liebe. Das ist eure höchste Pflicht. Ihr habt die sen Körper angenommen, um die Liebe zu erreichen, die allein das Ziel des Lebens ist.
Lebe in der Liebe. Atme in der Liebe. Singe in der Liebe. Iss in der Liebe. Trinke in der Liebe. Bete in der Liebe. Meditiere in der Liebe. Denke in der Liebe. Bewege dich in der Liebe. Stirb in der Liebe. Reinige deine Gedanken, dein Reden und Tun im Feuer der Liebe. Bade und tauche ein im heiligen Ozean der Liebe. Nimm den Honig der Liebe zu dir und werde zu einer Verkörperung von Liebe.
Fühle, dass dieser Körper ein sich bewegender Tempel Gottes ist. Fühle, dass alle Wesen Abbilder Gottes sind. Fühle, dass diese Welt von Gott erfüllt ist. Fühle, dass die eine Kraft Gottes durch alle Hände arbeitet, durch alle Augen sieht und durch alle Ohren hört. Du wirst ein anderer Mensch werden. Du wirst höchsten Frieden und höchste Wonne erfahren.
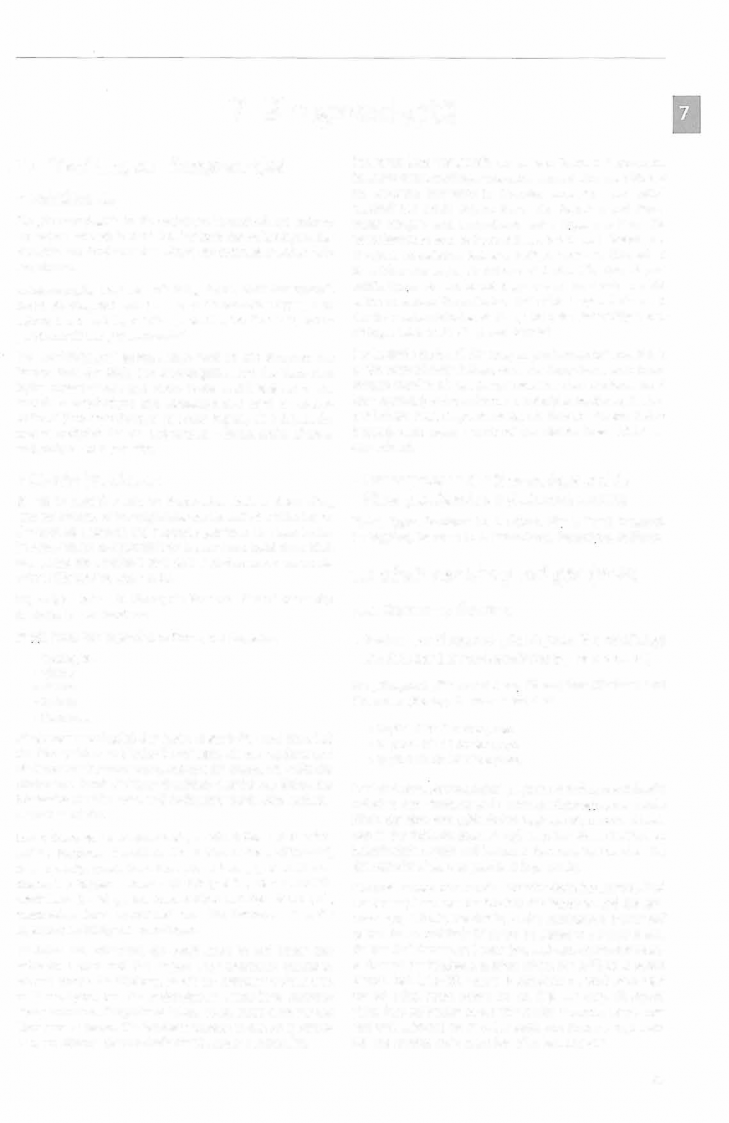
-
Bhagavad-gTtä
-
-
Einleitung zur Bhagavad-gitä
• Mahäbhärata
Die „Bhagavad-gTtä" ist die wichtigste Yogaschrift. Sie möchte uns zeigen, wie wir in der Welt, inmitten der Belastungen, der Konflikte und Probleme des Alltags ein spirituelles Leben füh ren können.
,,Bhagavad-gTtä" bedeutet wörtlich,,,die von Gott Gesungene". Sie ist ein Gespräch zwischen der Gottinkarnation Kf$r)a, dem Lehrer, und dem Krieger Arjuna, dem Schüler. Sie ist ein wichti ger Abschnitt des „Mahäbhärata".
Das „Mahäbhärata" ist mit seinen rund 75 000 Strophen das
längste Epos der Welt. Der ursprüngliche Kern des Texts wird Vyäsa zugeschrieben und reicht in das 1. Jahrtausend v. Chr.
zurück. In Geschichten und Lehrgesprächen wird im „Mahä bhärata" (laut einer Strophe im ersten Kapitel) alles abgedeckt, was es bezüglich der vier Lebensziele - köma, artha, dharma und mok?a - zu sagen gibt.
• Die (Vor-)Geschichte
Es gab in vedischer Zeit im Nordwesten Indiens einen König namens Bharata. Er war Begründer der Dynastie der Bhäratas, zu der auch die Kauravas und Pär:,<;lavas gehörten. Das Land Indien ist nach seinem Königsgeschlecht benannt und heißt daher Bhä rata, ,,Land der Bhäratas". Zwei seiner Nachkommen waren die Brüder Dhrtarä$tra und Pär:,<;lu.
Dhrtarä?tra hatte 101 Kinder, die Kauravas, deren ältestes der boshafte Duryodhana war.
Pändu hatte fünf tugendhafte Söhne, die Pär:,<;lavas:
► Yudhi$thira
► Bhima
► Arjuna
► Nakula
-
Sahadeva
Pär:,<;lu war ursprünglich der König. Er starb früh und hinterließ das Königreich dem blinden Dhrtarä?tra. Als die Pär:,<;lavas und die Kauravas alt genug waren, gab er jeder Gruppe die Hälfte des Königreichs. Durch die Tugendhaftigkeit Yudhi$thiras blühte das Königreich der Pär:,<;lavas, und Yudhi$thira wurde zum höchsten Herrscher erklärt.
Duryodhana war sehr eifersüchtig auf die Größe und Herrlich keit der Pär:,<;lavas. Er verführte Yudhi$thira zu einem Würfelspiel, dessen einzige große Schwäche. Durch Betrug gewann Duryo dhana. Die Pär:,<;lavas mussten ihr Königreich verlassen und für zwölf Jahre ins Exil gehen. Anschließend mussten sie noch ein. zusätzliches Jahr unentdeckt von den Kauravas inkognito irgendwo im Königreich verbringen.
Nachdem sie erfolgreich die zwölf Jahre im Exil hinter sich gebracht hatten und das weitere Jahr unerkannt geblieben wa-ren, gingen die Pär:,<;lavas, so wie es vereinbart worden war, zu Duryodhana, um den rechtmäßigen Besitz ihres Königrei ches anzutreten. Duryodhana lehnte es ab, ihnen auch nur das Geringste zu geben. Die Pär:i<;lavas wurden in den Krieg getrie ben, um dharma (Rechtschaffenheit) wieder herzustellen.
Das ganze Land war geteilt, um an dem Kampf teilzunehmen. Da Duryodhana mächtiger war, schlossen sich ihm mehr Könige an. SrT-kr$r:ia herrschte in Dväraka, einer von Ihm selbst geschaffenen Stadt. Arjuna (einer der Pär:,<;lavas und deren erster Krieger) und Duryodhana baten Kr$r:ia um Hilfe. Als Gottinkarnation konnte Kr$r:ia nicht parteiisch sein. Deshalb bot Er Arjuna an, zwischen Seiner mächtigen Armee und Ihm selbst zu wählen und sagte, Er würde selbst nicht kämpfen. Arjuna wählte Kr$na. Um immer mit Kr$r:ia zusammen zu sein, machte er Ihn zu seinem Wagenlenker. Nach einer langen Schlacht, in der die meisten Soldaten starben, und vielen Ratschlägen von SrT-kf$r)a blieben die Pär:,<;lavas siegreich.
Der Legende nach, soll der Krieg im „Mahäbhärata" etwa 3 000
v. Chr. stattgefunden haben. Aber der Kampf kann auch inter pretiert werden als ein Kampf zwischen dem niederen Geist (den Kauravas) und dem höheren Geist (den Pär:,<;lavas), in dem der höhere Geist siegreich bleibt, mit Hilfe der Gnade Gottes (Kr$r:ias), auch wenn manchmal der niedere Geist stärker zu sein scheint.
• Hauptpersonen der Bhagavad-gTtä und der Hintergrundgeschichte/Rahmenhandlung
Vyäsa, Kf$r:ia, Pandavas (u. a. Arjuna, Pänc;Ju, KuntT, DraupadT, Yudhi$thira), Kauravas (u. a. Duryodhana, Dhrtarästra, SaFijaya).
-
-
Inhalt der Bhagavad-gitä (BhG)
-
Zusammenfassung
-
Beginn der Bhagavad-gTtä: Arjunas Verzweiflung; die Schüler-Lehrer-Beziehung (vgl. BhG 1.1-2.10)
Die „Bhagavad-gTtä" besteht aus 18 adhyäyas (Kapiteln) und 701 s/okas (Versen). Schwerpunkte sind:
-
Kapitel 1 bis 6 karma-yoga.
-
Kapitel 7 bis 12 bhakti-yoga.
-
Kapitel 13 bis 18 Jnana-yoga.
Der Inhalt der „Bhagavad-gTtä" beginnt am Anfang der Schlacht zwischen den Pär:,<;lavas und Kauravas. Dhrtarästra, der blinde König, der nicht zum Schlachtfeld gegangen ist, möchte wissen, was in der Schlacht passiert (vgl. 1.1). Der Weise SaFijaya ist hellseherisch begabt und berichtet dem König am zehnten Tag des Kampfes alles, was geschieht (vgl. 1.2-18).
Die zwei Armeen bereiten sich zur Schlacht in Kuruk$etra (,,Feld der Kurus"; Kuru war der Vorfahr der Pär:,c;Javas und der Kau ravas) (vgl. 1.3-11). Beschreibung der mächtigsten Krieger auf beiden Seiten und ihrer Erfahrung im Kampf. Die Krieger blasen die Muschelhörner zum Beginn (vgl. 1.12-19). Arjuna, der obers te General der Pär:,<;lavas, möchte sehen, wer auf beiden Seiten kämpft (vgl. 1.20-23). Arjuna beobachtet die Vorbereitungen zur Schlacht). Kr$r:ia bringt ihn hin (vgl. 1.24-25). Als Arjuna sieht, dass auf beiden Seiten Verwandte, Freunde, Lehrer usw. sind (vgl. 1.26-27), ist er voller Sorge und Kummer (vgl. 1.28-
34) und möchte nicht mehr kämpfen (vgl. 1.35-47).
87
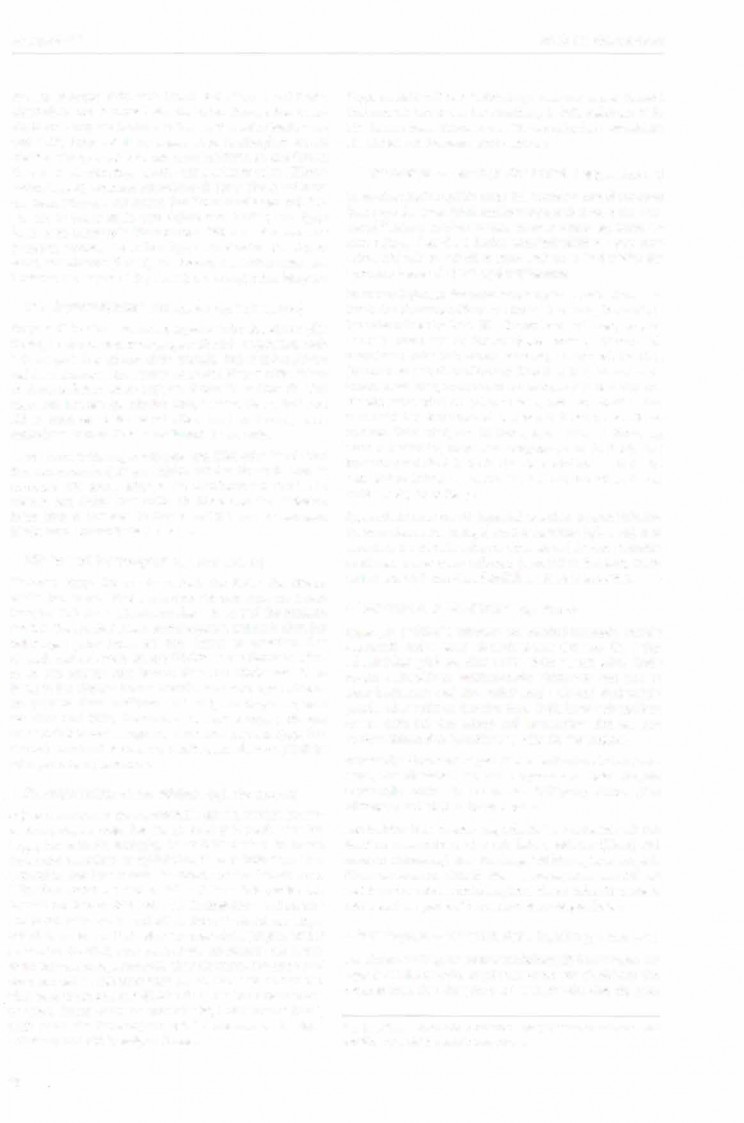
Bhagavad-g1tä
Er sagt, er strebe nicht nach Macht, Reichtümern und Besitz. überwältigt von Kummer beim Gedanken daran, seine Freun de, Verwandten und Lehrer zu töten, wirft er seine Waffen weg (vgl. 1.47). Kr$r:ia tadelt ihn wegen seiner Mutlosigkeit, die auf die Verhaftung an seine Familie zurückzuführen ist, und fordert ihn auf zu kämpfen (vgl. 2.1-3). Arjuna erkennt seine Hilflosig keit (vgl. 2.4-6), überlässt sich vollständig Kr$r:ia (Gott) und bittet um Seine Führung, um diesen Konflikt zu bewältigen (vgl. 2.7- 8). Erst an dieser Stelle wird Arjuna zum Schüler, und Kr$r:ia kann Seine Lehrerrolle übernehmen. Während Kauravas und Pär:ic;iavas warten, erklärt ihm Kr$r:ia alle Gesetze des Univer sums, von dharma (Pflicht) und karma. Schließlich fallen alle Illusionen von Arjuna ab (vgl. 18.73) und er beginnt zu kämpfen.
-
-
-
Die Unsterblichkeit der Seele (vgl. BhG 2.10-30)
Kr$r:ia erklärt Arjuna die unvergängliche Natur des ätman (der Seele), für den es weder Vergangenheit noch Gegenwart, noch Zukunft gibt. Der ätman stirbt niemals. Daher möge Arjuna nicht bekümmert sein. Immer wenn der Körper stirbt, inkar niert das Selbst in einem anderen Körper. Da es über die fünf Elemente hinausgeht, nämlich Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther, kann es weder zerschnitten noch verbrannt, noch getrocknet werden. Es ist unveränderlich und ewig.
Jeder macht Erfahrungen wie Hitze und Kälte oder Freude und Schmerz dadurch, dass die Objekte mit den Sinnen in Kontakt kommen. Die Sinne bringen die Empfindungen durch die Nerven zum Geist. Man sollte die Sinne von den Objekten lösen können. Nur wer in Freude und Schmerz ausgewogen bleibt, kann Unsterblichkeit erlangen.
-
Pflicht und karma-yoga (vgl. BhG 2.31-53)
Nachdem Kr$r:ia Arjuna die unsterbliche Natur des ätman erklärt hat, wendet Er sich nun dem Handeln ohne die Erwar tung von Früchten zu. Intellektuelles Wissen und das Studium der Schriften (vedas) alleine ist nicht genug, und auch nicht das Vollbringen guter Taten, um den Himmel zu erreichen. Der Mensch darf sich nicht um die Früchte seines Handelns küm mern, wie Gewinn oder Verlust, Sieg oder Niederlage. Diese liegen in den Händen Gottes. Er sollte alle Handlungen mit aus gewogenem Geist ausführen und ruhig die Gegensatzpaare wie Hitze und Kälte, Freude und Schmerz ertragen, die sich unvermeidlicherweise ergeben, wenn man handelt. Kr$r:ia for dert Arjuna auf zu handeln, frei vom Wunsch, das Königreich zu erlangen oder zu bewahren.
-
Charakteristika eines Weisen (vgl. BhG 2.54-72)
Arjuna brennt darauf, die Charakteristika eines Menschen kennen zulernen, dessen Geist fest ist. Ein solcher Mensch, sagt ihm Kr$r:ia, hat keinerlei Wünsche. Da er Zufriedenheit im Innern findet und das Selbst verwirklicht hat, ist er vollständig frei von Wünschen. Das Bewusstsein des ätman und das Aufgeben von Wünschen treten zur selben Zeit auf. Der sthita-prajfia (ein Mensch mit festem Geist) wird von Widrigkeiten nicht berührt und kennt keine Furcht und keinen Zorn. Er nimmt die Dinge, wie sie kommen und hat keine Zu- oder Abneigungen. Weder umarmt er die Welt, noch hasst er sie. Ein Mensch mit festem Geist hat vollständige Kontrolle über die Sinne. Die Sinne sind stark und ziehen den Geist nach außen. Daher richte man den Blick nach innen und verwirkliche Gott, der im Herzen wohnt. Der yogT, dessen Geist fest geworden ist, bleibt unerschüttert, auch wenn alle Sinnesobjekte auf ihn zukommen. Er bleibt unbewegt und lebt in ewigem Frieden.
88
Inhalt der Bhagavad-gitä
Kr$r:ia schließt mit der Feststellung, dass der ewige Zustand brahmas für immer aus der Täuschung befreit. Selbst am Ende des Lebens beim Verlassen des Körpers geht das Bewusstsein der Einheit mit brahman nicht verloren.
-
Karma-yoga - der yoga der Handlung (vgl. BhG 3-5) Im zweiten Kapitel spricht Kr$r:ia über särikhya bzw.jfiäna-yoga
(den yoga der Erkenntnis) und karma-yoga (den yoga des Han delns).* Arjuna möchte wissen, welcher besser ist. Kr$r:ia er klärt Arjuna, dass diese beiden unterschiedlichen Wege zum selben Ziel führen. Für die meisten Menschen ist der Weg des Handelns besser als der Weg der Erkenntnis.
Es ist unmöglich, vollkommen handlungslos zu sein. Schon der Erhalt des physischen Körpers erfordert Handlung. Das tatsäch liche Handeln ist im Geist. Wir können karma schaffen, ohne zu handeln (wenn wir an Sinnesobjekte denken, während wir meditieren) oder kein karma schaffen, obwohl wir handeln (Handeln als selbstloses Dienen). Eine Handlung ist dann voll kommen selbstlos, wenn sie als sva-dharma (Pflicht und Schul digkeit) getan wird, so gut man kann, mit dem Gefühl, dass man nicht der Handelnde ist, sondern Gott durch den Körper und den Geist wirkt, des Weiteren, wenn man der Handlung nicht verhaftet ist, wenn man ausgewogen ist in Erfolg und Misserfolg und die Früchte des Handelns als Opfer an Gott hin gibt. Wahre Entsagung ist der Verzicht auf den Wunsch und nicht auf physische Dinge.
Kr$r:ia erklärt auch den Unterschied zwischen avatära (Inkarna tion ohne karmische Zwänge) und Reinkarnation (vgl. 4.1-9). Gott inkarniert, um den Menschen zu erheben und ihn zum Höchsten zu führen. Immer wenn adharma (Unrecht) vorherrscht, mani festiert sich Gott, um diese feindlichen Kräfte zu zerstören.
-
Der yoga der Meditation (vgl. BhG 6)
Kr$r:ia gibt praktische Hinweise zur Meditationspraxis. Der/die Aspirant/in suche einen abgeschiedenen Ort, wo die Wahr scheinlichkeit groß ist, dass er/sie nicht gestört wird. Er/sie bereite seinen/ihren Meditationssitz richtig vor und sitze in einer bequemen Stellung, wobei Kopf, Hals und Wirbelsäule gerade, aber nicht angespannt sind. Er/sie hefte seinen/ihren reinen Geist auf den ätman und konzentriere sich auf den Punkt zwischen den Augenbrauen oder die Nasenspitze.
Notwendige Voraussetzungen für den Aspiranten sind brahma carya, Furchtlosigkeit und ein ausgewogener Geist. Der/die Aspirant/in sollte ein Leben der Mäßigung führen (den Mittelweg) und nicht in Extreme fallen.
Den Geist zu beherrschen mag schwieriger erscheinen als den Wind zu beherrschen. Aber mit festem abhyäsa (Üben) und vairägya (Entsagung) über eine lange Zeit hinweg ist es möglich. Wenn ein Mensch nicht in dieser Lebensspanne sein Ziel er reicht, wird er seine Entwicklung im nächsten Leben fortsetzen. Kein Bemühen geht auf dem spirituellen Weg verloren.
-
Bhakti-yoga - der yoga der Hingabe (vgl. BhG 7-12) Der einfachste Weg zur Gottverwirklichung ist bhakti-yoga, der
yoga der Liebe zu Gott. Es gibt vier Arten von Gläubigen: den Verzweifelten, den, der göttliche Weisheit sucht, den, der nach
-
In der „Bhagavad-gTtä" steht das Wort sarikhya meist fürjiiana-yaga und das Wort yaga steht meist für korma-yoga.
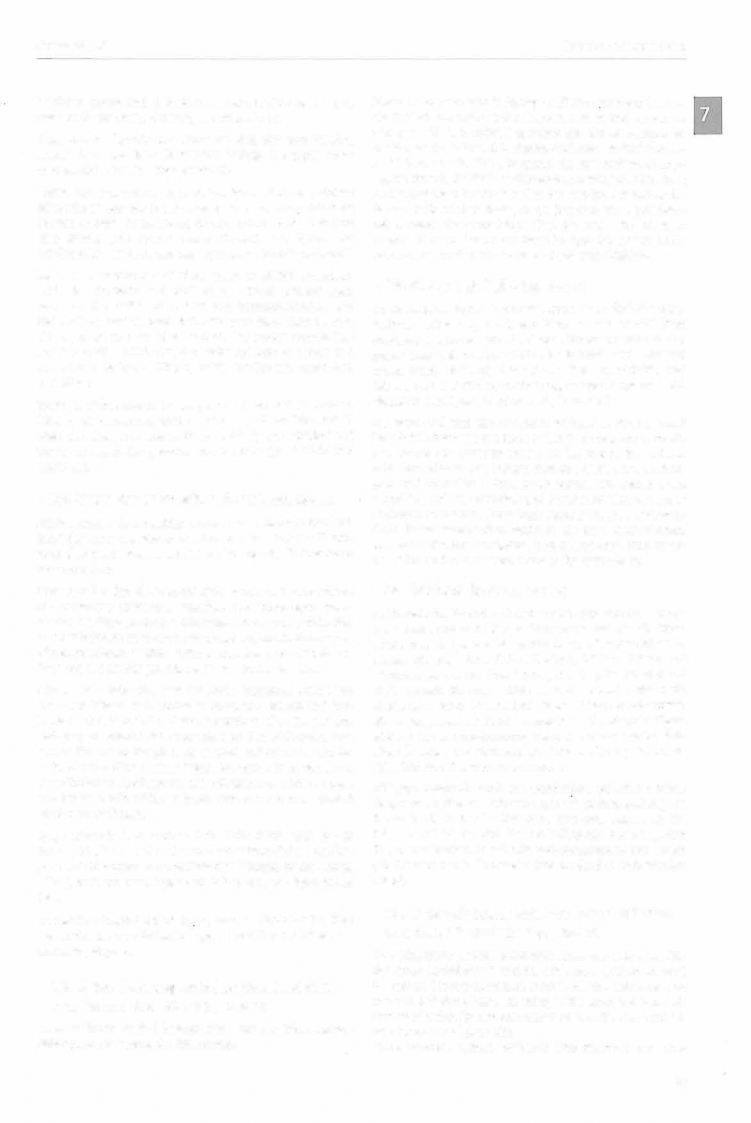
Bhagavad-gitä
Reichtum strebt und den Weisen. Jede Motivation ist gut, wenn auch der Weise der Fortgeschrittenste ist.
Jeder verehrt irgendetwas. Aber nur der, der Gott verehrt, erlangt das Unendliche. Es ist nicht wichtig, in welcher Form Gott verehrt wird. Das Herz ist wichtig.
Hilfen zur Entwicklung von Frömmigkeit sind das stetige Wiederholen von Orfl (oder eines anderen mantra), ständiges Denken an Gott, Gottesdienst, Rituale, kleine Opfergaben (wie eine Blume, eine Frucht, etwas Wasser), das Opfern der Früchte allen Handelns und aller spirituellen Praktiken an Gott.
Jeder kann verwandelt werden, wenn er bhakti entwickelt. Auch der sündigste und teuflischste Mensch erreicht Gott, wenn er sich radikal dem Pfad von Rechtschaffenheit und Wahrheit zuwendet. Jeder Ruf, dem man folgt, kann zu Gott führen, wenn man ernsthaft und mit liebevoller Frömmigkeit sucht. Das Wesentliche ist, den Geist auf Gott zu heften und Ihm alles zu weihen - Körper, Geist, Handlungen, Emotionen und Willen.
Wenn es nicht möglich ist, die ganze Zeit an Gott zu denken, können wir versuchen, Gott in Seinen speziellen Manifestati onen zu sehen. Aus diesem Grund zählt Km1a detailliert auf, wo Er am leichtesten gesehen werden kann (vgl. 9.16-19 und 10.19-42).
-
Die Vision der kosmischen Gestalt (vgl. BhG 11)
Arjunas Zweifel sind beseitigt worden durch die klare Beschrei bung der Natur des ätman und des Ursprungs und der Zerstö rung alles Geschaffenen. Nun ist er dazu bereit, die kosmische Form zu sehen.
Kr?r:ia gewährt ihm die göttliche Sicht, wodurch Arjuna Gott als die großartige kosmische Manifestation (visva-rüpä) wahr nimmt. Die Sicht ist so-wohl allumfassend als auch gleichzeitig. In jeder Richtung sieht Arjuna Gott als das gesamte Universum. Alle geschaffenen Welten, Götter, Menschen, Geschöpfe und Dinge stehen als der gigantische Körper Gottes vor ihm.
Arjuna sieht weiterhin, dass das große kosmische Drama von der allmächtigen Kraft Gottes in Bewegung gesetzt und kon trolliert wird. Sein Wille alleine herrscht in allen Dingen und Handlungen, sowohl den guten als auch den schlechten. Gott fordert ihn auf zu kämpfen, da er doch nur scheinbar die Ur sache der Zerstörung seiner Feinde ist. Arjuna kann den Druck der plötzlichen Ausdehnung des Bewusstseins nicht ertragen und ist von Furcht erfüllt. Er bittet Gott, Seine normale Gestalt wieder anzunehmen.
Kr?r:ia wiederholt, dass diese Sicht nicht durch noch so viel Askese, Studium, Opfer oder menschenfreundliche Handlun gen erreicht werden kann. Vollständige Hingabe ist das einzige Mittel, wodurch man Zugang zu Seiner großen Vision haben kann.
Im zwölften Kapitel erklärt Krsr:ia, dass es einfacher ist, über eine konkrete Form Gottes, sagu(la, zu meditieren als über eine abstrakte, nirgu(la.
-
Die Unterscheidung zwischen dem Feld und dem Kenner des Feldes (vgl. BhG 13)
Im dreizehnten Kapitel beginnt Kr?r:ia mit der Erklärung von
jnäna-yoga (dem yoga der Erkenntnis).
Inhalt der Bhagavad-gitä
Dieses Universum kann in k?etra (Feld) und ksetra-Jna (Kenner des Feldes) unterteilt werden. Körper, Materie und Universum sind das Feld, d. h. mäyä. Das Selbst bzw. das Bewusstsein ist der Kenner des Feldes, d. h. ätman, brahman. Die fünf Elemen te, Ichbewusstsein, Geist, Verstand, die fünf Wahrnehmungs organe (Sinne), die fünf Handlungsorgane, Wunsch, Abneigung und alle geistigen Zustände stellen das Feld dar. Der Kenner des Feldes ist die höchste Seele, deren Erkennen uns Unsterblich keit schenkt. Sie durchdringt alles. Sie strahlt im Innersten unseres Herzens. Wenn wir diese höchste Gegenwart wahr nehmen, die in allen Wesen ist, sind wir ewig glücklich.
-
Die drei guoas: Teil A (vgl. BhG 14)
Im vierzehnten Kapitel beschreibt Kr?r:ia die prakrti (das mani festierte Universum), das k?etra (Feld), als aus Brahmä {dem Schöpfer) kommend. Alles in diesem Universum kann in drei gu(las unterteilt werden: Sattva ist Reinheit und Licht und bringt Glück, Weisheit, Erleuchtung. Rajas ist Aktivität, und Leidenschaft und führt zu Verhaftung, Habgier, Sorge und Leid. Tamas ist Untätigkeit, Unwissenheit, Dunkelheit.
In prakrti sind stets alle drei gu(las vorhanden, einer herrscht jedoch üblicherweise vor. Kr?r:ia verlangt von uns, uns zu bemü hen, tamas aus unserem Wesen zu beseitigen. Wir müssen rajas kontrollieren und beherrschen und weise seine Kraft für gute und freundliche Handlungen verwenden. Sattva sollte sorgfältig gepflegt, entwickelt und bewahrt werden, um uns in die Lage zu versetzen, Unsterblichkeit zu erlangen. Der verwirk lichte Weise transzendiert natürlich alle diese Eigenschaften; zwar hat sattva ihm ermöglicht, Gott zu erreichen, diese Eigen schaft bindet ihn aber auch, wenn er ihr verhaftet ist.
-
Der höchste Geist (vgl. BhG 1s)
Im fünfzehnten Kapitel berichtet uns Sri-kr?r:ia von der eigentli chen Quelle dieses sichtbaren Universums, aus der alle Dinge entstanden sind, so wie ein großer Baum mit seinen Wurzeln, seinem Stamm, seinen Ästen, Zweigen, Blättern, Blüten und Früchten, der aus der Erde kommt, von ihr getragen wird und in ihr wurzelt. Sri-kr?r:ia erklärt, dass das höchste Wesen die Quelle allen Seins ist und sieht dieses Universum allegorisch einem umgekehrten Baum vergleichbar. Die Wurzeln dieses Baumes sind in para-prahman, seine sich verzweigenden Äste sind alle Dinge und Faktoren, die diese Schöpfung der unter schiedlichsten Phänomene ausmachen.
Sri-kr?r:ia beschreibt auch das wunderbare Geheimnis Seiner Gegenwart in diesem Universum und die höchste Stellung, die Er einnimmt, da Er alles hier trägt. Gott sagt, dass es ein Teil Seiner Selbst ist, das sich hier als individuelle Seele in jedem Körper manifestiert. Er selbst ist auch puru$ottama bzw. ätman (die innewohnende Überseele) jenseits des }Tva (individuellen Selbst).
-
Die Unterscheidung zwischen dem Göttlichen und dem Dämonischen (vgl. BhG 16)
Im sechzehnten Kapitel beschreibt Kr?r:ia die Charakteristika der guten (,,göttlichen") und der schlechten {,, dämonischen") Menschen. Die reinen, göttlichen Eigenschaften führen zu Frie den und Befreiung. Reinheit, richtiges Verhalten und Wahrheit sind unerlässlich für den spirituellen Fortschritt, aber auch für ein ehrenwertes Leben hier.
Ohne Reinheit, rechtes Verhalten und Wahrheit und ohne
89
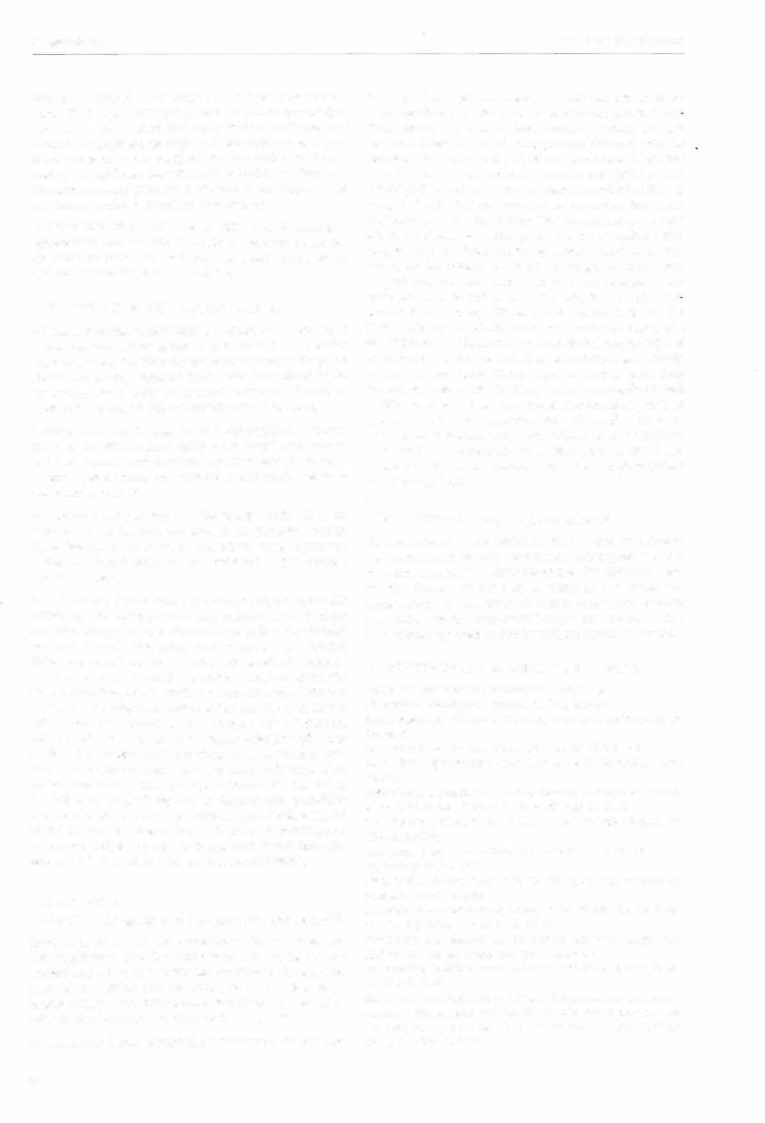
Bhagavad-gTtä
Glauben an Gott oder eine höhere Realität jenseits dieser sicht baren Welt degeneriert der Mensch zu einem zweibeinigen Tier von hässlichem Charakter und hässlichen Handlungen und versinkt in Dunkelheit. Ein solcher Mensch wird sich selbst zum Feind und zerstört das Glück anderer wie auch sein eigenes. Gefangen in zahllosen Wünschen und Sehnsüchten, Sklave von Sinnesfreuden und gefangen in Tausenden von Sorgen endet sein Leben letztlich in Elend und Erniedrigung.
In dieser Welt führen drei Tore zur Hölle (zum Untergang) - Leidenschaft, Zorn und Gier. Wenn der Mensch von diesen drei Eigenschaften frei ist, kann es ihm gelingen, Rettung zu erlangen und das höchste Ziel, Gott, zu erreichen.
-
Die drei gur:ias: Teil B (vgl. BhG 17-18.40)
Für den spirituellen Fortschritt ist es wichtig, unser Leben in all seinen Aspekten immer sattwiger zu machen. Deshalb erklärt Kr$r:ia alles in den Begriffen der drei gu(las: Sattwiger Glaube ist der Glaube an Gott, rajasiger Glaube und Gottesdienst ist die Erwartung, etwas dafür zu erhalten, tamasiger Glaube ist getäuscht und befasst sich mit erdgebundenen Geistern.
Sattwige Nahrung ist gesund und schmackhaft. Rajasige Nahrung ist bitter, sauer, salzig oder scharf und erzeugt Schmerz, Kummer und Krankheit. Tamasige Nahrung ist abge standen, geschmacklos oder verdorben und macht uns ener gielos und deprimiert.
Das sattwige Opfer ist selbstlos, das rajasige Opfer will etwas erhalten oder Aufmerksamkeit erregen, das tamasige Opfer ist Lippenbekenntnis oder falsch ausgeführt. Kr$r:ia beschreibt weiter die Charakteristika der drei Arten von Askese, Sprache und Geschenken.
Im achtzehnten Kapitel erklärt Kr$r:ia zuerst die drei Arten der Entsagung: Die sattwige Entsagung vollzieht eine Handlung ohne Verhaftung und ohne etwas dafür zu wollen, man handelt nur, weil die Handlung getan werden muss. - Die rajasige Entsagung erfolgt aus Furcht, oder um egoistisch etwas zu erhalten. Tamasige Entsagung erfolgt aus Trägheit. Kr$r:ia gibt viele weitere Beispiele. Schließlich beschreibt er die drei Arten der Freude: Sattwige Freude ist zuerst schwierig, endet aber in Glück, wie das Aufstehen am Morgen zur Meditation, Selbstdisziplin usw. All das ist zu Beginn schwierig, gibt aber schließlich ungeheure Kraft und Glück. Rajasige Freuden kom men aus den Sinnesorganen und sind zuerst sehr angenehm, enden aber stets in Schmerz. - Die Freude, die aus Schlaf, Faulheit oder Trägheit stammt, ist tamasig und tatsächlich sowohl zu Beginn wie auch zum Schluss schmerzvoll. Niemand ist frei von den drei gu(las. Wenn wir uns auch bemühen, so sattwig wie möglich zu sein, ist in uns doch immer rajas und tamas. Schließlich müssen wir alle drei transzendieren.
-
Karma-yoga -
Pflicht, Entsagung und Hingabe (vgl. BhG 18.41-67)
Kr$r:ia sagte zu Beginn des achtzehnten Kapitels, dass man Opferhandlungen (rituellen Gottesdienst), Gaben (selbstloses Dienen) und Askese (alle spirituellen Praktiken) nicht aufgeben sollte, da sie läuternd sind (vgl. 18.5). ,,Doch auch diese Hand lungen müssen unter Aufgabe von Verhaftung und des Wun sches nach Belohnung ausgeführt werden [...]." IBhG 18.6)
Die Menschen haben verschiedene Charaktere, die von den
90
Inhalt der Bhagavad-gTtä
drei gu(las hervorgebracht werden. Je nach dem vorherrschen den gu(la können die Menschen in vier Gruppen unterteilt wer den, woraus das indische Kastensystem entstand. Je nach unserem Wesen haben wir verschiedene Pflichten. Was für den einen Menschen richtig ist, ist für den anderen falsch. Wir müssen versuchen, unseren sva-dharma (Pflicht und Schuldigkeit) zu erkennen, wie es unserem sva-bhava (Wesen) entspricht, und nicht nur nachahmen, was andere tun. Unser sva-bhäva wird uns dazu treiben. Wir müssen handeln, so gut wir es vermögen. Aber solange wir uns in der Dualität befin den, werden alle Unternehmungen etwas Schlechtes an sich haben, wie jedes Feuer Rauch mit sich bringt. Da wir dies wis sen, widmen wir alle Handlungen Gott und überlassen uns selbst ganz Ihm. Da Gott in den Herzen aller Wesen wohnt, ver wendet Er auch unsere Wünsche und unseren Geist, um das Notwendige zu tun. Mit diesem Wissen gibt der/die Aspirant/in alle Pflichten auf (denkt nicht mehr an Richtig und Falsch) und sucht Zuflucht alleine bei Gott. Kr?r:ia verspricht, dass, wenn wir so handeln, wir keine Sünde begehen können (schlechtes karma), auch wenn die Handlung als solche schlecht ist (vgl. 17.66). Um zu vermeiden, dass dies als Entschuldigung für alles genommen wird, sagt Kr?i:ia, dass diese Philosophie nur Men schen gelehrt werden möge, die Askese üben (versuchen, ihren Geist zu kontrollieren), fromm sind (Liebe zu Gott besit zen), die versuchen, den Menschen zu helfen und die Wahrheit zu finden (vgl. 18.67).
-
Das Lehren des yoga (vgl. BhG 18.68-69)
Zusammenfassung: Das spirituelle Wissen, das wir erhalten haben, sollen wir nicht für uns behalten. Wir müssen es ande ren mitteilen, sobald sie dafür bereit sind. Die Weitergabe spi rituellen Wissens ist der höchste Dienst an den Menschen. Kr$r:ia versichert, dass, wenn wir andere yoga lehren, es auch uns helfen wird, Gottverwirklichung zu erreichen. Das Unterrichten von yoga an sich ist sädhana (spirituelle Praxis).
-
-
-
-
Querverweise zu bestimmten T hemen
-
-
Allgemeine Einleitung und Geschichte: 1.1-47; 2.1-10 Philosophie - särikhya und vedänta: 2.11-30; 3.27-30
Karma-yoga: 2.31-53; 3.9-16, 19, 20-26; 4.16-24, 41; 18.13-17, 18, 19,
23-28, 59
Entsagung: 3.1-8, 17, 18; 4.16; 5.1-12; 6.3; 9.28; 15.20; 17.1-17
Meditation, Selbstdisziplin: 3.1-8; 5.27, 28; 6.10-36; 8.10-14; 9.22;
13.24; 15.20
Pflicht, Opfer, Kultur, Kaste, ... : 2.31-53; 3.9-16; 4.24-33; 5.29; 7.20-23;
9.15-16, 20, 23-25; 15.20; 17.11-13, 23-28; 18.3-9, 40, 48
Prakrti, puru�o, mäya: 7.4-14, 24-27, 30; 8.3-4; 9.4-10; 13.13-23, 29;
15.7-9; 18.60-61
Tod, karma, sar[lskäras: 2.27; 4.1-14; 6.37-45; 7.19; 8.5-6, 10, 13, 15-
19, 23-26; 9.20, 21; 18.12
Herrlichkeiten Gottes: 7.6-11; 9.16-19; 10.7, 12-42; 11.1-55; 15.12-15
Kosmische Vision: 11.1-55
Bhakti-yoga: 7.16-18; 9.13-14, 26-27, 29, 31, 33-34; 10.9-10; 11.54-
55; 12.1-12; 13.25; 15.4; 18.54-58, 62-70
Erleuchtung und Weisheit: 4.33-39; 5.13-29; 6.3; 7.1-3, 28-29; 9.1-2;
10.9-10, 13.7-11, 34, 27-30; 15.5, 19-20; 18.49-66
Puru�ottama, höchstes Wesen: 4.5-12; 8.3, 20-22; 10.2-3; 13.12, 27,
31; 15.1-6, 16-20
Gu,:,as und deren Anwendung: 3.27-29; 14.1-20; 17.1-22; 18.20-24 Asurische (dämonische) und göttliche Charakteristika: 2.54-72; 3.36- 43; 4.40; 5.7-13, 23; 7.15; 9.3, 11-12, 30, 32; 12.13-20; 14.21-27;
15.11; 16.1-24; 18.50-57
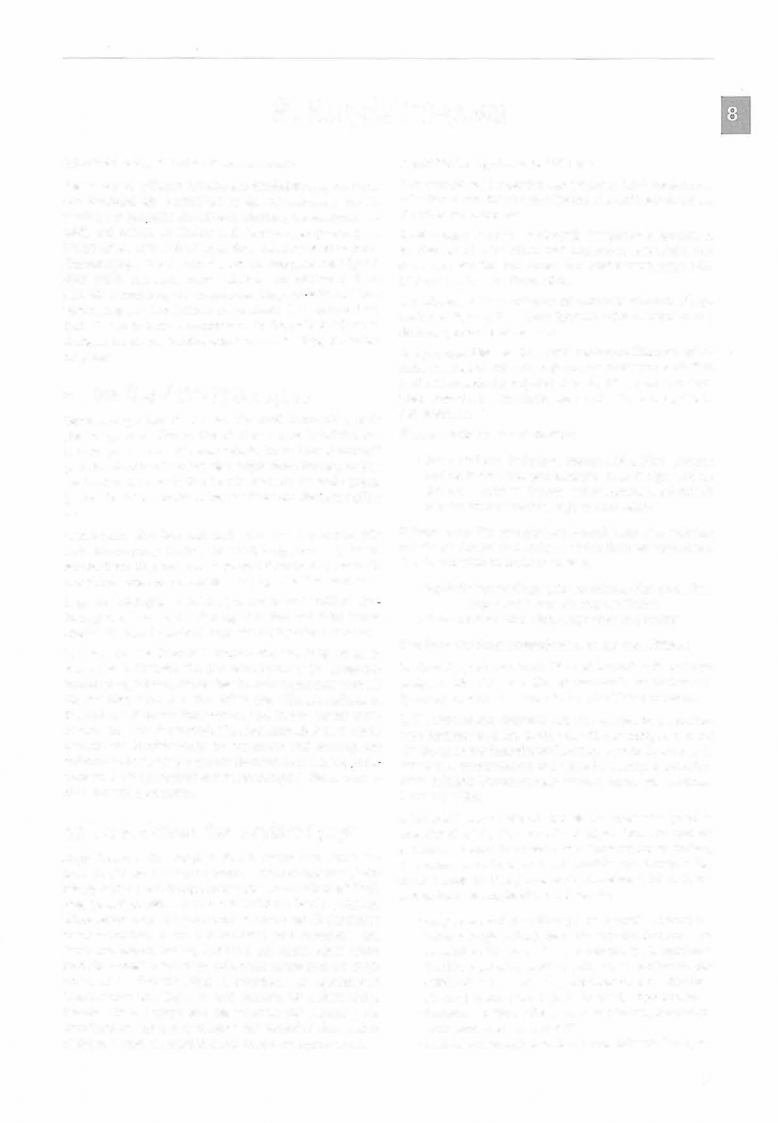
-
-
KuQQalinT-yoga
(vgl. Sukadev Bretz, ,,Die Kundalini-Energie erwecken")
Dieses Kapitel erläutert Aspekte des ku,:,r;JalinT-yoga, die Natur von ku,:,r;JalinT, die Beschaffenheit des Astralkörpers, das Er wecken der ku,:,dalinT, die cakra-Meditation, die Reinigung der när;/Ts und cakras. Du findest auch Abbildungen (yantras) der Haupt-cakras sowie Erklärungen ihrer verschiedenen Aspekte. Ku,:,r;JalinT-yoga ist der yoga, der von der ku,:,r;JalinT-sakti (göttli chen Kraft), den sechs cakras (Zentren der spirituellen Ener gie), der Entwicklung der schlafenden ku,:,r;JalinT sakti und ihrer Vereinigung mit siva (reinem Bewusstsein) im sahasrära han delt. Die sechs Zentren werden von der ku,:,r;JalinT-sakti durch drungen, bis sie am Scheitel angekommen ist. Ku,:,r;Jala bedeu tet „Ring".
-
-
Die Siva-Sakti-Philosophie
Ku,:,r;JalinT-yoga beruht auf der Siva-Sakti-Philosophie, auch
„tantra" genannt. Siva repräsentiert das Unveränderliche, das Unbewegte, das absolute Bewusstsein, im vedänta „brahman" genannt. Sakti repräsentiert die schöpferische Energie, welche das Universum in sechs Schritten in Analogie der sechs cakras (unterhalb des sahasrära-cakra, des Sitzes von siva) geschaffen hat.
Ursprünglich sind Siva und Sakti eins. Durch spandana (die erste Schwingung; Beginn des Schöpfungsprozesses) trennt sich Sakti von Siva, was zuerst die zwei Kausalwelten, dann die drei Astralwelten und schließlich die physische Welt erzeugt.
In großen Weltzyklen vereinen (kosmische und stoffliche Auf lösung) und trennen (Schöpfung) sich siva und fokti immer wieder. Die kosmische Auflösung wird auch pralaya genannt.
In jedem Teil des Kosmos herrschen siva und sakti. Im Men schen manifestiert sich siva (das reine Bewusstsein) als sac-cid änanda (Sein, Wissen, Glückseligkeit). Sakti manifestiert sich als die drei Körper mit den fünf Hüllen (vgl. YLH, 17. Auflage, S. 22). So lange sakti von siva getrennt sind, ist der Mensch unzu frieden. Im laufe der individuellen Evolution über viele Leben erwacht die ku,:,r;JalinT-fokti im Menschen und vereinigt die individuelle Seele wieder mit der kosmischen Seele. Ku,:,dalinT yoga ist die Wissenschaft der Beschleunigung dieses natürli chen Evolutionsprozesses.
-
Die Praktiken des kur:,c;falinT-yoga
Ku,:,r;JalinT-yoga wird hauptsächlich in tantrischen Texten ge lehrt. Es gibt zwei Zweige im tantra - väma-märga (der ,,links händige" Pfad) und dak$i,:,a-märga (der „rechtshändige" Pfad). Dak$i,:,a-märga hält sich an gesellschaftliche Gepflogenheiten, väma-märga setzt sich ganz bewusst ab von gesellschaftlichen Gepflogenheiten. Heute unterscheidet man manchmal drei Arten von tantra: weißes, rotes und schwarzes. Rotes tantra sind die sexuellen Praktiken, schwarzes tantra sind die magi schen und schwarzmagischen Praktiken zur egoistischen Manipulation von Energien und Geistern für selbstsüchtige Zwecke. Weißes tantra sind die Praktiken zur Reinigung des Astralkörpers und zur Erweckung der ku,:,r;JalinT ohne selbst süchtige Motive, sie werden daher ku,:,r;JalinT-yoga genannt.
Es gibt fünf Zweige im kul')r;/alinT-yoga:
-
mantra-yoga: Hier werden Klangenergien durch Rezitationen oder Singen zum Schwingen gebracht. Dies wirkt sich direkt auf die när;/Ts und cakras aus.
-
näda-yoga: Hier werden ebenfalls Klangenergien benutzt. Es werden jedoch keine Worte und Buchstaben wiederholt, son dern man arbeitet mit Noten und Musikinstrumenten oder hört auf den inneren Klang, näda.
-
yantra-yoga: Hier werden Energien durch Meditation auf geo metrische Figuren, Farben und Symbole aktiviert. Beispiele sind Abbildungen von yantras, cakras.
-
/aya-yoga: Hier werden durch bestimmte Übungen, grob stoffliche in feinstoffliche Energien umgewandelt und schließlich in siva (Bewusstsein) aufgelöst, /aya. Im Alltag kann man /aya yoga sowohl in der Meditation als auch bei diversen Yogaübun gen einsetzen.
Übungsbeispiel bei der Meditation:
-
Ärger wird von Gedanken, Worten und Bildern getrennt und als Energie bewusst gemacht. Diese Energie wird als Teil der göttlichen Energie wahrgenommen. Schließlich verschmilzt der Praktizierende mit sich selbst.
-
-
hatha-yoga: Hier wird der Körper durch bestimmte Praktiken auf die Meditation und andere geistige Übungen vorbereitet. Die Hauptpunkte im hatha-yoga sind:
-
kriyäs (Reinigungsübungen): entschlacken den physischen Körper und lassen die Energien fließen
-
äsanas: wirken körperlich, energetisch und geistig
Man kann drei Arten unterscheiden, äsanas auszuführen:
-
Die ruhige, entspannte Art. Diese ist besonders für Anfänger geeignet. Sie hilft, das Körperbewusstsein zu verbessern, Spannungen abzubauen und die Energien fließen zu lassen.
-
Die dynamische, kraftvolle Ar t. Hier werden fortgeschritte nere Variationen geübt, welche den Körper kräftigen und auf ein Erwecken der kul')r;/a/inTvorbereiten. Der/die Übende lernt, Grenzen zu transzendieren und nichts für unmöglich zu halten. Auch subtilste Verspannungen werden durch die maximale Dehnung gelöst.
-
Die medit ative Art. Hier werden die Stellungen lange (mindes tens fünf Minuten, bis zu zwei Stunden) gehalten. Dies wird mit präl')äyäma (besonderen Atem- und Konzentrationstechniken) verbunden, manchmal auch mit mudräs und bandhas. Da durch werden die Energien erweckt, die cakras aktiviert. Durch äsanas kann die kul')r;/alinT erweckt werden.
-
präQäyäma sind Atemübungen zur Kontrolle (äyäma) der Lebensenergie (präl')a). Man unterscheidet drei Arten von präQäyäma-Übungen: 1. vorbereitende (z. B. ur;Jr;JTyäna bandha, agni-sära, nauli und Gorilla), 2. reinigende (ka pälabhäti = Schnellatmung; anuloma viloma = Wechsel atmung), 3. erweckende (z. B. bhastrikä, siJrya-bheda).
-
bandhas sind Verschlüsse, um zu verhindern, dass präl')a
nach unten oder oben austritt.
-
mudräs sind energieerweckende und -leitende Übungen.
-
91
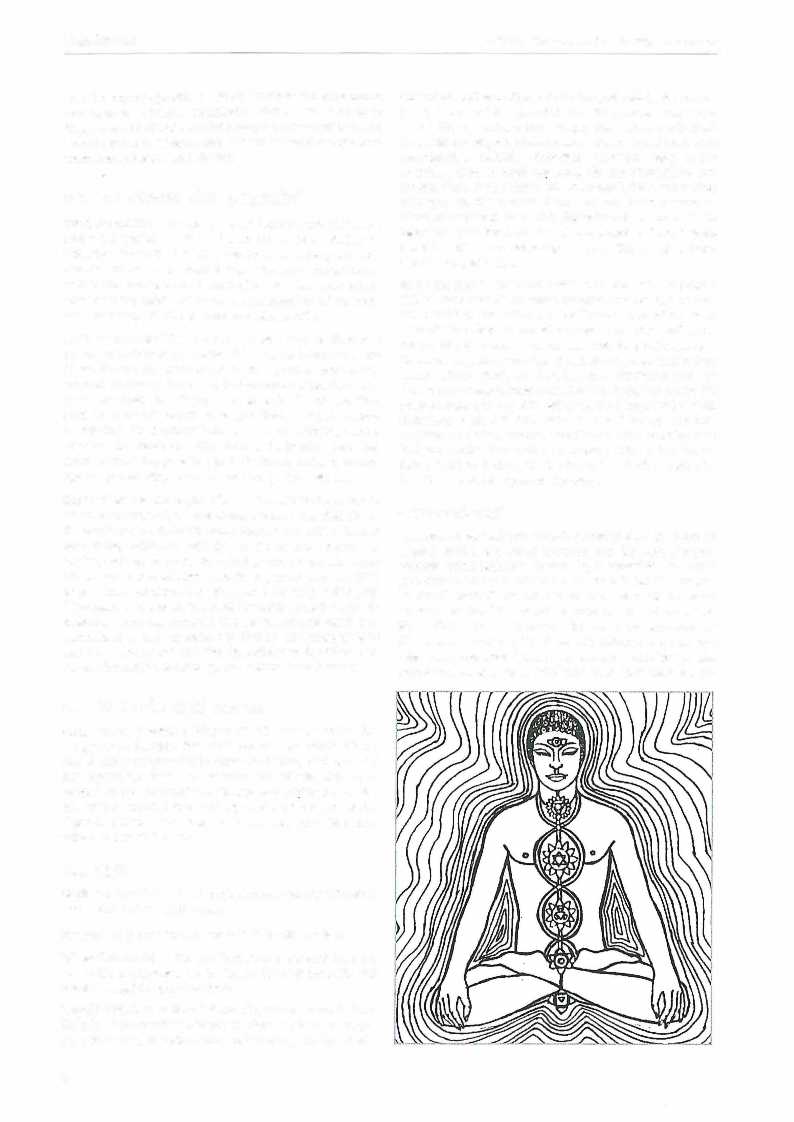
Kur:ic;lalinT-yoga
Auch im hatha-yoga gibt es wie im Patafijalis raja-yoga yamas und niyamas (ethische Disziplinen). Gerade für intensivere Yogapraxis sind strenge Ernährungsregeln vorgeschrieben. Die höchste stufen des hatha-yoga sind wie im Patafijalis raja-yoga pratyahara, dharaf)a und dhyana.
-
-
Das Wesen der kuoc;ialini
Sakti, die göttliche Energie, hat zwei Aspekte, den statischen und den dynamischen. Einer ist ohne den anderen nicht mög lich. Diese Polarität ist, ähnlich den Polen eines Magnets, not wendig, um das Gleichgewicht des Universums aufrechtzuer halten. Die kosmische sakti manifestiert sich im menschlichen Körper als kuf)<;JalinT und Lebensstrom. Kuf)<;JalinT ist die stati sche Grundlage für die dynamischen Lebenskräfte.
Der Mensch ist der Mikrokosmos, der kleine Kosmos. Alles, was im äußeren Universum existiert, ist auch im Menschen. Alle Dinge, die man im Universum sieht, Berge, Flüsse usw. existie ren auch im Körper. Alle echten Bestandteile und Bereiche exis tieren innerhalb des Körpers, und so auch die höchste siva sakti. Im menschlichen Körper wohnt siva im sahasrara-cakra im Scheitel. Die kuf)<;JalinT befindet sich im mD!adhara-cakra oder an der Basis der Wirbelsäule. MD!adhara bedeutet
,,Wurzelstütze". Kuf)<;JalinT ist die Kraft, die die statische Grund lage des ganzen Körpers und seiner beweglichen Teile ist.
Kuf)<;JalinT ist die Urenergie, die sich im mD!adhara-cakra in einem schlummernden potenziellen Zustand befindet. Sie ist die kosmische Kraft im individuellen Körper. Aber sie ist potenziell eine starke, spirituelle sakti (Kraft). Sie ist eine elektrische, feurige, verborgene Kraft, die mächtige Urkraft, die aller orga nischer und anorganischer Materie zugrunde liegt. Sie wird wegen ihrer spiralförmigen Bewegung im Körper des yogT Schlangenkraft genannt. Wenn sie erwacht, erzeugt sie die zi schenden Laute der Schlange und steigt aufwärts durch den Zentralkanal in der SU$umna. Das Steigen der kuf)<;JalinT-sakti und ihre Vereinigung mit siva im sahasrara bewirken den Zustand höchsten Bewusstseins und spiritueller Erfahrung.
-
Die näc;iis und cakras
Jeder Teil des physischen Körpers ist mit seinem astralen Ge genspieler verbunden. Der physische und der astrale Körper stehen daher miteinander in enger Beziehung, sind aber auf der materiellen Ebene voneinander unabhängig. Alle sechs cakras (,,Räder", Zentren) und die SU$Umna-nadi befinden sich im astralen Körper. Cakras und SU$Umna-nar;JT entsprechen im physischen Körper den einzelnen Nervengeflechten, Hormon drüsen und der Wirbelsäule.
-
Näc;Hs
Nijr;}Ts sind Energiekanäle. Die yogTs sprechen von 72 000 nar;JTs.
Davon sind drei die wichtigsten:
SU$Umnä ist in der Mitte. Sie verläuft in der Wirbelsäule.
J<;Jä verläuft im linken Teil des Körpers und herrscht über die rechte Hirnhemisphäre. lr;fä ist Träger der Mondenergie, der weiblichen, gefühlsbetonten Kraft.
Pirigalä verläuft im rechten Teil des Körpers und herrscht über die linke Hirnhemisphäre. Pinga!a ist Träger der Sonnenenergie, der männlichen, analysierenden, nach außen gehenden Kraft.
92
Das Wesen der kur:ic;lalinT • Die näc;!Ts und cakras
!r;fa und pinga/a sind nijr;}Ts (astrale Energiekanäle), die dem lin ken und dem rechten sympathischen Nervenstrang des physi schen Körpers entsprechen. Praf)a (die Lebenskraft) fließt durch ir;fä und pingala. Sobald dies geschieht, ist der Mensch in mannigfaltige, weltliche Aktivitäten verstrickt. Yogis wollen erreichen, dass er durch susumna, die der Wirbelsäule ent spricht, fließt, denn solange ir;fa und pingala (links und rechts) tätig sind, ist der Mensch durch Zeit und Raum gebunden. Wenn die SU$umna aktiv wird, überschreitet der Mensch die Begrenzung von Raum und Zeit. Die SU$Umna ist die wichtigste von allen när;/Ts. Ihre Reinigung ist wesentlich für einen Fort schritt im Yogastudium.
Wenn das rechte Nasenloch freier ist als das linke, ist pingalä aktiver. Dann sind die Energien geeignet zum Essen, zum logi schen Denken, zum schnellen Ausführen von Arbeiten, beim Mann für den Geschlechtsverkehr usw. Ist das linke Nasenloch offener, ist ir;fä aktiver. Dann sind die Energien geeignet, etwas Neues zu beginnen, wichtige Entscheidungen zu treffen (die immer intuitiv sind), für künstlerische Aktivitäten und für Frauen zum Geschlechtsverkehr. Normalerweise wechselt die offenere Seite alle 110 Min. Wechselt die offenere Seite nicht spätestens nach 4-6 Std., kann man auf Energieungleich gewichte schließen, welche psychischen oder emotionellen Problemen oder Krankheiten vorauseilen. Sind beide Nasen löcher gleich weit offen, ist dies die beste Zeit für die Medita tion. Denn dann ist SU$Umnä-när;JT offen.
-
Su!?umnä-nä<;H
Die SU$Umna verläuft vom mD!adhara-cakra, das seinen Sitz im zweiten Wirbel der Steißbeinregion hat, bis zum brahma randhra (Schädelöffnung, Fontanelle) . Die westliche Anatomie sagt, dass im Rückenmark ein Canalis centralis (/at. für „zentra ler Kanal") verläuft, der von weißer und grauer Gehirnmasse umgeben ist. Das Rückenmark befindet sich im Hohlraum der Wirbelsäule. Ebenso befindet sich auch die SU$Umnä im Rückenmarkskanal und hat feine Unterteilungen. Sie ist von roter Farbe wie agni (Feuer). Die SU$Umnä durchdringt alle cakras und ist eine reine Intelligenz. Man kann über die su-
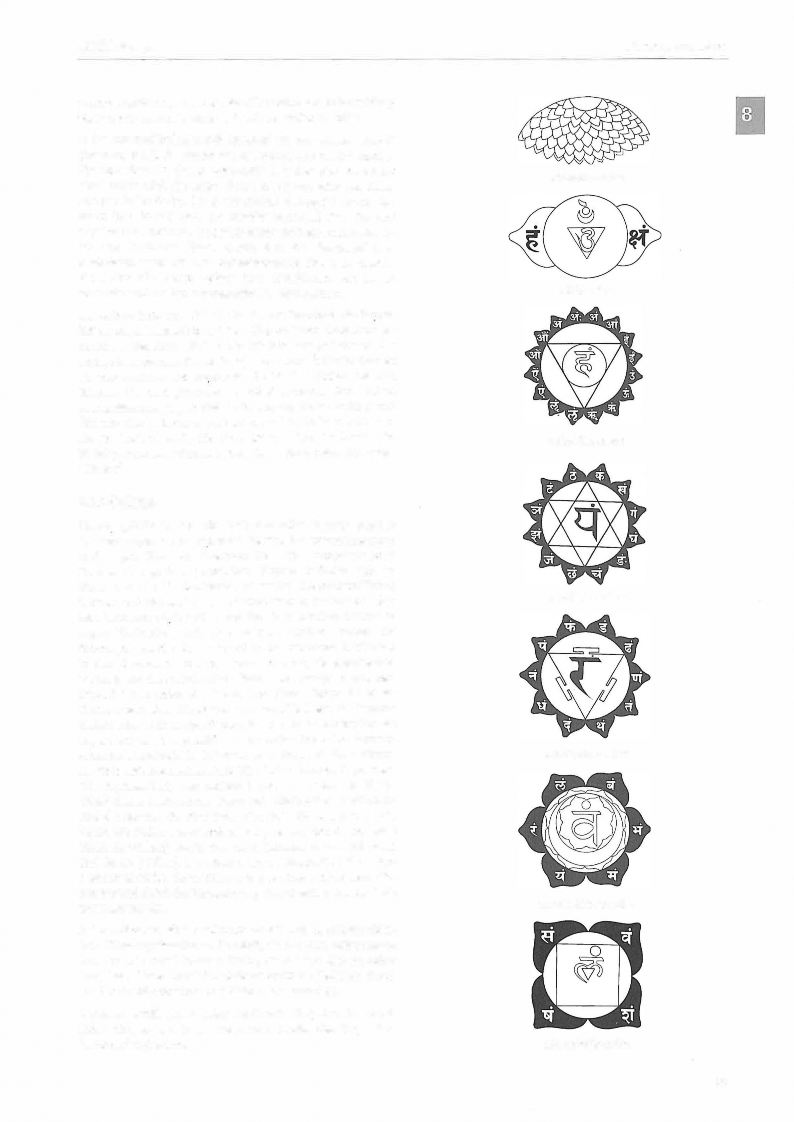
Kur:,c;lalini-yoga
$Umnä meditieren, als ob sie eine Lichtkette aus äußerst feinen Fasern, wie sie sich in einer Lotosblume befinden, wäre.
In der SU$Umnä befindet sich eine nä(IT mit dem Namen „vajrä" (Diamant, Blitz). Sie strahlt wie die Sonne und besitzt rajasige Eigenschaften. In dieser vajrä-näQT befindet sich wiederum eine andere näQT, die „citrä" heißt. Sie ist von sattwiger Natur und von heller Farbe. Die Eigenschaften des agni (Feuers), des sürya (der Sonne) und des candra (Mondes) sind die drei Aspekte von brahman. Innerhalb dieser citrä ist ein noch feine rer und kleinerer Kanal, durch den die kul)(ialinT vom mD/ädhära-cakra bis zum sahasrära-cakra steigt. In diesem Kanal sind alle Haupt- cakras bzw. Lotosblüten, von denen jedes ein anderes Bewusstseinsniveau repräsentiert.
Das untere Ende von citrä ist das Tor von brahman. Die kun(ia linT durchgeht dieses Tor auf dem Weg zu ihrem Bestimmungs punkt im Kleinhirn. Citrä ist die höchste und geliebteste der nä(iTs, sie ist wie ein dünner Faden. leuchtend in fünf Farben ist sie das Zentrum der susumnä. Sie ist der vitalste Teil des Körpers. Sie wird „himmlischer Weg" genannt. Eine andere Beschreibung sagt: ,,Citrä ist schön wie eine Kette von Licht und fein wie eine Lotosfaser, und sie scheint im Geist der Weisen. Sie ist äußerst zart, die Erweckerin reiner Weisheit, die Verkörperung aller Glückseligkeit, deren Natur reines Bewusst sein ist."
-
-
Cakras
Cakras (,,Räder") sind die Geflechte oder Zentren subtiler Lebensenergie an der susumnä. Sie sind Bewusstseinszentren und Lagerplätze für Energiekräfte. Die entsprechenden Zentren des groben, physischen Körpers befinden sich im Rückenmark und in den Nervengeflechten. Die grobstofflichen Nerven und Geflechte haben starke Verwandtschaft mit den feinstofflichen nädTs und cakras. Da die physischen Zentren in enger Verbindung mit den astralen stehen, haben die Schwingungen, die durch die vorhin beschriebenen Methoden in den physischen Zentren erzeugt werden, die gewünschte Wirkung auf die Astralzentren. Wie schon gesagt wurde, ver körpert jedes cakra ein Stadium des Bewusstseins. Es ist ein Zentrum zartesten Erkennens und vermittelt ein bestimmtes Gefühl oder Glückseligkeit oder Freude. Es ist tatsächlich ein Lagerplatz für Energiekräfte. Jedes cakra hat seine vorherr schende Charakteristik. In jedem cakra herrscht ein bestimm ter Gott und eine bestimmte Göttin. Jedes cakra wird durch ein Tier repräsentiert, was bedeutet, dass das cakra die Eigen schaft dieses bestimmten Tieres hat. MD/ädhära bis visuddha sind die Zentren der fünf Elemente: Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther. Die sieben Haupt-cakras entsprechen den sieben /okas (Ebenen, Welten), sowie den verschiedenen sarTras (Körpern) und kofos (Hüllen). Sie können durch Meditation über eine bestimmte Farbe, durch Wiederholung eines bestimmten bija mantra und durch die Visualsierung eines bestimmten Symbols angeregt werden.
Jedes cakra hat eine bestimmte Anzahl von Lotosblütenblät tern. Diese repräsentieren die nä(iTs, die von dem cakra ausge hen, und die verschiedenen Kräfte, welche von diesem cakra ausgehen. Diese Lotosblütenblätter werden wiederum durch bestimmte bija-mantras und Farben angesprochen.
Daneben erfüllt jedes cakra bestimmte Aufgaben im physi schen Körper, was in der folgenden Tabelle allerdings nicht berücksichtigt wurde.
Die näc;lis und cakras
sahasrära-cakra
äjfiä-cakra
visuddha-cakra
anähata-cakra
mal)i-pDra-cakra
svädhi$thäna-cakra
mD/ädhära-cakra
93
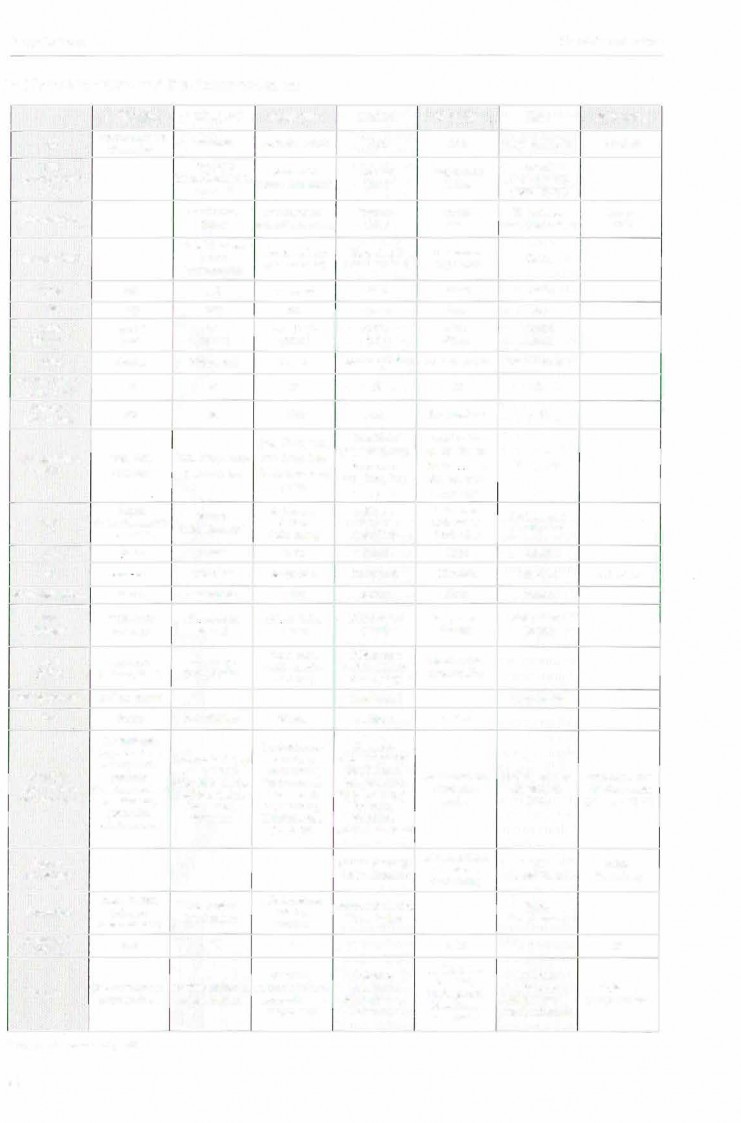
Kur:u;JalinT-yoga Die näc;lTs und cakras
-
Die sieben cakras und ihre Entsprechungen
svädhi$thäna
mar:ii-püra
anähata
visi.Jddha
äjfiä
Kreuzbein
Höhe des Nabels
Herz
Kehle
Mitte des Kopfes
Scheitel
-
sahasrära
mülädhära
Sitz
unteres Ende der Wirbelsäule
k�etra liliga / yoni nabhi-cakra hrc-cakra kal)\ha-cakra tri-kutT
organen)
Augenbrauen)
Geschlechts-
Bauchspeichel-
Thymus-
Schild-
Hirnanhangs-
Zirbel-
drüsen
drüse, Nebennieren
drüse
drüse
drüse,Hypophyse
drüse
{korreiierendes (in den Geschlechts- (hinter dem Nabel). (Herz) (Kehle) (zwischen den
cakra)
Hormondrüse
Beckengeflecht Sonnengeflecht Herzgeflecht Halsknoten,
lumbosacralis)
Nervengeflecht (Plexus (Plexus solaris) (Plexus cardialis) Vagus-Nerv Gehirn
Farbe gelb weiß orangerot blau violett weiß bTja la']'l va']'l ram yam ham 0']1
tattva prthivT äpas tejas / agni väyu akasa avyakta
(Element) (Erde) (Wasser) (Feuer) (Luft) (Äther) (Geist)
yantra Quadrat Mondsichel Dreieck sechszackiger Stern Kreis im Dreieck Dreieck im Kreis
6 10 12 16 2
Anzahl der Blüten- 4
blätter/nät;fis
rot weiß
Farbe der rot blau rot lila-dunkelgrau Blütenblätter
\la']'l,\lha']'l, l)a']'l, ka']'l, kha']'l, a']'l, a']'l, im,
bijas der Blüten- varn, Sam, ba']'l,bha']'l,ma']'l, ta']'l,tham,da']'l, ga']'l,gham,lia']'l, Tm, um, ürn, rrn,
blätter sam,sa']'l ya']'l,ra']'l,la']'l dha']'l,na']'l,pa']'l,
ca']'l,cha']'l, f'11,!m,lm,e']1, ham,ksam
pha']'l ja']'l,jha']'l,iiam, airn, orr,, aurp,
ta'11,tham a']1']1,* ai)m*
Gal)esa Brahma dreiäugiger dreiäugiger Mahesvara Sadasiva oder
Gott (oder viergesichti- Salikara Salikara Sadasiva als
ger Brahma)
(oder Näräyal)a)
(oder Vi5l)u)
(oder Siva)
bindu-rüpa
Sambhunäda
Göttin
DakinT
RäkinT
LakinT
Kakini
Sakini
Hakini
loka
bhur loka
bhuvar-loka
svarga-loka
mahar-/oka
jiiana-loka
tapo-loka satya-loka
Sinneswahrnehm.
Geruch
Geschmack
Sehen
Tastsinn
Hören
Denken
sarTra
sthüla-sarira
süksma-sarira
süksma-sarira
süksma-sarTra
karal)a-sarira
käral)a-sarira
(Körper)
(physisch)
(astral)
(astral)
(astral)
(kausal)
(kausal)
kosa anna-maya pral)a-maya mano-maya vijiiäna-maya ananda-maya
nale Hülle) tuelle Hülle)
{Hülle) (Nahrungshülle) (Energiehülle) (geistig-emotio- (geistig-intellek- (Wonnehülle)
granthi (Knoten) brahma-granthi vi5l)u-granthi rudra-granthi Tier Elefant Krokodil-Fisch Widder Antilope Elefant
Beständigkeit, Durchsetzungs- Offenheit,
Ruhe,Ausdauer, Hingabe, Loslassen, vermögen, Anpassungsfähig-
Charakter- eigenschaften des Elementes
Gleichgewicht, Liebe,Demut, inneres Feuer, keit,Toleranz, gesunder Mitgefühl, Mitleid, Temperament, Kommunikation, Menschenverstand, Intuition,Fließen, Leidenschaft, Weite,vielseitiges
Realitätssinn, Gottesliebe, Begeisterung, Interesse,
Sparsamkeit, Vertrauen Wahrhaftigkeit, Verstehen, Prinzipientreue Kreativität Aufnahmefähigkeit
Kommunikation, Intellekt,Intuition, Empfangen der Ausdrucks- alle geistigen göttlichen Gnade vermögen Kräfte (,,Heiliger Geist")
höhere änanda (Wonne), sat (reines Sein), cit reines
Eigenschaft Liebe,Hingabe
unendliche Ausdehnung
(reines Wissen) Bewusstsein
Essen, Trinken, Sex,Familie: Selbstausdruck, Dienen,reine Liebe, Selbst-
Selbsterhaltung
Ansehen
5,8
3, 10
6
1, 7
2, 11
4,9
12
Motivation Schlafen:
Sonnengruß-
-
stellung
-
Arterhaltung
Macht,
Vision Gottes verwirklichung
näväsana, haläsana, sarväligasana, STr�äsana,
äsana
pascimottanasana, pascimottänäsana, pascimottanasana, matsyasana, matsyendrasana matsyendräsana matsyendrasana, bhujangäsana,
mayuräsana dhanuräsana
halasana, bhujangäsana, salabhasana, dhanuräsana
näväsana, slrsasana, bhujangasana, matsyendräsana matsyendräsana
-
Aussprache wohl: amm,ahm
94
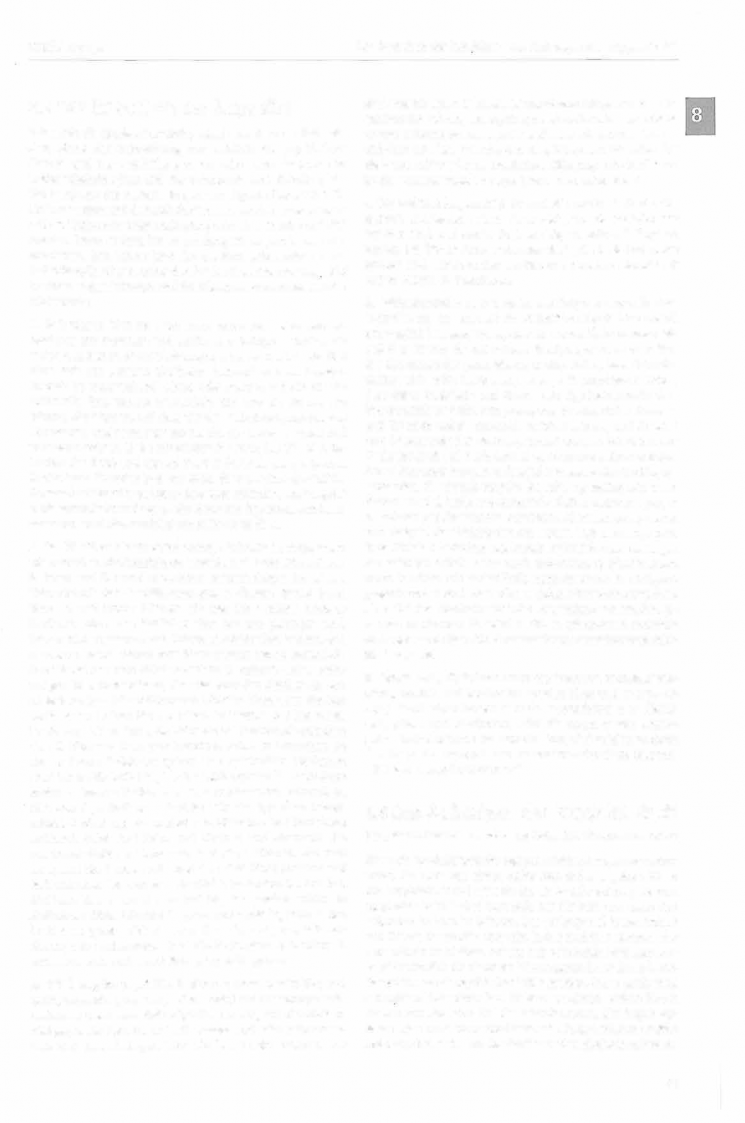
Kur:ic;lalinT-yoga
-
-
-
Das Erwachen der kur:,c;falinT
Wie rasch die kur:,c;Jalini erwacht, hängt vom Grad der Reinheit, dem Stand der Entwicklung, der Reinheit der psychischen Nerven und der Vitalhülle und vor allem vom Ausmaß der Leidenschaftslosigkeit und der Sehnsucht nach Befreiung ab. Die Reinigung des Herzens ist sehr wichtig. Die Natur wird die Kraft erwecken und dem Schüler Wissen geben, sobald er dazu reif ist. Nichts von tiefer Bedeutung wird dem Schüler enthüllt werden, bevor er dazu bereit und fähig ist, es ganz in sich auf zunehmen. Kein Lehrer kann ihm die Kraft geben oder ihn zur Selbstdisziplin führen. Unter den für das Erwachen der kur:,dalini bestimmenden Faktoren sind die folgenden wahrscheinlich die wichtigsten:
-
Selbstloses Dienen: Man kann schwerlich eine bessere Methode zur mentalen und spirituellen Reinigung finden, als anderen zu dienen, ohne Belohnung zu erwarten und buchstäblich ohne sich des Dienens überhaupt bewusst zu sein. Passives Gutsein ist unzureichend, aktive oder positive Güte ist für die spirituelle Entwicklung wesentlich. Gib wie die Sonne, die Bäume, die Blumen, auf dass wir den Entwicklungszyklus des Universums und seine stärkste Macht, die Liebe, erhalten und verewigen mögen. Liebe schwingt in der Form des Dienens. Be trachte das Glück und den Schmerz anderer als deine eigenen. Es gibt keine Fremden in dieser Welt, denn wir sind alle Gott im Prozess der Entwicklung. Wenn du diesen Geist der Selbstlosigkeit in dir entwickelst und wenn alle Ideen von Egoismus und Mein vergehen, wird die kur:,c;Jalinivon selbst erwachen.
-
Der Dienst an einem guru: Richtige Führung ist nötig, wenn wir versuchen, die kur:,c;Jalinizu erwecken. Wir experimentieren in Raum und Zeit und verwenden unseren Körper für unsere Versuche mit der Vervollkommnung. In diesem Lernen durch Versuch und Irrtum können wir uns des Wissens anderer bedienen, die einen ähnlichen Weg vor uns gegangen sind. Darum ist der guru und sein Schatz an spirituellem Wissen, den er wiederum von seinem guru übernommen hat, so wesentlich. Das Wesen der guru-Schüler-Beziehung verlangt einige Erklä rungen. Man muss wissen, dass der guru den Schüler auf ver schiedenartige Weise prüft; manche Schüler können den Glauben verlieren und keinen Nutzen haben. Im Westen und besonders heutzutage ist es schwer, die Natur der Verbindung, die zwischen dem Schüler und dem guru herrschen sollte, zu verstehen. Da das moderne Erziehungssystem dem spirituellen Wachstum nicht immer förderlich ist, ist eine solche spirituelle Verbindung sowohl schwer zu finden als auch zu verstehen und auszuüben. Eine derartige Beziehung liegt jenseits der typischen Lehrer schüler-Beziehung; sie umfasst alle Hingabe einer Beziehung zwischen Vater und Sohn und Ehefrau und Ehemann. Sie beinhaltet Fleiß und Interesse, und die Lektionen, die man lernt, sind nicht immer mit konkreten Maßstäben messbar und wahrnehmbar. Der guru kann den Geist des Strebenden erheben und kann ihm, wenn er ernsthaft ist, eine gewisse spirituelle Kraft übermitteln. Obwohl der guru notwendig ist, kann er den Schüler zu guter Letzt nur zum Tor seines eigenen Wissens führen; dann muss dieser durch die Kraft seiner Selbstdisziplin und seiner Sehnsucht nach Reinigung weitergehen.
-
Ernährung im yoga: Die Ernährung muss regelmäßig und leicht, angenehm, nahrhaft, sattwig (rein) und ausgewogen sein. Besonders wenn man viel prär:,äyäma macht, um die näc;JTs zu reinigen, sollte man sich nicht überessen und keine schwer ver daulichen und stark gewürzten Speisen zu sich nehmen. Wir
Das Erwachen der kur:,dalinT • Das Aufsteigen der kur:,c;lalinHakti
sind, was wir essen. Die Reinheit des Geistes hängt sehr von der Reinheit der Nahrung ab. Je gröber, denaturierter oder konservierter unsere Nahrung ist, umso mehr entfernen wir uns von den na türlichen Quellen. Früchte, Gemüse, Nüsse und Getreide sind die beste Nahrung für die Meditation. Mäßigung in der Ernährung ist die weiseste Regel im yoga. (siehe Anm. unter 9.3.2).
-
Ort und Zeit: Regelmäßigkeit von Zeit und Ort ist für die Me ditation unerlässlich. Habe einen Platz, wo die Ablenkungen minimal sind, und wohin du jeden Tag zur selben Zeit gehen kannst. Die frühen Morgenstunden sind gut, da sie besonders sattwig sind. Nimm vorher ein Bad und versuche niemals mit vollem Magen zu meditieren.
-
Geisteskontrolle: Im Grunde ist das Ziel jeden yogas Geistes kontrolle. Sei dir jederzeit der Aktivitäten des Geistes soweit wie möglich bewusst. Wisse, dass du deinem Unterbewusstsein befehlen kannst, dir bei deinem Reinigungsprozess zu helfen. Säe den Samen des guten Willens zu allen Zeiten; lasse deine Ge danken sich nicht zerstreuen; erlange Einpünktigkeit. Wisse, dass deine Gedanken und Worte mächtige Instrumente sind. Verschwende sie nicht. Bringe das, was du wünschst in Gedanke und Tat nach außen. Entwickle Geisteskontrolle, und du wirst zum Bewusstsein der Wonne gebracht werden. Die Größe der Gedankenkraft soll noch einmal ausdrücklich betont werden. Swami Sivananda hat gesagt, dassjeder Gedanke eine Schwingung aussendet, die niemals vergeht. Sie schwingt weiter, und wenn Gedanken edel, heilig und stark sind, schaffen sie Schwingungen in anderen gleichgesinnten Gemütern. Alle Menschen, denen zum Beispiel der Weltfrieden am Herzen liegt, senden je nach ihrer Fähigkeit Gedanken aus. Daraus ergibt sich, dass die Folgen der geistigen Arbeit, wenn auch unbewusst, spürbar werden, denn sie wirken mit großer Kraft, wenn sie einmal in Bewegung gesetzt worden sind. Man sollte es sich zur Gewohnheit machen, einen Teil der Meditationszeit der Aussendung von Friedensge danken zu widmen: Sie werden sich so mit anderen ähnlichen
Gedanken vereinigen. Die Gesamtwirkung so vereinter Gedanken
ist riesengroß.
-
asanas und prar:,ayama: Durch die Praxis von äsanas, prär:,ä yäma, mudräs und Meditation werden Hitze und Energie er zeugt. Nach einer langen Periode ununterbrochener Übung, prär:,äyäma und Meditation, wird die su?umnä von Unrein heiten befreit sein und die erwachte kur:,c;JalinT-sakti steigt durch den Kanal der su?umnä zum sahasrära-cakra (dem tausend blättrigen Lotos) im Gehirn auf.
-
-
Das Aufsteigen der kur:H;ialinT-sakti
(vgl. ,,Swami Sivanandas Inspiration und Weisheit für Menschen von heute")
Wenn die kur:,c;JalinTerwacht, steigt sie nicht sofort zum sahasrära cakra. Sie muss von einem cakra zum anderen gehen. Wenn die kur:,c;JalinT einmal erweckt ist, ist es sehr schwer, sie zum mar:,i-püra beim Nabel, zum äjnä bei der Stirn und dann zum sahasrära im Kopf zu bringen. Das verlangt viel Konzentration und Übung. Der yagiist versucht, in den niedrigen Zentren oder Ruheplätzen zu bleiben, anstatt seine Praktiken fortzusetzen - er hält irrtümlich die niedrigen Wonnezustände für die höheren. Der yogTmuss alle psychischen Kräfte meiden, da sie Hindernisse auf seinem Weg darstellen. Er kann an diesen Kräften haften bleiben und das letzte Ziel der Erleuchtung aus den Augen ver lieren. Man muss immer wachsam sein. Sogar nachdem er äjfiä cakra erreicht hat, kann der Schüler zu den niederen cakras zu-
95
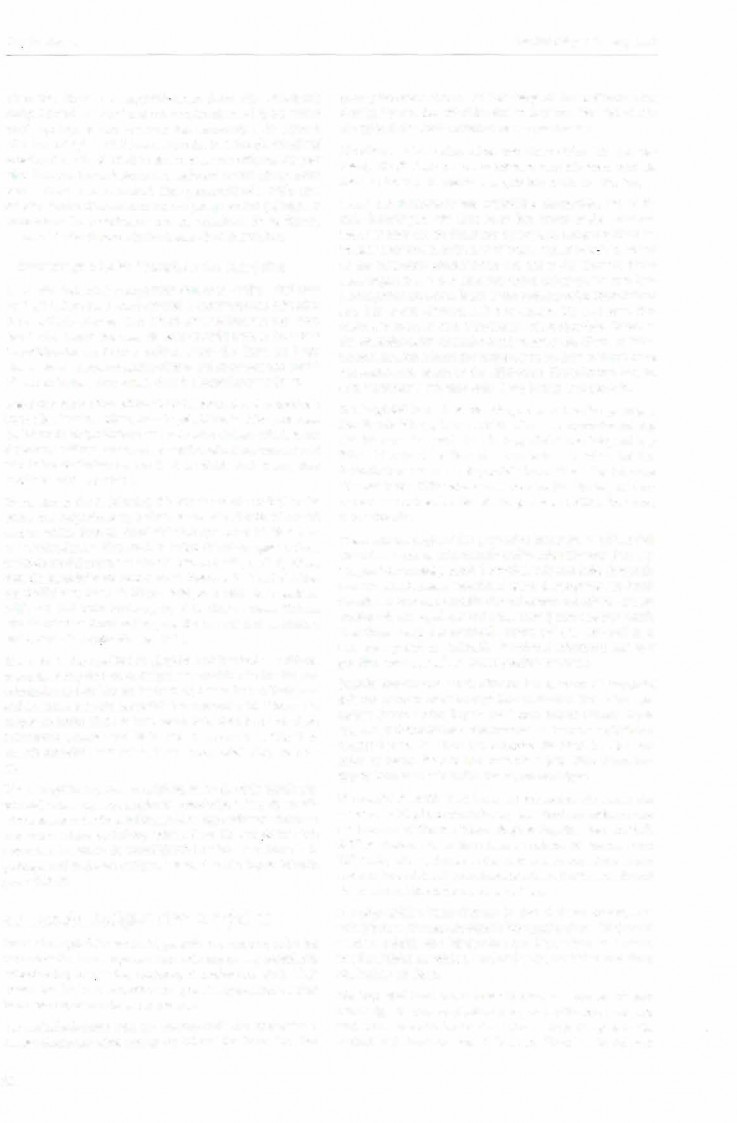
Kunc;lalinT-yoga
rückfallen. Wenn der ku(lc;/alinT Strom durch die Wirbelsäule steigt, kribbelt es manchmal wie von Ameisen, oder, bei reinen yogTs, springt er und erreicht das sahasröra sehr schnell. Manchmal steigt er auf hüpfende Art oder im Zickzack. Manchmal schwimmt er wie ein Fisch in einem Meer von Wonne. Der yogT wird Hilfe von innen bekommen, während er von einem cakra zum anderen voranschreitet. Eine geheimnisvolle Kraft, eine geheimnisvolle Stimme wird ihn auf jedem Schritt geleiten. Er muss dieser Kraft vertrauen und ihr erlauben, ihn zu führen, denn es ist seine innere intuitive Natur, die sich entfaltet.
-
Erfahrungen beim Erwachen der kur:,<;ialinT
In der Meditation hat man göttliche Visionen, erfährt göttlichen Duft, göttlichen Geschmack, göttliche Berührung und hö�t gött liche anöhata-Klänge. Man erhält Unterweisungen von Gott. Das deutet darauf hin, dass die sakti erweckt worden ist. Wenn im miJ/ödhöra ein Pochen auftritt, wenn die Haare zu Berge stehen, wenn uc;Jc;/Työna-, jölan-dhara- und miJ/a-bandha unwill kürlich auftreten, dann wisse, dass die ku(lc;/alinT erwacht ist.
Wenn der Atem ohne Mühe stillsteht, wenn kevala-kumbhaka von selbst kommt, wisse, dass ku(lc;/alinT-sakti aktiv geworden ist. Wenn du prä(lo-Ströme zum sahasröra steigen fühlst, wenn du Wonne erfährst, wenn du ganz automatisch Of!1 wiederholst und keine Gedanken an die Welt im Geist sind, wisse, dass ku(lc;/alinT-sakti erwacht ist.
Wenn sich in der Meditation die Augen auf die tri-kutT in der Mitte der Augenbrauen heften, wenn die sömbhavT-mudrö eintritt, wisse, dass die ku(lc;/alinT aktiv geworden ist. Wenn du in verschiedenen Körperteilen prä(lo-Schwingungen spürst, wenn du Erschütterungen wie elektrische Schläge spürst, wisse, dass die ku(lc;/alinTaktiv geworden ist. Wenn du in der Meditation das Gefühl hast, dass kein Körper da ist, wenn sich die Augenlider schließen und trotz Anstrengung nicht öffnen, wenn Ströme wie elektrischer Strom entlang der Nerven auf und ab fließen, wisse, dass die ku,:idalinT erwacht ist.
Wenn du in der Meditation Einsicht und Inspiration erfährst, wenn die Natur dir ihre Geheimnisse enthüllt, alle Zweifel ver schwinden und du klar die Bedeutung der vedischen Texte ver stehst, wisse, dass die ku,:ic;JalinTaktiv geworden ist. Wenn dein Körper so leicht wird wie Luft, wenn dein Geist in schwierigen Situationen ausgewogen bleibt und wenn du unerschöpfliche Energie zur Arbeit hast, wisse, dass die ku,:ic;JalinTaktiv geworden ist.
Wenn du göttlichen Rausch erfährst, wenn du Rednerkraft ent wickelst, wisse, dass die ku,:ic;JalinT erwacht ist. Wenn du unwill kürlich ösanas oder Yogastellungen ohne den geringsten Schmerz und ohne Mühe ausführst, wisse, dass die ku,:idalinT aktiv geworden ist. Wenn du unwillkürlich herrliche erhabene Lob� gesänge und Gedichte verfasst, wisse, dass die ku,:ic;JalinT aktiv geworden ist.
-
-
Das Aufsteigen der kuQ(;jalinT
-
Wenn die ku,:ic;JalinT erwacht ist, geht sie von cakra zu cakra bis zum sahasröra. In der su:;umnö sind sechs cakras. Das miJ/ödhöra, svödhi:;thöna, mani-piJra, anöhata, visuddha und öjfiö. Über ihnen allen liegt das sahasröra-cakra, das Hauptzentrum. Daher ist es kein cakra wie die sechs anderen.
Das miJ/ödhöra-cakra sitzt am unteren Ende der Wirbelsäule. Das svödhi:;thöna-cakra sitzt an der Wurzel der Genitalien. Das
96
Das Aufsteigen der kur:ic;lalinT
ma,:ii-piJra-cakra sitzt in der Nabelgegend. Das anöhata-cakra sitzt im Herzen. Das visuddha sitzt im Kehlkopf. Das öjfiö sitzt in der tri-kutT, der Stelle zwischen den Augenbrauen.
Die sieben cakras entsprechen den sieben /okas (Ebenen des Seins). Die fünf cakras vom miJ/ödhöra zum visuddha sind die Zentren der fünf Elemente. Das öjfiö ist der Sitz des Geistes.
Wenn der Yogaschüler das miJ/ödhöra durchstößt, hat er die Erde bezwungen. Die Erde kann ihm nichts mehr anhaben. Wenn er über das svödhi:;thöna hinausgeht, hat er das Element Wasser bezwungen. Er ist in Verbindung mit bhuvar loka. Wenn er das ma,:ii-piJra überschritten hat, hat er das Element Feuer bezwungen. Das Feuer kann ihm nichts anhaben. Er ist in Ver bindung mit svarga-/oka. Wenn er das anöhata-cakra überschritten hat, hat er das Element Luft bezwungen. Die Luft kann ihm nichts anhaben. Er ist in Verbindung mit mahar-loka. Wenn er das visuddha-cakra überschritten hat, hat er das Element Äther bezwungen. Äther kann ihm nichts anhaben. Er ist in Verbindung mit Jfiöna-loka. Wenn er das öjfiö-cakra überschritten hat, ist er in Verbindung mit tapo-loka. Dann betritt er satya-/oka.
Die ku,:ic;JalinT kann über vier Wege zum sahasröra gelangen. Der längste Weg geht vom miJ/ödhöra zum sahasröra entlang des Rückens. Der yogT, der die ku(lc;/alinT diesen Weg entlang führt, ist sehr stark. Das ist der schwierigste Weg. Bei SrT sarikaräcärya nahm die ku,:ic;JalinT diesen Weg. Der kürzeste Weg geht vom öjfiö-cakra zum sahasröra. Der dritte geht vom Herzen zum sahasröra. Der vierte geht vom miJ/ödhöra vorne zum sahasröra.
Wenn sich der yogfauf das äjfiö-cakra konzentriert, öffnen sich die unteren cakras automatisch und werden überwunden. Der ku,:ic;JalinT-Strom steigt durch die Wirbelsäule und kribbelt manch mal wie eine Ameise. Manchmal, wenn der yogT rein ist, hüpft sie wie ein Affe und erreicht das sahasröra. Manchmal erhebt sie sich wie ein Vogel, der von einem Zweig zum anderen hüpft. Manchmal steigt der spirituelle Strom auf wie eine Schlange und bewegt sich im Zickzack. Manchmal schwimmt der yogT glücklich wie ein Fisch im Ozean göttlicher Wonne.
Der/die Yogaübende erhält Hilfe von innen, wenn die ku(lc;/alinT sich von cakra zu cakra bewegt. Eine mysteriöse Kraft, eine mys teriöse Stimme wird ihn/sie bei jedem Schritt führen. Er/sie muss unerschütterliches vollkommenes Vertrauen zur göttlichen Mutter haben. Sie führt den södhaka. Sie führt Ihr Kind von cakra zu cakra. Sie gibt ihm unsichtbar jede Hilfe. Ohne Ihre Gnade kann man kein Zoll in der su:;umnö steigen.
Die ku,:ic;JalinT bleibt nicht lange im sahasröra. Die Dauer des Verweilens hängt von der Reinheit, dem Grad des södhana und der inneren spirituellen Stärke des/der Yogaübenden ab. Viele Schüler bleiben nur in den niederen cakras. Sie werden vom Glück mitgerissen, das sie in den niederen cakras erfahren und machen bedingt durch ihre missverstandene Zufriedenheit nicht den Versuch, das sahasröra zu erreichen.
Der yogT erfährt Versuchungen in den niederen cakras, den Ruheplätzen. Er muss alle siddhis (übernatürlichen Fähigkeiten) meiden. Siddhis sind Hindernisse am Weg. Wenn er beginnt, mit den siddhis zu spielen, wird er das Ziel verfehlen und einen Rückschlag erleiden.
Die ku,:ic;JalinT kann leicht erweckt werden, aber es ist sehr schwierig, sie zum ma,:ii-piJra-cakra, zum öjfiö-cakra und von dort zum sahasröra im Kopf zu bringen. Es verlangt sehr viel Geduld und Ausdauer von Seiten des Übenden. Es ist sehr
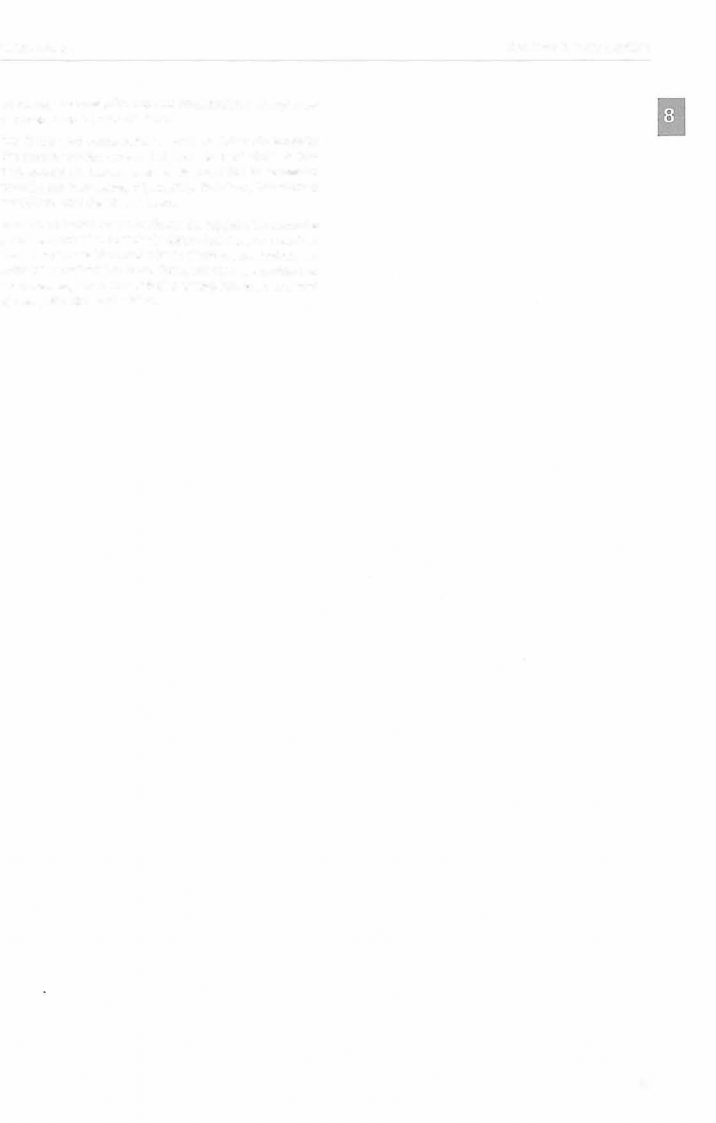
Kur:,9alin1-yoga
schwierig, das maf)i-püra-cakra zu durchstoßen. Der yogT muss in diesem Zentrum sehr viel üben.
Der Körper wird weiterbestehen, auch nachdem die kuf)<;falinT das sahasrära-cakra erreicht hat, aber der yogT wird kein Kör perbewusstsein haben, solange die kuf)<;falinT im sahasrära verweilt. Erst wenn kaivalya (endgültige Befreiung, Erleuchtung) erreicht ist, wird der Körper leblos.
Man lebt sicherlich weiter, nachdem die kuf)<;falinTins sahasrära gebracht worden ist. Aber denke daran, dass sie, auch nachdem das sahasrära erreicht worden ist, in einem Moment wieder ins mülädhära zurückfallen kann! Erst wenn man in samädhi fest verwurzelt ist, wenn man kaivalya erlangt hat, kann und wird die kuf)<;falinT nicht mehr fallen.
Das Aufsteigen der kur:,9alin1
97
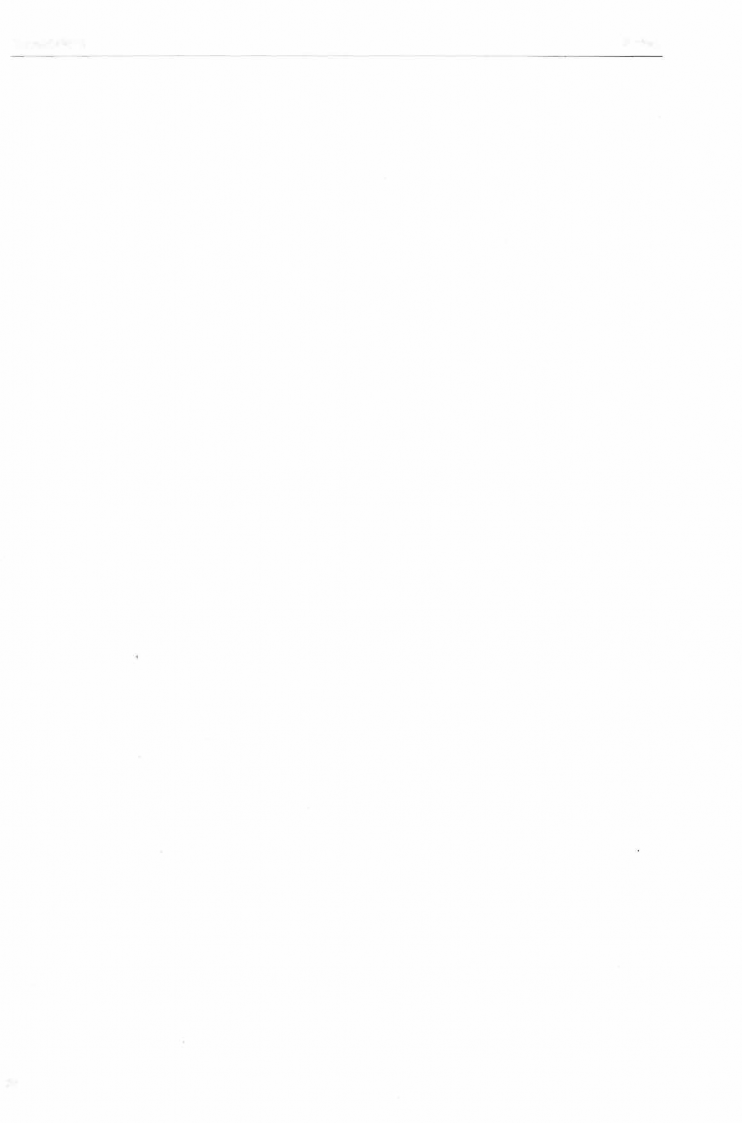
Kur:ic;ialinT-yoga Notizen
98
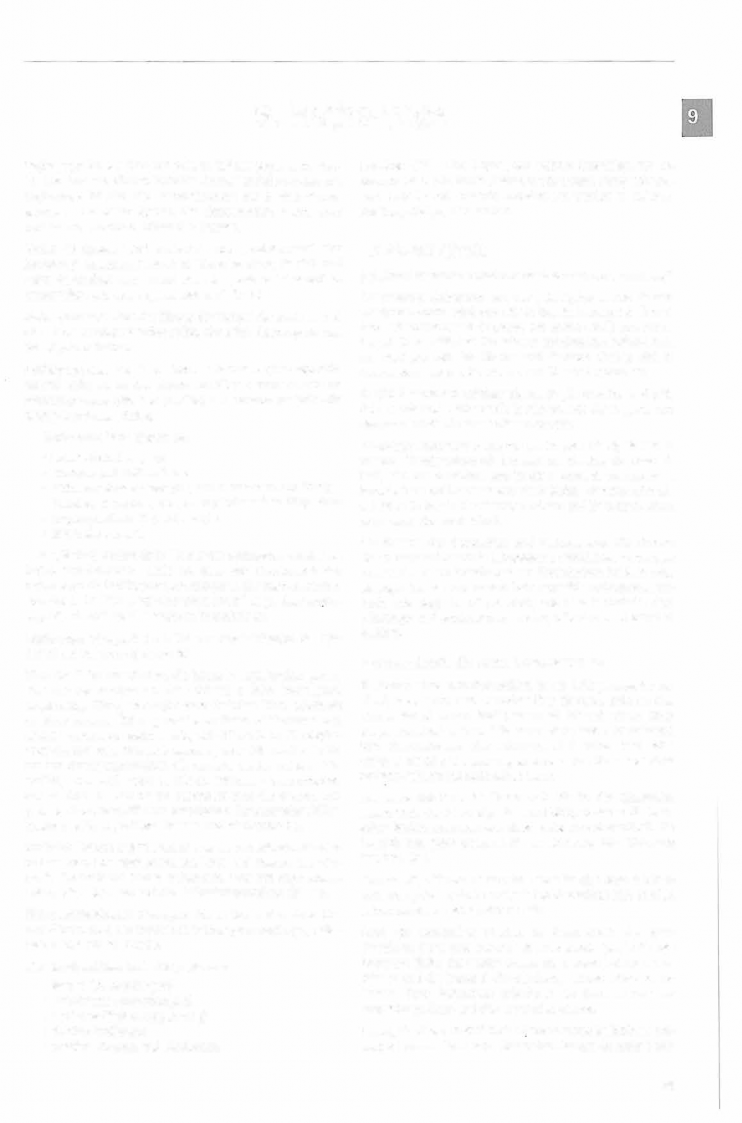
9. Hatha-yoga
Hatha-yoga ist der körperorientierte Teil des yoga. In der tan trischen Interpretation steht ha für „Sonne" und tha für „Mond". Hatha-yoga ist also die Harmonisierung der beiden Grund energien in unserem System, der aktivierenden, wärmenden und der aufbauenden, kühlenden Energie.
Hatha als ganzes Wort bedeutet auch „Anstrengung". Der hatha-yogT übernimmt selbst die Verantwortung für sich und seine Gesundheit und scheut sich nicht, seinen Lebensstil so umzustellen, wie es am gesündesten für ihn ist.
Hatha-yoga sagt, dass der Körper der Tempel der Seele ist und als solcher gepflegt werden sollte, ohne ihn allerdings für das Wichtigste zu halten.
Hatha-yoga sieht den Menschen als Ganzes. Hatha-yoga rich tet sich nicht nur an den physischen Körper, sondern auch an prä,:10maya-kosa (die Energiehülle) und manomaya-kosa (die geistig-emotionale Hülle).
Hatha-yoga kann dienen als:
-
Krankheitsvorbeugung
-
Therapie und Heilmethode
-
Mittel zur Stressvorbeugung und zum Abbau von Stress
-
Mittel zur Erweckung von parapsychologischen Fähigkeiten
-
körperorientierte Psychotherapie
-
spirituelle Disziplin
In der „Hatha(yoga)pradTpikä" (einer der wichtigsten klassischen hatha-yoga-Schriften) heißt es, dass der Hauptzweck des hatha-yoga die Befähigung zum räja-yoga, der Herrschaft über den Geist, ist. Die „Hatha(yoga)pradTpikä" sagt, dass hatha yoga die Grundlage aller anderen Yogapfade ist.
Hatha-yoga ist eigentlich ein Teil von kur:,<;ialinT-yoga, der wie derum ein Teil vom räja-yoga ist.
Viele der Teilnehmer/innen, die heute in Yogastunden gehen, sind anfangs weniger an der spirituellen Seite interessiert. Regelmäßige Übung der hatha-yoga-Praktiken führt jedoch oft zu einer inneren Öffnung, welche zu tiefen Erfahrungen und einem Interesse für spirituelle Aspekte führen kann. Der hatha yoga-Stil von YoGA VIDYA ist in seinem ganzheitlichen Ansatz be sonders darauf ausgerichtet, alle Aspekte des Menschen - kör perlich, emotional, geistig, seelisch, spirituell - anzusprechen und zu fördern. Dazu tragen besonders auch die Grundprinzi pien des YOGA V1ovA-Stils wie prär:,äyäma, Konzentrationshilfen, Ernährungstipps, positives Denken und Meditation bei.
Bezüglich Heilung und Therapie gilt es die betreffenden Gesetze zu beachten: Nur niedergelassene Ärzte und Heilpraktiker dür fen in Deutschland Kranke behandeln. Wer mit yoga Kranke heilen will, sollte also erst die Heilpraktikerprüfung ablegen.
Einige Krankenkassen beteiligen sich an den Kosten für hatha yoga-Kurse, da die vorbeugende Wirkung von hatha-yoga viel fach nachgewiesen wurde.
Die Hauptpraktiken im hatha-yoga sind:
-
äsanas (Yogastellungen)
-
prär:,äyäma (Atemübungen)
-
saväsana (Tiefenentspannung)
-
richtige Ernährung
-
positives Denken und Meditation
Daneben gibt es im hatha-yoga weitere Ratschläge für die Gesundheit sowie kriyäs (Reinigungsübungen). Fortgeschritte nere Praktiken wie mudräs, bandhas etc. werden im Rahmen des kur:,<;ialinT-yoga behandelt.
-
-
Gesundheit
(vgl. ,,Swami Sivanandas Inspiration & Weisheit für Menschen von heute")
Das gesamte Universum, von der mächtigsten Sonne bis zum winzigsten Atom, wird von einem Gesetz beherrscht. überall herrscht vollkommene Ordnung. Die Sonne erfüllt ihre Pflich ten mit Regelmäßigkeit. Sie geht zur richtigen Zeit auf und sinkt zur richtigen Zeit. Die Sterne und Planeten drehen sich in geordneten Bahnen. Sie werden von Gesetzen gesteuert.
Es gibt Gesetze auf geistiger Ebene. Es gibt Gesetze in Physik, Astronomie und Mathematik. Es gibt Gesetze der Hygiene und der Gesundheit, die unser Wesen steuern.
Im großen Universum bricht nur der Mensch häufig die Natur gesetze. Er missachtet oft bewusst die Gesetze der Gesund heit, lebt ausschweifend und ist dann erstaunt, warum er an Krankheiten und Unausgewogenheit leidet. Er missachtet ab sichtlich die Regeln des richtigen Lebens und klagt dann, wenn er an einer Krankheit leidet.
Die Gesetze der Gesundheit sind Naturgesetze. Wir können durch yoga und gesunde Lebensweise Krankheiten vorbeugen oder vorhandene Krankheiten am Fortschreiten hindern oder sie sogar bessern und unsere Lebensqualität verbessern. Den noch unterliegt der Körper auch, wie alles Materielle, dem Alterungs- und Veränderungsprozess, teilweise auch karmisch bedingt.
-
Gesundheit, die erste Voraussetzung
Ein Leben ohne gute Gesundheit ist ein beklagenswerter Zu stand, auch wenn man Herrscher über die ganze Erde ist. Was nützen Reichtum und Besitz, wenn ein Mensch wegen einer Magenkrankheit nicht richtig essen kann, wenn er aufgrund von Rheumatismus oder Lähmung nicht gehen kann oder wenn er die schöne Natur wegen eines grauen Stars oder einer anderen Sehstörung nicht sehen kann?
Der erste Reichtum ist Gesundheit. Sie ist der allergrößte Besitz. Viele der Schwierigkeiten und Nöte, an denen die Men schen leiden, stammen aus einer schlechten Gesundheit. Ein Mensch mit guter Gesundheit hat Hoffnung. Wer Hoffnung hat, hat alles.
Eine wichtige Voraussetzung im Leben ist eine gute Gesund heit. Eine gute physische und geistige Gesundheit hilft, in allen Lebensbereichen erfolgreich zu sein.
Auch für spirituelles Streben ist Gesundheit eine gute Grundlage. Ohne gute Gesundheit ist es schwieriger, in die ver borgenen Tiefen des weiten Ozeans des inneren Lebens vorzu dringen und die letztendliche Glückseligkeit des Lebens zu er langen. Gute Gesundheit erleichtert die Beherrschung der ungestümen Sinne und des lärmenden Geistes.
Ohne gute Gesundheit fällt dir niskäma-karma (selbstloses Die nen) schwerer. Ohne gute Gesundheit kannst du nicht beten
99

Hatha-yoga
und meditieren. Ohne gute Gesundheit kannst du asanas und pra,:,ayama nur eingeschränkt und angepasst üben. Deshalb sagen die Schriften, dass dieser Körper ein Boot ist, 'um den Ozean von sarr,sara (Leben in dieser Welt der Vergänglichkeit) zu überqueren, ein Werkzeug, um verantwortungsbewusst zu leben und mok�a zu erreichen.
Halte das Werkzeug sauber, stark und gesund. Dieser Körper ist für dich ein Pferd, um dich ans Ziel zu bringen. Wenn das Pferd strauchelt, kannst du dein Ziel nicht erreichen. Wenn dieses Werkzeug kaputt geht, wirst du nicht das Ziel von atma-sak�at kara erreichen.
-
Gesundheit ist ein positiver Zustand
Gesundheit ist der Zustand, in dem ein Mensch gut schläft, seine Nahrung gut verdaut, sich im Allgemeinen wohl fühlt und frei ist von Krankheit und Unbehagen. Wenn du vollkommen gesund bist, arbeiten alle Organe, Herz, Lunge, Gehirn, Nieren, Leber und Darm in vollkommener Harmonie und im Gleich klang und führen ihre jeweiligen Funktionen zufriedenstellend aus. Der Puls und der Atemrhythmus sind vollkommen in Ordnung. Die Körpertemperatur ist normal.
Ein gesunder Mensch lächelt und lacht. Er ist fröhlich und glücklich. Er kann seine täglichen Pflichten leicht und bequem ausführen. Ein gesunder Mensch ist imstande, lange zu arbei ten, ohne zu ermüden. Er hat eine gute Verdauung. Er hat die höchste geistige und körperliche Effizienz.
Gesundheit ist ein positiver Zustand. Es ist nicht nur die Abwe senheit von Krankheit. Ein ge�under Mensch kann mehr geisti ge und physische Arbeit leisten. Er kann lange Zeit gut meditie ren. Gesundheit ist eine Gabe von Mutter Natur, die die Kraft hinter dem Leben ist.
-
Wie man sich gesund erhält
Sei besonnen und mäßig. Dann wirst du gesund sein. Bade in der Sonne. Lebe im Freien. Schlafe im Freien. Sonne und fri sche Luft sind deine guten Ärzte. Deine Nahrung soll einfach sein. Iss niemals zu viel. Bewege dich ausreichend. Wenn du dich nicht gut fühlst, faste, bis es dir wieder besser geht.
Werde dein eigener Arzt. Unterstütze die Natur, aber zwinge sie nicht. Lass die Natur dich heilen. Die Natur ist das beste Heilmittel. Medikamente und Ärzte helfen der Natur nur bei ihrer Heilaufgabe. Ein uneinsichtiger Arzt, der das Wirken der Natur stört, schadet mehr, als er nützt.
Durch das Trinken reinen Wassers, das Essen reiner und gesun der Nahrung, durch das Einhalten der Gesetze von Gesundheit und Hygiene, durch regelmäßige Körperübungen und kalte Bäder am Morgen, durch die Praxis von japa (mantra-Wieder holung) und Meditation, durch richtiges Leben, richtiges Den ken, richtiges Handeln, richtiges Verhalten, durch das Einhalten von brahma-carya und dadurch, dass du dich täglich für einige Zeit an frischer Luft und Sonne aufhältst, kannst du wunderba re Gesundheit, Stärke und Vitalität erlangen.
Ein gesunder Mensch muss nicht unbedingt stark sein, und ein starker Mensch muss nicht unbedingt gesund sein. Ein sehr starker Mensch kann an vielen Krankheiten leiden. Ein gesun der und starker Mensch wird zu einem großen Anziehungs punkt. Er strahlt Gesundheit und Kraft aus. Dies spüren alle Menschen, mit denen er Kontakt hat.
100
Gesundheit
• Gesundheit und Ernährung
Das Geheimnis von Gesundheit und ewigem Glück liegt darin, sich immer ein wenig hungrig zu fühlen. überlade den Magen nicht. Zu viel zu essen ist häufig ein Grund für manche Krank heiten. Viele Menschen graben ihr Grab mit den Zähnen. Dem Magen wird keine Ruhe gegönnt. Obwohl wir von uns behaup ten, zivilisierte Menschen zu sein, machen wir doch, wenn es ums Essen geht, viele unbemerkte Fehler. Der Mensch isst im Allgemeinen doppelt soviel, wie sein Organismus braucht. Das beeinträchtigt die Ausscheidung, die Aufnahme und das Wachstum. Alle Organe werden überfordert und erkranken schnell. Deswegen vermeide es, dich zu überessen, und sei sehr mäßig in deiner Ernährung.
Die richtige Art der Nahrung ist sehr wichtig. Viele der Krankheiten der Menschen sind auf eine schlecht ausgewoge ne Ernährung zurückzuführen. Richtige Ernährung ist kein Geheimnis. Man kann sie sehr leicht erlernen. Eine richtige Ernährung ist ein grundlegender Faktor zur Erhaltung vollkom mener Gesundheit und eines hohen Niveaus von Vitalität. Gutes Essen ist nicht teuer. Es fehlt nur häufig an Kenntnissen über Ernährung.
Ernährung ist ein lebenswichtiger Punkt. Habe gute Kenntnis über Ernährung und Diät. Du kannst Arztrechnungen sparen. Du kannst eine gesunde Konstitution entwickeln.
Iss mäßig die Dinge, die, wie du aus Erfahrung weißt, für dich angenehm und leicht verdaulich sind. Eine einfache Ernährung ist die beste.
• Physische Gesundheit und geistige Gesundheit
Es besteht eine enge Verbindung zwischen Geist und Körper. Was du im Geist hast, schlägt sich im Körper nieder. Jede Missstimmung oder Bitterkeit einem Menschen gegenüber beeinflusst den Körper direkt und ruft eine physische Erkran kung hervor. Heftige Leidenschaft, Hass, lang andauernde bitte re Eifersucht, nagende Angst oder Wutanfälle wirken sich auf den Körper aus.
Psychosomatische Krankheiten beginnen im Geist. Schmerzen, die den physischen Körper betreffen, sind sekundäre Erkran kungen, während die vasanas, die den Geist betreffen, geistige bzw. primäre Krankheiten genannt werden. Wenn belastende Gedanken aufhören, verschwinden oft auch die physischen Symptome.
Behandle zuerst den Geist. Geistige Gesundheit ist wichtiger als physische Gesundheit.
Die Beseitigung von Hass durch kosmische Liebe, Dienen, Freundlichkeit, Barmherzigkeit, Sympathie und Mitgefühl; die Beseitigung von Habsucht durch selbstloses Dienen, Akte der Großzügigkeit und Nächstenliebe; Beseitigung von Stolz durch Demut - das wird dir sehr dabei helfen, eine gute geistige Gesundheit zu erlangen.
Sei immer heiter. Pflege diese Tugend immer wieder. Lachen und Fröhlichkeit fördern den Blutkreislauf. Sie sind anregend. Sei mutig. Sei fröhlich. Sei freundlich. Sei tolerant. Bete. Singe. Meditiere. Mache Japa, pra,:,ayama und asanas. Du wirst wun derbare physische und geistige Gesundheit erlangen. Du wirst immer einen frohen und ausgewogenen Geist haben.
Wenn du Kontrolle über den Geist erlangt hast, hast du voll ständige Kontrolle über den Körper. Der Körper ist nur ein
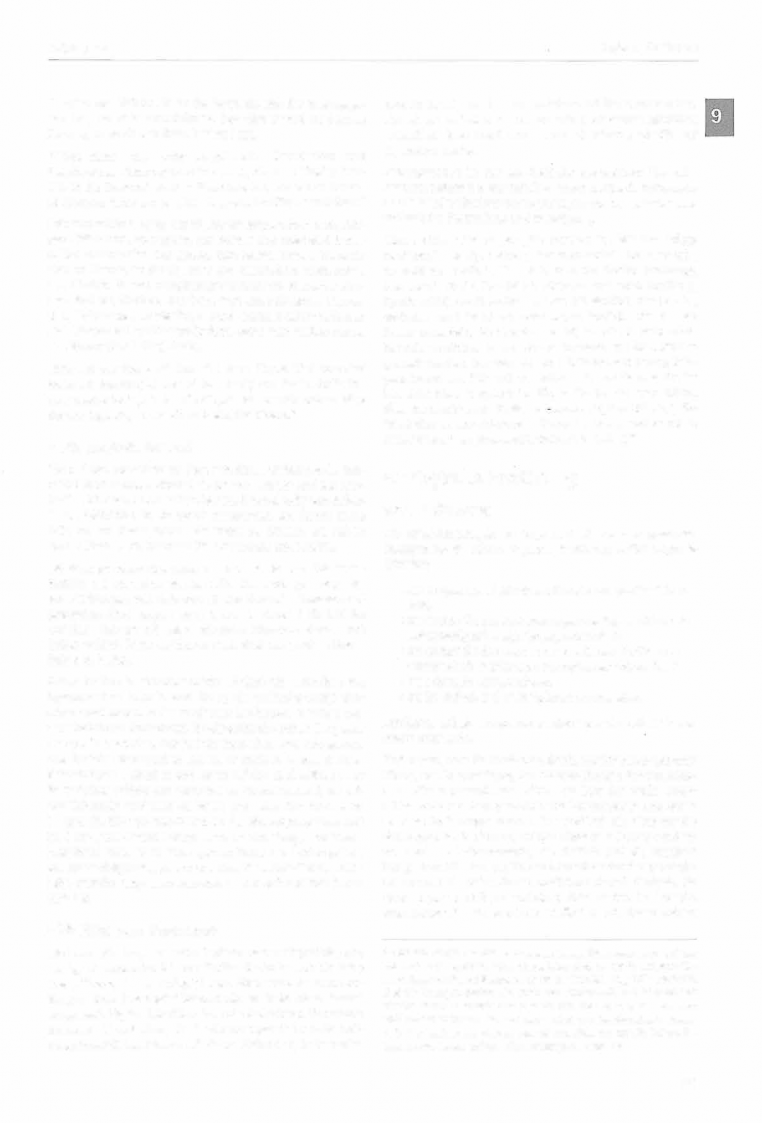
Hatha-yoga
Schatten des Geistes. Es ist die Form, die sich der Geist gege ben hat, um sich auszudrücken. Der Körper wird zu deinem Sklaven, wenn du den Geist besiegt hast.
Werde nicht zum Opfer eingebildeter Krankheiten und Beschwerden. Auch wenn du krank bist, wird das ständigeDen ken an die Krankheit sie nur stärker machen. So wie du denkst, so wirst du. Fühle immer: ,,Ich bin gesund an Körper und Geist."
Kränklichkeit ist jenseits der Ebene von körperlichen und geisti gen Hüllen nicht vorhanden. Nur Körper und Geist sind Krank heiten unterworfen. Der ätman, dein wahres inneres Selbst in deinem Herzen, ist der Speicher von Gesundheit, Kraft, Stärke und Vitalität. Er kann nicht berührt werden von Keimen, Mikro ben, Bazillen, Cholera, Eiterfluss, Pest etc. Schwäche, Depres sion, Unbehagen, Unpässlichkeit und Kränkelei haben da keinen Platz. Keime und Krankheiten flüchten, wenn man einfach nur an den ätman (das Selbst) denkt.
Während der Krankheit löse dich vom Körper. Verbinde den Geist mit buddhi (Unterscheidungskraft) und Seele. Stelle im mer wieder fest: ,,Ich bin die körperlose, krankheitslose, alles durchdringende, unsterbliche Seele, der ätman."
• Die Tragödie der Zeit
Die meisten Menschen machen sich dieses wirkungsvolle Heil mittel nicht zunutze, obwohl sie oft von Heiligen und aus spiri tuellen Büchern davon gehört haben. Sie sind völlig von äußer lichen Aktivitäten in Anspruch genommen. Sie haben keine Zeit, um an dieses innere Heilmittel zu denken. Sie haben weder Muße noch Interesse für Innenschau und Analyse.
Die Welt ist heute überflutet von verschiedensten Stärkungs mitteln. Die Menschen werden mitgerissen von groß angeleg ten Werbungen. Viel Geld wird für das Gesundheitswesen auf gewendet. Ärzte tappen noch immer in vielerlei Hinsicht im Dunklen, können oft keine wirkliche Diagnose stellen und haben vielfach keine wirklichen Heilmittel, um gewisse Krank heiten zu heilen.
Früher heilte ein einfacher vaidya (Heiler) eine Krankheit mit irgendwelchen Mitteln vom Basar, die vielleicht einige Gro schen wert waren. In der modernen Zivilisation, in Zeiten wis senschaftlichen Fortschritts, ist allopathische Behandlung sehr kostspielig geworden. Der Patient muss Blut, Urin, Exkremente und Speichel untersuchen lassen. Er muss z. B. zuerst einen Bakteriologen aufsuchen und etwas auf den T isch blättern. Der Bakteriologe schickt den Patienten zu einem Zahnarzt, um sei nen Zahnstein entfernen zu lassen und seine Parodontose zu behandeln, die, wie man meint, an der Wurzel jeder Krankheit ist. Dann muss er zum Röntgenarzt, um sich röntgen zu lassen. Manchmal muss er zu einer ganzen Reihe von Ärzten gehen, um eine richtige Diagnose zu erhalten. Er findet oft keine wirk liche Erleichterung, auch nachdem er viel Zeit und Geld inves tiert hat.
• Vedänta zum Gesundsein
Die beste Medizin, das beste Tonikum gegen körperliche und geistige Beschwerden ist der ständige Gedanke: ,,Ich bin reine Seele, ätman, der unabhängig ist von Körper und Geist und an ämaya, ohne Krankheit." Wiederhole im Geist diese Formel einige Male täglich. Meditiere über die Bedeutung. Chronische unheilbare Krankheiten, die viele hervorragende Ärzte für hoff nungslos erklärten, können mit dieser Methode geheilt werden
Yogische Ernährung
bzw. du lernst, auf eine andere Weise mit ihnen umzugehen. Das ist ein unfehlbares und unbedingt wirksames göttliches Heilmittel. Manchmal muss man allerdings geduldig auf Ergebnisse warten.
Autosuggestion ist nur ein Ausläufer des vedänta. Die Auto suggestionsformel dieser Schule -,,Durch die Gnade Gottes geht es mir in jeder Hinsicht von Tag zu Tag immer besser" - ist eine vedantische Feststellung und Bestätigung.
Manche Menschen sagen: ,,Ein Apfel am Tag hält den Doktor fern" (englisches Sprichwort). Das ist kostspielig. Ich sage: Lebe im Geist von vedänta. Das allein kann den Doktor fernhalten. Das kostet nichts. Das ist ein sicheres und unübertroffenes Spezialmittel, ein Notanker und ein Allheilmittel. Das ist eine wirksame und leicht zu erwerbende Medizin, die deinem Befehl untersteht, die dir sehr nahe ist, und die du leicht erhal ten oder erreichen kannst. Arztrechnungen und Geld können gespart werden. Das wird dir auch Selbstverwirklichung brin gen. Glaube mir. Höre auf zu zweifeln. Ich garantiere es dir! Du bist nicht dieser vergängliche Körper. Du bist die unsterbliche, alles durchdringende Seele. Tat tvam-asi (,,Das bist du"). Er freue dich im sac-cid-änanda ätman im Innern und werde in dieser Geburt ein }Tvan-mukta (lebend Befreiter).*
-
-
Yogische Ernährung
-
Einführung
Die Ernährungsregeln im Yoga sind als Teil des gesamten Yogasystems zu sehen. Yogische Ernährung erfüllt folgende Kriterien:
-
Sie ist gesund, erhöht deine Energie und geistige Wach heit.
-
Sie entspricht den Anforderungen der Yogaschriften wie
,,BhagavadgTtä", ,,Hatha(yoga)pradTpikä" etc.
-
Sie entspricht den auch in der westlichen Ernährungs wissenschaft anerkannten Prinzipien der Vollwertkost.
-
Sie schmeckt ausgezeichnet.
-
Sie ist einfach und unkompliziert zuzubereiten.
„Einfaches Leben, erhabenes Denken" war ein Leitmotiv von Swami Sivananda.
YogTs sagen, dass die Ernährung gleichzeitig für den physischen Körper, den Energiekör per, den emotionalen und den intellektu ellen Körper gesund sein sollte. Hier liegt der große Unter schied zwischen dem yogischen Ernährungssystem und vielen anderen Ernährungssystemen. Der yogT bedenkt nicht nur die Wirkungen der Ernährung auf den physischen Körper, sondern auch auf die Lebensenergie, die Gefühle und die geistigen Fähigkeiten. Für den yogT ist der Mensch weder der physische Körper noch der Geist. Für den yagTist der Mensch die Seele, die einen physischen Körper und einen Geist besitzt. Die Ursache allen Leidens ist die falsche Identifikation mit diesen beiden
-
Obgleich einige der obigen Aussagen Swami Sivanandas mehr auf das Indien der 40er und S0er Jahre zu beziehen sind, hat der Grundtenor die ses Artikels von Swami Sivananda nichts an Aktualität eingebüßt. Natürlich sind die Errungenschaften der modernen Medizin oft auch hilfreich und nützlich. Swami Sivananda war ja selbst Arzt und hat viele Menschen so wohl schulmedizinisch wie auch ayurvedisch und homöopathisch behan delt. Hier geht es ihm darum, dass wir uns nicht nur auf die äußere Be handlung verlassen und vor allem vorbeugend etwas tun.
101
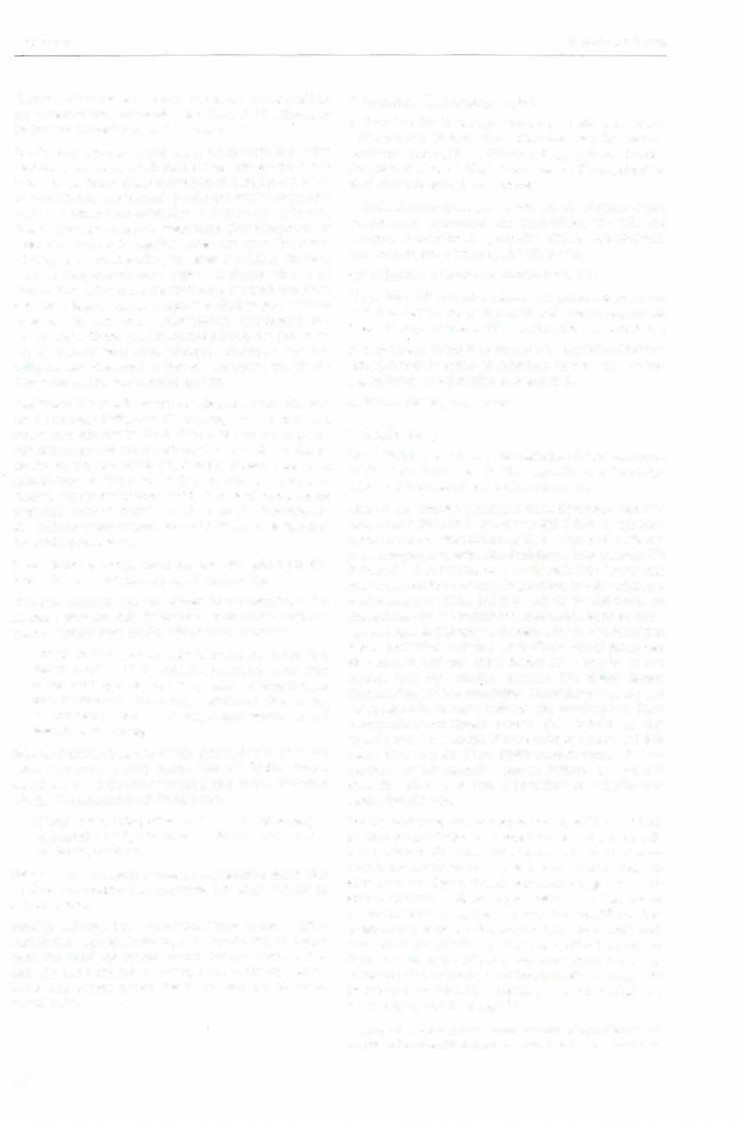
Hatha-yoga
Faktoren, die unser Bewusstsein begrenzen. In Wahr-heit ist der Mensch reines Bewusstsein, reine Seligkeit. Alles Wissen ist im Inneren. Der wahre Mensch ist unsterblich.
Das Ziel des Lebens ist es, sich dieses reinen Zustandes wieder bewusst zu werden. Deshalb stellt der yogi' alle Aspekte seines Lebens in den Dienst dieser vordringlichen Aufgabe: sein Selbst zu verwirklichen, das identisch mit der universellen Seele oder Gott ist. Er widmet sich spirituellen Disziplinen wie Meditation, äsanas (Körperstellungen), prär:,äyäma (Atemübungen). Er passt dem auch sein tägliches Leben an: seine Freizeitbe schäftigungen, die Einstellung zu seiner beruflichen Tätigkeit, seine Schlafgewohnheiten, seine Handlungsweise, sein Denken. Und natürlich ... seine Ernährung. Die Ernährung muss also der Erlangung dieses Hauptzieles dienlich sein. Deshalb muss sie den physischen, energetischen, emotionalen und intellektuellen Körper in einen Zustand bringen, der dazu ange tan ist, zu dieser Wahrheit zu gelangen. Daher muss sie gleich zeitig für den physischen Körper, die Lebensenergie, für die Emotionen und für den Verstand gut sein.
Gut für den Körper heißt gesund, nahrhaft, ohne Giftstoffe. Gut für die Energien heißt, dass die Nahrung uns neue Kraft und innere Ruhe gibt. Gut für die Gefühle heißt, dass wir sie genie ßen können, dass sie uns gut schmeckt, unseren Sinnen Befrie digung schenkt. Das schließt ein, dass kein Gedanke, auch kein . unbewusster, an Töten etc. vorhanden sein darf (also kein Fleisch). Gut für den Verstand heißt, dass die Nahrung unsere Gedanken subtiler macht, unsere Konzentrationsfähigkeit, unser Erinnerungsvermögen, unsere Intuition und die Fähigkeit zur Meditation steigert.
Diesen Kriterien zufolge haben die yogi's die Nahrung in drei Kategorien eingeteilt: tamasig, rajasig und sattwig.
Tamasige Nahrung: Das, was deinen Körper vergiftet, deine Energien lahmlegt, dein Bewusstsein grobstofflich und/oder deinen Verstand träge macht, sollte gemieden werden.
-
Beispiele: Faule, unreife oder überreife Nahrungsmittel. Fleisch, Geflügel, Fisch. Zwiebeln, Knoblauch. Alles nicht milchsauer Vergorene, auch Essig. Tabak, Alkohol, Drogen, viele Medikamente. Konserven, T iefkühlkost. Was zu viel gekocht wurde. Was zu oft aufgewärmt wurde. Zu viel essen ist auch tamasig.
Rajasige Nahrung: Das, was deinen Körper, deinen Geist und deine Emotionen unruhig macht. Was die Leidenschaften anregt und den Geist schwer kontrollierbar macht. Reduziere rajasige Nahrungsmittel auf ein Minimum.
-
Beispiele: Eier, Kaffee, schwarzer Tee, scharfe Gewürze (Ca yennepfeffer, Chilli), alles Saure und Bittere, weißer Zucker, Weißmehl, Weißbrot.
Rajasig ist auch, zu hastig zu essen, ungenügend zu kauen oder zu viele verschiedene Nahrungsmittel bei einer Mahlzeit zu sich zu nehmen.
Sattwige Nahrung: Das, was deinem Körper wertvolle Nähr stoffe bringt, leicht verdaulich ist, neue Energie gibt und deinen Geist klar, subtil und friedvoll macht. Sattwige Nahrung lässt dich alle deine physischen, geistigen und spirituellen Fähig keiten und Talente nutzen. Die ideale Nahrung für jeden Yogaübenden.
102
Yogische Ernährung
• Sattwige Nahrungsgruppen
-
Getreide: Alle Vollkorngetreideprodukte wie Vollkornbrot, Vollkornnudeln. Vollreis, Hirse, Vollweizengries, Buchweizen, Amaranth, Quinoa, Dinkel, Grünkern, Roggen, Gerste, Tapioka. Kartoffeln sind zwar biologisch Gemüse, ernährungsphysiolo gisch aber wie Getreide zu bewerten.
-
Hülsenfrüchte: Grüne Linsen, rote Linsen, schwarze Linsen, Mungbohnen, Sojabohnen und Sojaprodukte wie Tofu und Tempeh, Ackerbohnen, geschälte Linsen, Azukibohnen, Kichererbsen, grüne Erbsen, gelbe Erbsen etc.
Am einfachsten zu verdauen: Mungbohnen, Tofu.
Die meisten Hülsenfrüchte müssen gut gekocht werden, um einfach verdaut werden zu können: Sie sollten weich sein, und die äußere Haut geplatzt sein. Hilfe: Am Abend vorher einweichen.
-
Gemüse und Salate: Gekocht und roh. Ausreichend Rohkost nötig (am meisten prär:,a). Verschiedene Sorten essen, um gro ßes Spektrum an Nährstoffen zu bekommen.
-
Obst: Je frischer, umso besser.
-
Empfehlung
Nimm täglich etwas aus allen vier sattwigen Nahrungsgruppen zu dir. Finde heraus, welche Nahrungsmittel und Nahrungs mittelkombinationen dir am besten bekommen.
Wenn du nur sattwige Nahrungsmittel zu dir nimmst, wird dein natürlicher Instinkt dir helfen, die für dich richtigen Nahrungs mittel zu finden. Trinke täglich 1,5 bis 3 1 Wasser oder Kräuter tee. Die yogi's geben keine allzu detaillierten Empfehlungen (XX
% Getreide, XX% Früchte, XX% Eiweiß etc.). Kein Organis-mus gleicht dem anderen, er unterliegt saisonalen Schwankungen, Veränderungen im Klima und in der Art der Beschäftigung, im Biorhythmus etc. Die Bedürfnisse ändern sich. Wenn du tama sige und rajasige Nahrung vermeidest, wirst du den Kontakt zu deinen natürlichen Instinkten wiederfinden, die dir sagen, was dir bekommt und was nicht. Mache den Versuch: Iss drei Monate lang nur sattwige Nahrung, übe täglich äsanas (Körperstellungen) und prär:,äyäma (Atemübun-gen). Jede Lust auf rajasige oder tamasige Nahrung wird verschwinden. Deine Geschmacksempfindungen werden sich, parallel zu den Anforderungen des Lebens, immer wieder verändern und dich besser leiten als der beste Ernährungsfach-mann. Dies gilt natürlich nur für gesunde Personen. Jemand, der ernstlich krank ist, sollte einen Arzt, Heilpraktiker oder Ernährungs berater konsultieren.
Die Yogaernährung, die dazu entwickelt ist, auf dem spirituel len Weg die Meditation zu unterstützen, ist optimal auch für den modernen Menschen. Selbst wenn dein Hauptinteresse nicht in der Gottverwirklichung liegt, wirst du schon bald die Wirkungen der Yogaernährung erkennen: ein gesunder und widerstandsfähiger Körper, sogar Heilung einzelner Krank heiten und Vorbeugung vieler anderer (lies dazu Bücher über Vegetarismus, wenn du dich genauer informieren möchtest), eine gesteigerte Vitalität, ein reiner und subtiler Verstand, ein Geist, der alle seine Möglichkeiten ausschöpfen kann. Und schließlich wirst du den besten Führer in Ernährungsfragen bei dir haben: deine natürlichen Instinkte, die es dir ermöglichen, das zu mögen, was für dich gut ist.
(Anm.: In früheren Auflagen dieses Buches wurden Milchprodukte als fünf te sattwige Nahrungsmittelkategorie bezeichnet. In den Yogaschriften von
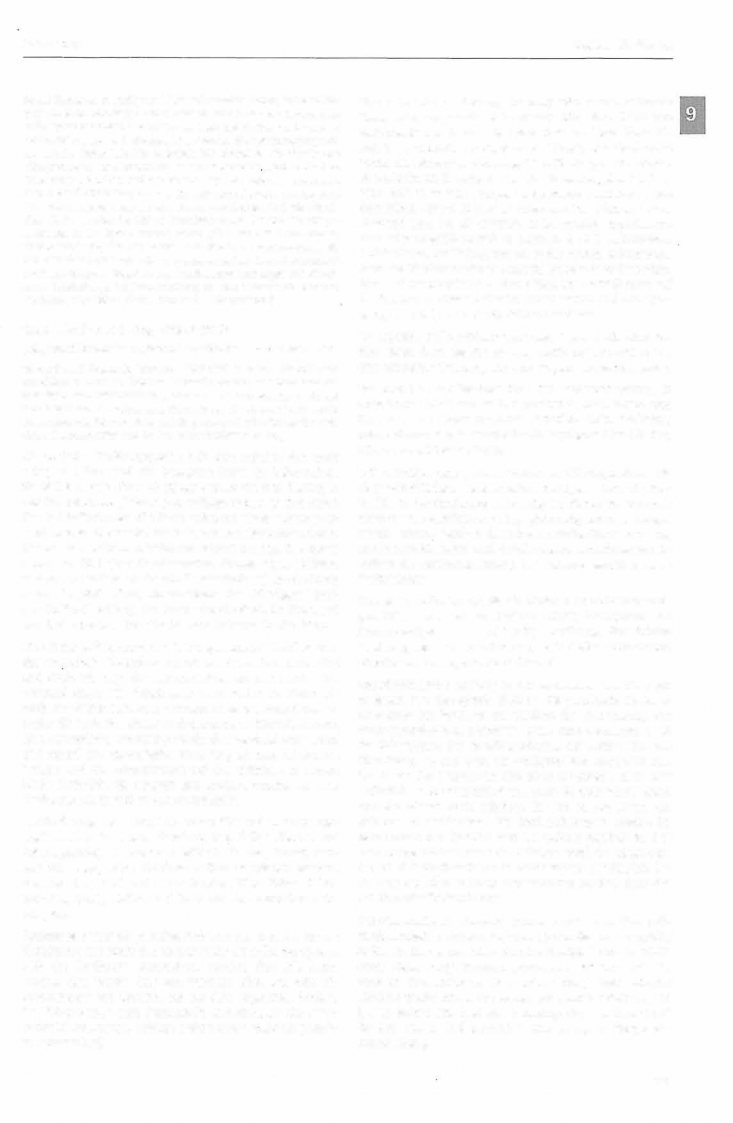
Hatha-yoga
Swami Sivananda ist häufig von Milch als besonders sattwig und nutzbrin gend die Rede. Allerdings wurden Kühe im alten Indien mit Ehrerbietung und Respekt behandelt. Kühe galten als heilig und durften von Menschen nicht getötet werden. Heutzutage ist im Westen die Milcherzeugung sehr eng mit der Fleischindustrie verknüpft. Mit ahif!lsti ist ein Verzehr von Milchprodukten aus Massentierhaltung nicht vereinbar Auch in der Öko tierhaltung wird Kühen nach ein bis zwei Tagen das Kalb weggenommen. Auch in der Ökotierhaltung werden Kühe, die normalerweise zwanzig Jahre leben können, nach sechs bis zehn Jahren geschlachtet. Und alle männli chen Rinder werden im frühen Erwachsenenalter für den Verzehr ge schlachtet. In den letzten zwanzig Jahren gab es eine Fülle von Studien, welche nahelegen, dass ein übermäßiger Verzehr an Milchprodukten für den Menschen ungesund sind. Unter anderem stehen Krebs, Herzkreislauf probleme, Rheuma, Allergien, alle Autoimmunerkrankungen und chroni schen Entzündungen im Zusammenhang mit dem Verzehr von tierischen Produkten, also Fleisch, Fisch, Eiern und Milchprodukten.)
-
-
-
-
Die Ernährung eines yogT
(vgl. ,,Swami Sivanandas Inspiration & Weisheit für Menschen von heute")
(Anm.: Swami Sivananda lebte von 1887-1963 in Indien. Obwohl seine Ratschläge in manchen Teilen auf spezielle indische Gegebenheiten der damaligen Zeit ausgerichtet sind, können sie dir doch Anleitung sein und dich inspirieren. Der betreffende Abschnitt soll dir zeigen, wie ein großer Yogameister die Nahrung sieht, und dir gerade am Beginn bei der Aus-wahl deiner Nahrungsmittel und der Art deiner Ernährung helfen.)
Die yogische Ernährungsweise hilft dem Schüler, den Geist ruhig zu halten und die bewegten Sinne zu beherrschen. Sie hilft ihm, rajas (Erregtheit) aus seinem Geist zu beseitigen und ihn mit sattva (Reinheit) zu erfüllen, sodass er stets bereit für die Meditation ist. Alle Sinne sollen mit reiner Nahrung ver sorgt werden. Nur so wird der Geist rein und einpünktig werden. Nur so kann Selbstverwirklichung erlangt werden. Die Augen sollen das Bild einer Repräsentation Gottes, eines Heiligen, Weisen und andere erhebende Gegenstände sehen; die Ohren sollen die „GTtä" hören, die upani�ads, das „Rämäyar:ia" (indi sche heilige Schriften), den Koran oder die Bibel. Die Zunge soll von Gott sprechen. Das alles ist reine Nahrung für die Sinne.
Die Art der aufgenommenen Nahrung bestimmt den Charakter des Menschen. Fleischkost macht den Menschen unsensibel und grob. Sie regt die Leidenschaften an und macht den Verstand träge. Ein Fleischesser kann weder ein Philosoph noch ein Weiser sein. Sein Verstand ist derart dumpf, dass er weder die Probleme dieser noch der anderen Welt lösen kann. Eine vegetarische Ernährung macht den Verstand aktiv, subtil und scharf. Die vegetarische Ernährung ist dem erhabenen Denken und der Konzentration auf das Göttliche in hohem Maße förderlich. Sie schenkt eine größere Vitalität als eine Ernährung mit tierischen Nahrungsmitteln.
Die Ernährung muss sorgfältig ausgewählt und zusammenge stellt werden. Zu scharfe Gewürze, Tee, Kaffee, Alkohol und Nahrungsmittel, die besonders stärkehaltig sind, Zucker, Fette und alle anregenden Getränke sollten vermieden werden. Frisches Obst, Salat und rohes Gemüse, Käse, Nüsse, Milch, Getreide, Honig, Datteln und Mandeln sind besonders nutz bringend.
Rohkost ist besser als gekochte Nahrung. Sie ist besser für die Blutbildung und stärkt den Körper mehr; sie sollte wenigstens 80% der Ernährung ausmachen. Ernähre dich alle sechs Monate eine Woche lang von frischem Obst. Das wird die Ausscheidung von Unreinheiten aus dem Organismus fördern. Die Nahrung muss auch Ballaststoffe enthalten, um die Darm peristaltik anzuregen. Rohkost enthält davon mehr als gekoch te Lebensmittel.
Yogische Ernährung
Eine schlechte Verdauung, hervorgerufen durch schweres Essen oder ungesunde Reiznahrung, wird eine Reihe von Reflexreaktionen in den Nervenzentren bewirken. Kaue die Nahrung gründlich. Iss nur, wenn du hungrig bist. Heutzutage halten die Menschen Gaumengelüste für Hunger. Der Hunger ist vielleicht ein Vergnügen, das sie nie kennengelernt haben. Man kann wirklichen Hunger ebensowenig beschreiben wie Gott selbst. Um ihn zu kennen, muss man ihn erfahren haben. Niemand kann ihn dir erklären. Es ist unnötig, Appetithäpp chen oder Aperitifs zu sich zu nehmen, die wie Lokomotiven funktionieren, um Nahrungsmittel in den Magen zu befördern, denn das Verdauungsfeuer (Appetit) braucht derartiges nicht. Dieses Verdauungsfeuer ist Gott selbst. Der Mensch muss auf das Erscheinen dieses Gottes im Innern warten und Ihm also - einzig und allein - ein wenig Nahrung anbieten.
Iss langsam. Trinke reichlich nach dem Essen. Trinke nicht vor dem Essen, denn das löst die Magensäfte auf und ruft zudem eine schlechte Verdauung und viele Magenbeschwerden hervor.
Der Mund ist der Wächter über das Verdauungssystem. Er muss immer frisch und sauber gehalten werden, indem man ihn nach dem Essen mehrmals gründlich spült. Zahlreiche Keime können sich in einem schlecht gepflegten Mund bilden. Zähneputzen ist sehr wichtig.
Wir benötigen eine gewisse Vielfalt an Nahrungsmitteln, die
-
über verschiedene Eigenschaften verfügen. Obwohl diese Vielfalt in der Ernährung notwendig ist, dürfen wir dennoch nicht zu viele verschiedene Dinge gleichzeitig essen. Je weniger wir die Nahrung mischen, desto besser. Mutter Natur sorgt klug und in ausreichendem Maß für alle unsere Bedürfnisse vor. Sie variiert die Zusammensetzung der Nahrung gemäß unseren Bedürfnissen.
Eine einfache Ernährung, die ein Minimum an nicht notwendi gen Nährstoffen und an Abfällen enthält, beansprucht die Nieren weniger als eine reichhaltige Ernährung. Eine richtige Ernährung verbessert das Gewebe, da sie die Ansammlung von Rückständen im Organismus verhindert.
Appetitanregende Nahrung zu sich zu nehmen und diese gut zu kauen, regt den Speichelfluss an. Die gesteigerte Speichel produktion hat ihrerseits die Tendenz, die Absonderung von Verdauungssäften. zu aktivieren. Diese Säfte wiederum regen die Schleimhaut des Zwölffingerdarms, des ersten Teils des Dünndarms, an und lösen die Produktion von Hormonen aus. Das Kauen der Nahrung ist also überaus nützlich. Es ist sehr gefährlich, es zu vernachlässigen. Wenn du nicht richtig kaust, wird der Magen zuviel arbeiten. Es wird an ihm liegen, die Nahrung zu zerkleinern. Die Stärkesubstanzen werden im Mund durch den Speichel verdaut, welcher alkalisch ist. Das kann nur geschehen, wenn die Nahrung sorgfältig gekaut wor den ist. Vollständiges Kauen ist daher absolut unerlässlich. Die Nahrung soll niemals hastig aufgenommen werden, denn das ruft Unverdaulichkeit hervor.
Das Geheimnis, die Nahrung optimal zu nutzen und ihre gute Verdaulichkeit zu sichern, liegt darin, jeden Bissen so sorgfältig zu kauen, dass er die Kehle wie eine Flüssigkeit hinunterfließt. Gutes Kauen beugt Verdauungsproblemen vor und heilt sie. Ganz im Unterschied zu einer großen Menge halb gekauter Nahrung sättigt eine kleine Menge gut gekauter Nahrung viel besser, sichert eine bessere Verdauung, eine leichtere Arbeit für den Magen und produziert eine geringere Menge von Ausscheidung.
103
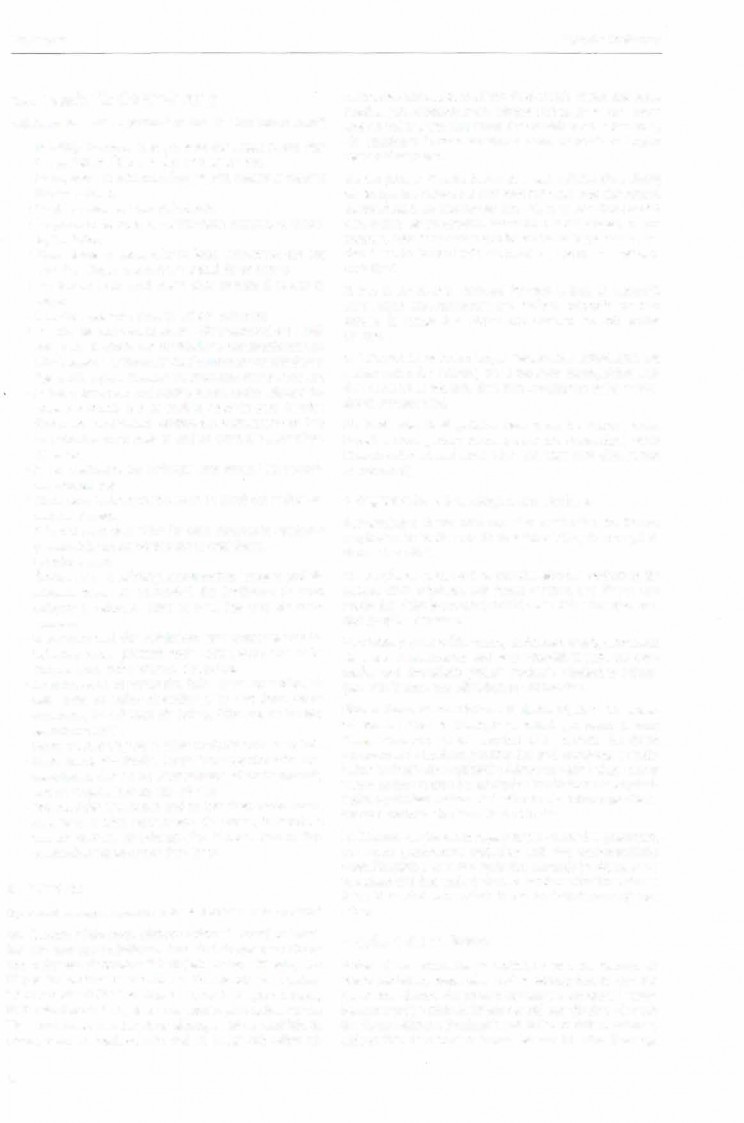
Hatha-yoga
-
-
-
Regeln für die Ernährung
(vgl. ,,Swami Sivanandas Inspiration & Weisheit für Menschen von heute")
, Iss mäßig. Steh vom Tisch auf, wenn der Magen zu drei Vier teln gefüllt ist. überlade deinen Magen nicht.
, Iss nur, wenn du tatsächlich hungrig bist. Misstraue falschen Hungergefühlen.
-
Iss nichts zwischen den Mahlzeiten.
-
Iss gesunde Nahrung, in vernünftigen Mengen, zu festge legten Zeiten.
, Nimm keine zu heiße oder zu kalte Nahrung zu dir: Das
reizt den Magen und ruft Unverdaulichkeit hervor.
, Iss nichts, was du nicht magst, aber iss nicht alles, was du magst.
, Reduziere gekochte Speisen auf ein Minimum.
, nur vier bis fünf verschiedene Nahrungsmittel pro Mahl zeit zu dir. Verzichte auf zu vielfältige Kombinationen und Mischungen. Die Verdauungssäfte können verschiedenar tige und komplexe Zusammensetzungen schwer verdauen.
, Iss keine Konserven und ranzige Butter. Koche Reis und Ge müse am Dunst. langes Kochen entzieht dem Gemüse Geschmack und Gehalt. Schütte das Kochwasser von Reis und Gemüse nicht weg; es enthält wertvolle Mineralien. Trinke es.
, Iss nur zweimal täglich zu festgelegten Zeiten. Wärme Spei sen niemals auf.
, Nimm dann Nahrung zu dir, wenn du durch das rechte Na senloch atmest.
-
Setz dich nach dem Essen für zehn Minuten in vajräsana
(Fersensitz), um die Verdauung zu erleichtern.
, Iss schweigend.
, Ändere deine Ernährungsgewohnheiten langsam und all mählich. Wenn ein Bestandteil der Ernährung dir nicht entspricht, reduziere seine Menge. Das wird dir mehr zusagen.
, Unternimm nach den Mahlzeiten keine anstrengenden Tä tigkeiten, weder physisch noch geistig. Ruhe eine halbe Stunde. laufe nicht sofort zu einem Zug.
, Iss nicht, wenn du zornig bist. Ruhe einen Augenblick, bis dein Geist die Ruhe wiederfindet. Iss erst dann. Wenn man zornig ist, scheiden die Drüsen Gifte aus, die ins Blut geschickt werden.
-
Nimm die Nahrung wie Medizin zu dir. Sei nicht naschhaft.
-
Faste einmal pro Woche. Durch Fasten werden Gifte aus geschieden, der innere Mechanismus wiederhergestellt, und die Organe können sich erholen.
-
Während der Mahlzeiten und zu jeder Zeit denke daran, dass Gott in allen Nahrungsmitteln wohnt, in Früchten und im Gemüse. Er schenkt allen Nutzen. Bete zu Ihm unmittelbar vor und nach dem Essen.
-
-
Fasten
-
-
(vgl. ,,Swami Sivanandas Inspiration & Weisheit für Menschen von heute")
Die allererste Pflicht ist es, sädhana {spirituelle Praxis) zu betrei ben, um Gott zu verwirklichen. Dazu sind ein gesunder Körper und Geist·von allergrößter Wichtigkeit. Fasten hilft sehr, den Körper im Zustand vollkommener Gesundheit zu erhalten. Wenn das leiseste Zeichen einer Krankheit im Körper erscheint, ist das ein Hinweis dafür, einen oder zwei Tage zu fasten. Für die Tiere, welche nur von der Natur abhängen, ist es natürlich, zu fasten, ·wenn sie krank werden, und sie heilen sich selbst mit
104
Yogische Ernährung
natürlichen Mitteln, Sonnenlicht, frischer Luft, Fasten und Ruhe. Erkältungen, Kopfschmerzen, leichtes Fieber, ein wenig Husten und ein voller Darm sind einige der Anzeichen einer Krankheit, die ernsthafte Formen annehmen kann, wenn sie zu Beginn vernachlässigt wird.
Bei den jetzigen Gegebenheiten ist es sehr schwer, ohne Übung ein komplettes Fasten, bei dem man nur Wasser zu sich nimmt, durchzuhalten. So müssen wir den goldenen Mittelweg verfol gen, indem wir Fruchtsäfte, vermischt mit viel Wasser, zu uns nehmen. Keine feste Nahrung sollte an diesem Tag gegessen wer den. Diese Art Fasten ist für die Erhaltung der Gesundheit sehr vorteilhaft.
Fasten ist ein rasches Heilmittel für viele Leiden. Es verschafft dem Magen eine Ruhepause und entfernt Giftstoffe aus dem Körper. Es reinigt den Körper und versorgt ihn mit großer Energie.
Viel Sorgfalt ist während langer Fastenzeiten erforderlich. Sie sollten unter der Führung eines Experten durchgeführt wer den, sonst ist es möglich, dass dem Organismus mehr gescha det als genützt wird.
Ein Zwei- oder Dreitagefasten kann ohne die Führung eines Experten durchgeführt werden, aber die Anwendung eines Einlaufs während und einen oder zwei Tage nach dem Fasten ist notwendig.
-
Segensreiche Wirkungen des Fastens
Gelegentliches Fasten wird von allen spirituellen Traditionen empfohlen. Es ist die erste Stufe auf der Leiter, die zum göttli chen Leben führt.
Ein komplettes Fasten von 24 Stunden gibt den Gedärmen die Chance einer Erholung. Das Fasten verjüngt den Körper und macht den Geist konzentrationsfähig. Alle deine Energien wer den sorgfältig erneuert.
Eine totale physische Überholung findet statt. Geistig entwickelst du mehr Konzentration und Widerstandsfähigkeit. Du wirst stärker und entwickelst größere Fähigkeit, physischen Störun gen, Krankheiten und Müdigkeit zu widerstehen.
Obwohl Fasten ein wunderbares Heilmittel ist, darf nicht erwar tet werden, dass es Unmögliches vollbringen kann. Es kann Mangelerkrankungen wie Skorbut oder Rachitis, die durch unzureichende Ernährung entstanden sind, angeborene Krank heiten und wirkliche organische Störungen nicht heilen. langes Fasten ist nicht ratsam bei zehrenden Krankheiten wie Schwind sucht, perniziöser Anämie und während der Schwangerschaft. Fasten vermittelt eine klare Einsicht in alles.
Ein Mensch, der Fasten in regelmäßigen Abständen praktiziert, hat scharf geschnittene Gedanken und eine unübertreffliche Vorstellungsgabe. Sein Ego steht ihm nirgends im Wege. Seine Gedanken sind fest und erhaben. Er handelt schnell und sicher. Seine Ideen sind Lichtstrahlen in der Dunkelheit menschlichen Lebens.
-
Heilung durch Fasten
Fasten ist ein natürliches Heilmittel. Es kann die Gesundheit wiederherstellen, wenn alles andere versagt hat. Es gibt der Natur eine Chance, das System zu reinigen. Ein totales Fasten bedeutet völlige Enthaltsamkeit sowohl von flüssiger als auch von fester Nahrung. Fruchtsaft und Kaffee zu sich zu nehmen, widerspricht dem totalen Fasten. Wasser ist keine Nahrung.
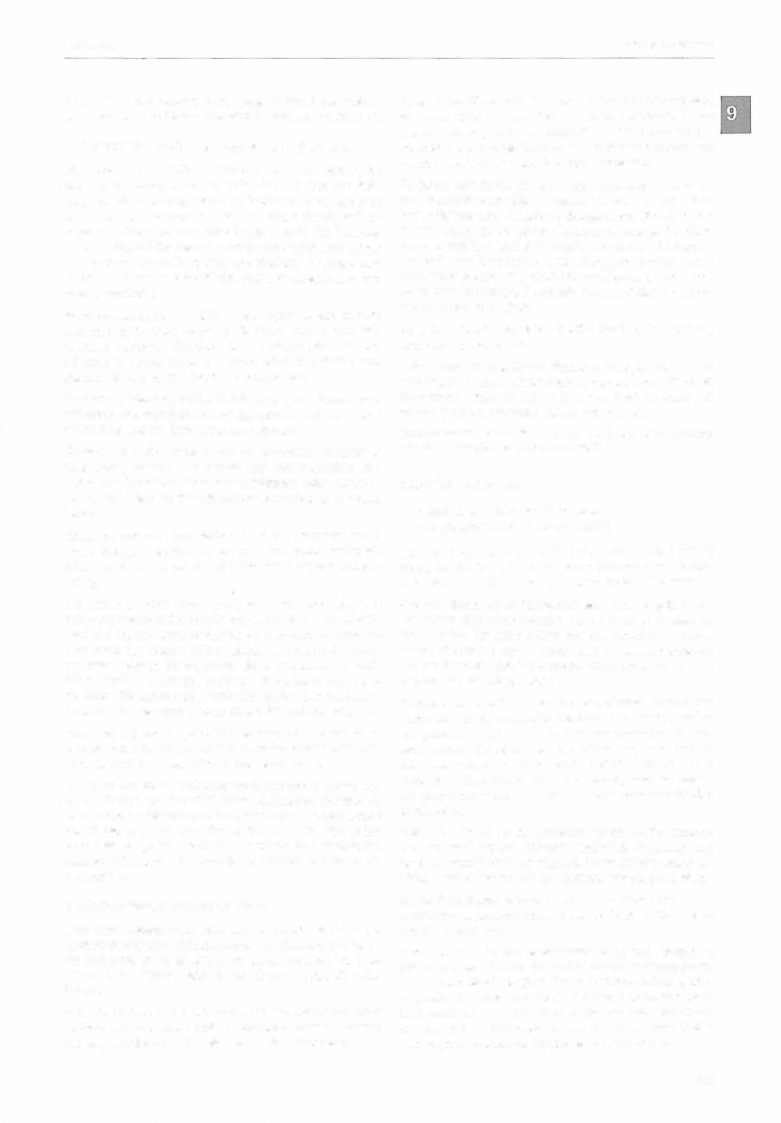
Hatha-yoga
Es stimuliert den Appetit nicht. Trinke während des Fastens große Mengen von Wasser. Das wird die Schwäche vertreiben.
-
Unterschied zwischen Fasten und Hungern
Man fastet aus religiösen Gründen oder um körperliche Gesundheit wiederzuerlangen. Es ist das Aufgeben von Nah rung, um Gifte und angesammelte Toxine aus dem Körper zu entfernen und der Natur zu erlauben, ihre heilende Kraft zu entfalten. Man sollte aber nicht hungern, denn das bedeutet Leiden. Während des Fastens wirst du von Krankheiten befreit und gewinnst Gesundheit, Kraft und Vitalität. Der prä0a wird durch das Fasten vereinheitlicht, und der Lebensfunke wird wieder entzündet.
Wenn du deinen Magen mit Essen vollstopfst, obwohl du nicht hungrig bist, handelst du gegen die Natur, und sie wird dich ernsthaft bestrafen. überlade deinen Magen nicht. Sei be scheiden in deiner Ernährung. Dann wirst du glücklich und gesund sein und spirituellen Fortschritt machen.
Iss niemals, bevor du nicht wirklich hungrig bist. Ganzer oder teilweiser Appetitverlust ist ein Warnzeichen, mit dem Essen aufzuhören und mit d�m Fasten zu beginnen.
Übelkeit oder die Tendenz, sich zu erbrechen, allgemeines Unwohlsein, Durchfall, Fiebrigkeit und Appetitlosigkeit sind einige der Anzeichen einer beeinträchtigten oder gestörten Verdauung. Wenn du diese Symptome bemerkst, ist es Zeit zu fasten.
Wenn du während des Fastens Brechreiz verspürst, trinke große Mengen von Wasser, eventuell mit etwas Fruchtsaft. Wenn das Erbrechen anhält, brich das Fasten langsam und vor sichtig.
Das Fasten ist nicht fortzusetzen, wenn der Herzschlag sich sehr verlangsamt und man sehr schwach wird. Erlaube dir wäh rend des Fastens keine Gedanken an Nahrung. Du wirst die Segnungen des Fastens nicht erleben, wenn dein Geist immer am Essen hängen bleibt. Richte deine Gedanken auf Gott. Pflege erhabene, göttliche Gedanken. Faste, bis du dich hung rig fühlst. Die Zunge wird gewöhnlich sauber, der Geschmack im Mund und der Atem werden angenehm und der Teint klar.
Fasten kann jederzeit gebrochen werden. Aber wenn du es brichst, bevor der Hunger natürlicherweise wieder auftaucht, wirst du nicht den maximalen Nutzen daraus ziehen.
Nachdem das Fasten ordnungsgemäß gebrochen wurde und auch während der darauffolgenden Aufbauzeit, könntest du einen Hang zur Verstopfung bemerken, aber das wird später vollständig vergehen. Aus diesem Grunde sollte eine strikte Fruchtdiät einige Tage nach dem Fastenbrechen eingehalten werden. Früchte werden sehr leicht verdaut und regen die Peristaltik an.
-
Methodisches Fastenbrechen
Nach dem Fastenbrechen wird dich ein abnormes Verlangen nach reichlicher und nach allen Arten von Nahrung überfallen. Sei vorsichtig. Wenn du diesen Impulsen nachgibst, wird das ernste Folgen haben. Halte diesen abnormen Appetit unter Kontrolle.
Wird das Fasten nicht richtig gebrochen und der Magen durch zu viele und zu schwere Speisen überladen, wirst du schwere Blähungen bekommen. Um sie loszuwerden, faste wieder.
Yogische Ernährung
Nimm heiße Bäder und einen oder mehrere Einläufe täglich. Wenn die Blähungen verschwinden, brich das Fasten. Dieses Mal tue das langsamer und sorgfältiger. Nach langen Fasten perioden mache einige Safttage, bis die Verdauungsprobleme behoben sind und du normalen Hunger verspürst.
Du kannst dein Fasten mit ein wenig Gemüsesuppe, verdünn tem Fruchtsaft oder Kokosnusswasser brechen. Im Falle eines langen Fastens halte danach die obengenannte Diät ein Viertel der Fastenzeit ein. Du kannst allmählich die Menge der Mahl zeiten vergrößern und ihre Anzahl reduzieren. Die Verdau ungskraft wird durch langes Fasten sehr geschwächt; du kannst nicht plötzlich schwere Nahrung zu dir nehmen. Du musst der Natur ihren Lauf lassen. Sie braucht ihre eigene Zeit, um sich zu erneuern und zu beleben.
Du solltest dein Fasten nicht mit Milch brechen. Du kannst sie nach und nach zu dir nehmen.
Jede Art von Nahrung kann in dünner, verflüssigter Form und in sehr kleinen Mengen eingenommen werden. Nach 21 bis 40 Fastentagen trinke ein halbes Glas Fruchtsaft, verdünnt mit Wasser. Trinke es am ersten Tag drei- bis vier Mal.
(Anm.: Fastenkurse, welche länger als fünf Tage dauern, sollten mit einem Arzt oder Heilpraktiker abgesprochen werden!)
9.2.s Vegetarismus
-
Sind wir von Natur aus Fleischesser?
-
Ist „Vegetarismus" ein neuer Begriff?
„Und Gott sprach: Seht da, ich habe euch gegeben allerlei Kraut, das sich besamt, auf der ganzen Erde und allerlei frucht bare Bäume, die sich besamen, zu eurer Speise ... "11. Mose 1:29(
Wie wir wissen, ist „Vegetarismus" kein neuer Begriff. Er hat seit Beginn aller Zeiten existiert. Viele Nationen, vor allem im Osten, haben für Jahrhunderte von vegetarischer Ernährung gelebt. Die großen Lehrer verschiedener Religionen sprachen von der Gewaltsamkeit jedes Tötens. Wann und warum began nen wir also, Fleisch zu essen?
Während der Eiszeit und anderer klimatischer Katastrophen wurde die Hauptessensquelle des Menschen zerstört, und er war gezwungen, sich nach einer anderen umzusehen. Er hatte keine andere Überlebenschance, als Fleisch zu essen. Danach blieb dieser Brauch erhalten, auch als die Not die Menschen nicht mehr dazu zwang. Es ist interessant, dass die Essens gebräuche der Völker verschiedene, sehr prägnante Stadien durchlaufen.
Wenn eine Nation um ihr Wachstum kämpft und ihre Einwoh ner arm sind, ist die Nahrung gewöhnlich genügsam und besteht hauptsächlich aus Pflanzen. Wenn der Wohlstand an steigt, steigt der Verbrauch von tierischer Nahrung und Wein.
Die fünf wichtigsten Gründe vegetarisch zu leben sind:
1. ethische, 2. gesundheitliche, 3. ökonomische, 4. ökologische und 5. energetische.
Man unterscheidet vier verschiedene Arten von Vegetariern (Menschen die beim Verzehr, auf Fleisch und Fisch verzichten):
1. Ovo-Lakto-Vegetarier (inkl. Eier und Milchprodukte), 2. Ova Vegetarier (inkl. Eier, ohne Milchprodukte), 3. Lakto-Vegetarier (inkl. Milchprodukte, ohne Eier). 4. Veganer (reine Vegetarier, die aus philosophischen/ethischen Gründen ausschließlich Nahrung rein pflanzlichen Ursprungs zu sich nehmen).
105
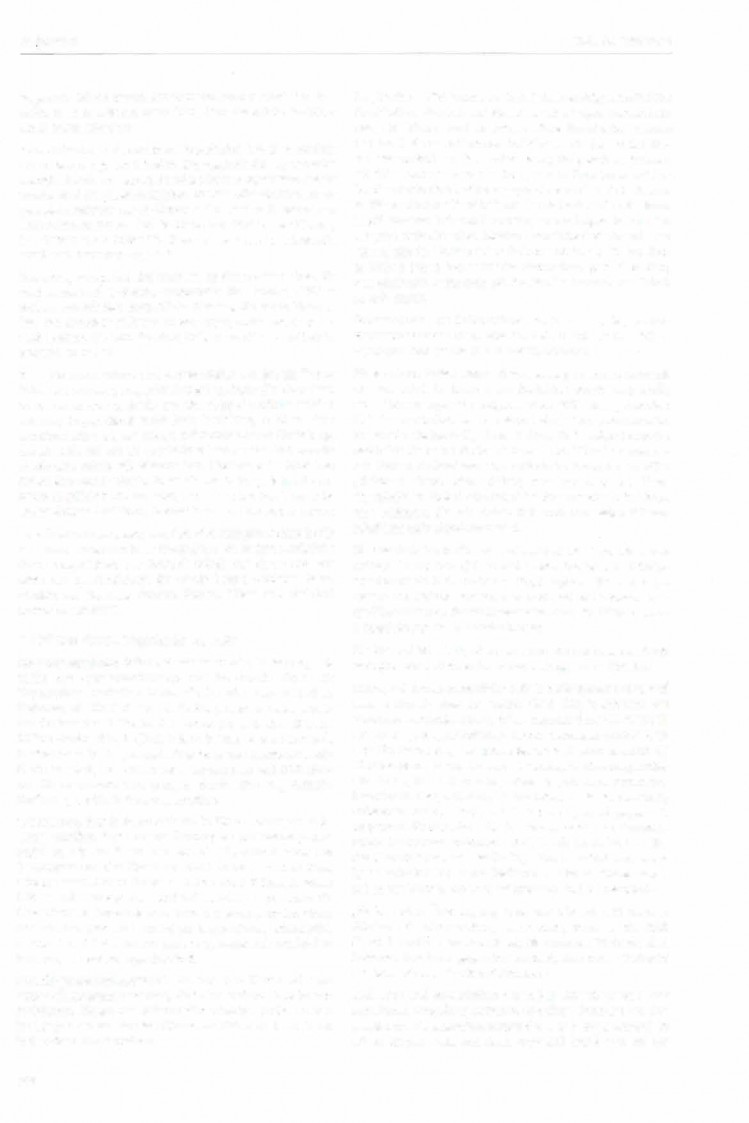
Hatha-yoga
Vegetarier achten darauf, den Gebrauch anderer tierischer Pro dukte wie z. B. Leder zu vermeiden, denn das würde das Töten eines Tieres erfordern.
Vom Anbeginn aufgezeichneter Geschichte haben Menschen aus diesen und jenen Gründen eine vegetarische Lebensweise befolgt. Obwohl oft aus einer Notlage heraus vegetarisch gelebt wurde, sind die gesundheitlichen Vorteile offensichtlich, wenn genügend Nahrung zur Verfügung steht. Land zu bebauen, um Korn reifen zu lassen, das die Menschen direkt essen können, ist wirksamer, als Futter für Tiere anzubauen, das seinerseits nur Secondhandnahrung wird.
Das heutige wiederbelebte Interesse an dieser Art zu leben, die wachsende Notwendigkeit, vegetarische über normale Diät zu stellen, ihre offenbar vortreffliche Eig·nung, die ganze Mensch heit mit sattwiger Nahrung zu versorgen, sollte uns dazu Ur sache geben, die Vorteile einer fleischlosen Kost ernsthaft in Betracht zu ziehen.
Viele Menschen würden bei der Vorstellung, selbst ein Tier zu töten und zu essen, magenkrank werden. Sogar die Menschen, denen ein solcher Gedanke und eine solche Handlung gefallen könnten, folgen dabei nicht ihren Instinkten, sondern einer konditionierten, bei der Geburt nicht vorhandenen Einstellung, die im laufe des Lebens sorgfältig gelernt wurde. Andererseits macht eine Schale mit Weintrauben, Kirschen oder Pfirsichen jedem den Mund wässrig. Sogar die Vorstellung, sie frisch vom Baum zu pflücken und zu essen, ruft keine unerfreulichen oder widerwärtigen Ansichten, Assoziationen und Gedanken hervor.
Jede Kreatur muss essen, und ihre Verdauungsmaschine ist für das ihrem Leben und ihrer Gesundheit am besten zuträgliche Essen ausgestattet. Der Mensch würde gut daran tun, vor allem auf die Ernährung, die er am besten verdauen kann, nämlich auf Gemüse, Früchte, Samen, Nüsse und vielleicht Körner zu vertrauen.
-
-
-
-
-
-
-
-
Gründe dafür, Vegetarier zu sein
Einer der wichtigsten Gründe, Vegetarier zu sein, ist das steigende Risiko von Arterienverkalkung und Herzinfarkt durch die Verwendung tierischer Fette. Cholesterin- und fettreiche Nahrung, wie die tierische, ist die Hauptursache eines erhöh ten Cholesteringehaltes im Blut. Heute gibt es in den USA eine Million Herzinfarkte, die jährlich 600 000 Tote fordern. Es wurde in einer Ausgabe des ,)ournal of the American Medical Associa tion''. dargelegt, dass 90% unserer T hrombosen und 97% unse rer Herzkranzgefäßverengungen durch eine vegetarische Ernährung verhindert werden könnten.
Wusstest du, dass in einem kleinen ein Kilo schweren, auf Holz kohle gegrillten Steak so viel Benzopyren (krebserzeugender Stoff) ist wie im Rauch von sechzig Zigaretten? Aber das Benzopyren von den Zigaretten wird inhaliert, das vom Steak wird gegessen. Macht das einen Unterschied? Sicherlich. Wenn Mäuse mit Benzopyren gefüttert werden, entwickeln sie Magentumore, Leukämie oder Blut- und Knochenkrebs. Wenn das Fett des Fleisches in zu hohen Temperaturen erhitzt wird, so wie das oft beim Kochen geschieht, bildet sich Methylcho lanthren, ein krebserregender Stoff.
Schädlingsbekämpfungsmittel, die von den Tieren mit dem Futter eingenommen werden, sind eine andere Ursache von Problemen. Wegen des Akkumulationseffektes finden sie sich in Fleisch in einem sehr viel höheren Verhältnis zu ihrem Anteil in Gemüsen und Getreiden.
106
Yogische Ernährung
Im 11Yearbook USA" wurde berichtet, dass achtzig verschiedene Krankheiten, die auch auf Menschen übertragen werden kön nen, den Viehbestand bedrohen. Diese Krankheiten werden nur durch die verschiedenen Antibiotika, die den Schlachttie ren verabreicht werden, unter Kontrolle gehalten. Wissen schaftler warnen, dass das fortgesetzte Einnehmen solcher Medikamente eine Resistenz gegen sie schafft, und das könnte in Fällen schwerer Krankheit bei den Patienten, die mit diesen Medikamenten behandelt werden, ernste Folgen haben. Das
11 Journal of the American Medical Association" stellte fest, dass eine Methode, Unansprechbarkeit zu entwickeln ist, den Stoff in kleinen Dosen immer wieder einzugeben, parallel zu dem, was geschieht, wenn man mit Antibiotika behandeltes Fleisch zu sich nimmt.
Sodiumnitrate und Sodiumnitrite werden verwendet, um den Verwesungsprozeß (dem alles im Fleisch unterworfen ist) zu verzögern. Das geschieht z. B. bei Wurstwaren.
Diese Art von Fleisch bleibt oft wochenlang im Laden, bevor sie verkauft wird. In Konsumentenberichten wurde festgestellt, dass Verwesungstests zeigten, dass 40% des getesteten Fleisches verdorben war und einen hohen Toxingehalt aufwies. Es wurde festgestellt, dass Sodiumnitrit möglicherweise gefährlich für kleine Kinder ist, dass es den Fötus in schwange ren Frauen deformieren und anämische Personen ernstlich schädigen könne. Man erklärte, dass der Gebrauch dieser Chemikalie im Fleisch eine mögliche Krebsursache sein könne. Eine Meinung, die seit einiger Zeit auch von vielen Wissen schaftlern aufrechterhalten wird.
Die vegetarische Ernährung minimalisiert nicht nur die Krank heitsgefahr, sondern gibt auch viel mehr Ausdauer und Wider standskraft als Fleischnahrung. Physiologische Tests an Vege tariern und Nichtvegetariern haben wiederholt bewiesen, dass die Höchstleistung der Nichtvegetarier kaum die Hälfte von der Höchstleistung der Vegetarier beträgt.
Die Massentierhaltung ist für die Tiere sehr krankmachend und zwingt so zur fortlaufenden Verabreichung von Antibiotika.
Kälber, bei denen vorsätzlich Anämie herbeigeführt wird, weil man annimmt, dass ihr Fleisch dann den Geschmack der Gourmets befriedigen kann, fallen manchmal tot um, wenn sie aus ihren gefängnisähnlichen Kisten herausgenommen wer den. Die Bedrohung des menschlichen Verbrauchers durch die Medikamente, Hormone und Schädlingsbekämpfungsmittel, die dazu gebraucht werden, diese unglaubliche Produktion irgendwie in Gang zu halten, ist eine Tatsache, die niemals richtig untersucht wurde. Das abschließende Argument gegen die ungeheure Grausamkeit, die in diesem Zweig der Landwirt schaft heutzutage praktiziert wird, ist ein menschliches. Hat der Mensch überhaupt das Recht, Leben zu reduzieren, wie es hier geschieht? Hat er des Weiteren das Recht, dieses elende Leben mit Mitteln, die bewusst grausam sind, zu beenden?
11 Es ist meine Überzeugung, dass der Mensch erst dann in Frieden mit seiner Gattung leben kann, wenn er die Ethik Albert Schweitzers anerkannt hat, die liebevolle Rücksicht allen lebenden Kreaturen gegenüber umfasst, eine wahre Ehrfurcht vor dem Leben ... " - Swami Sivananda
Zivilisation und Wissenschaft haben den Menschen von seiner natürlichen Umgebung getrennt, und diese Trennung hat eine allmähliche Degeneration verursacht. Der heutige Mensch ist oft an Körper, Geist und Seele chronisch krank. Wir, die wir
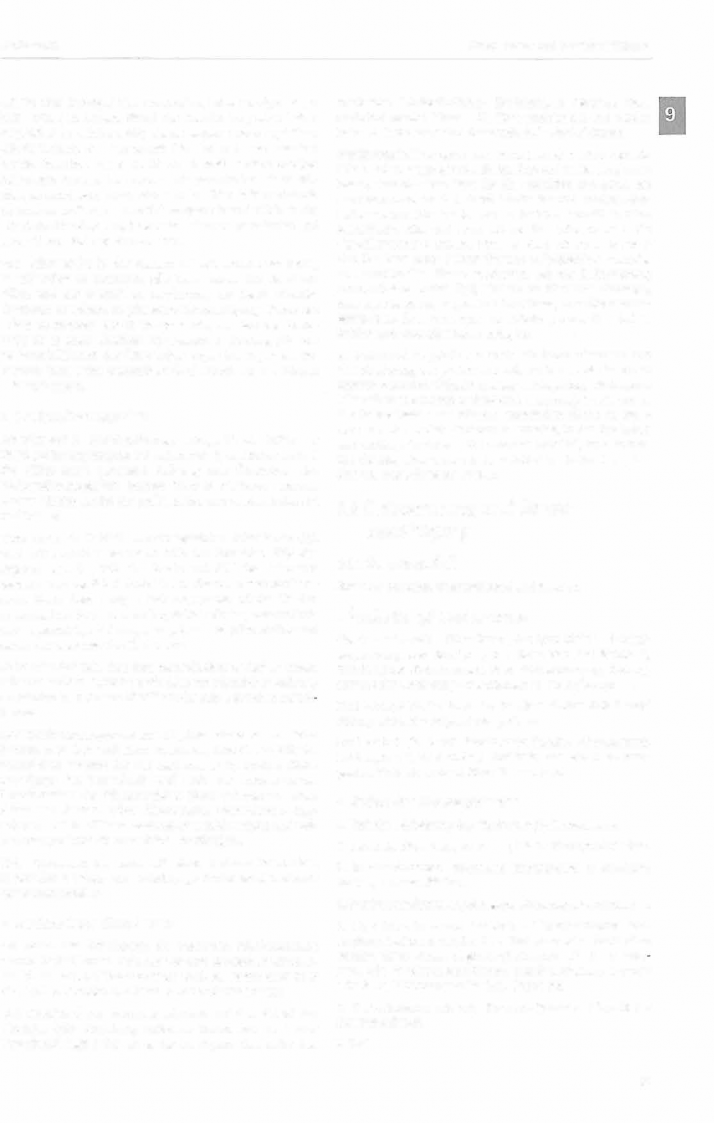
Hatha-yoga
unsere eigenen Artgenossen vernichten, haben wenig oder gar kein Verlangen, unsere Pflicht der Ehrerbietung allem Leben gegenüber zu erfüllen. Wir, denen wegen unserer geistigen Überlegenheit, die Herrschaft über alles Leben gegeben wurde, benutzen unser Recht der Gewalt, andere weniger bevorzugte Formen des Lebens gefangenzuhalten, sie zu zäh men, zu versklaven, auszunutzen und zu töten. Wir machen sie zu unseren Lastträgern oder Spielzeugen bis zu der Zeit, in der wir vielleicht wünschen, ihnen das Leben wegzunehmen und ihre leblosen Kadaver zu verzehren.
Alles Leben ist heilig, der Mensch hat kein moralisches Recht, es willentlich zu zerstören. Alle Tiere haben das Recht auf Glück, und der Mensch ist verpflichtet, das Recht lebender Kreaturen zu achten. Es gibt keine Entschuldigung, Tieren das Leben zu nehmen, sei es im Sport oder als Nahrung. Umso mehr da es einen Überfluss an pflanzlicher Nahrung gibt, die als Proteinlieferant der fleischlichen sogar überlegen ist. Der Mensch kann seine Gesundheit durch Abstinenz von Fleisch sehr verbessern.
-
Welternährungskrise
Amerikanischen Nachforschungen zufolge ist die Hälfte der Weltbevölkerung hungrig und unterernährt, und davon hat fast die Hälfte kaum genügend Nahrung zum überleben. Das Welternährungsdefizit beträgt über 8 Millionen Tonnen. Nutzen wir das Land in der praktischsten und produktivsten Art und Weise?
Etwas mehr als die Hälfte der ertragsreichen Äcker in den USA wird mit Tierfutter bepflanzt: 91% des Getreides, 77% des Sojabohnenmehls, 64% der Gerste und 88% der Haferernte wird an Tiere verfüttert, anstatt dem Menschen zugutezukom men. Wenn diese riesigen Nahrungsquellen wieder für den menschlichen Verbrauch zurückgeleitet würden, verschwände der gegenwärtige Nahrungsmangel, und es gäbe stattdessen einen bemerkenswerten Überschuss.
Es ist offensichtlich, dass dem menschlichen Bedarf an Eiweiß schlecht gedient ist, wenn große Mengen pflanzlicher Nahrung als winzige Mengen von Eiweiß wieder zum Menschen zurück kehren.
Der Verschwendungsanteil ist weit größer, als wir es uns leisten können. Man darf auch nicht annehmen, dass die Qualität des pflanzlichen Proteins der des tierischen in irgendeiner Weise unterlegen ist. Tatsächlich sind viele der konzentrierten Proteinquellen des Pflanzenreiches (dazu gehören vor allem Nüsse und Samen, grüne Blattgemüse, Weizenkeime, Soja bohnen etc.) in völligem Aminosäurengleichgewicht und voll kommen geeignet für menschliche Bedürfnisse.
Jede Proteinnahrung kann mit einer anderen harmonisch verwendet werden, um vollständige Proteinkombinationen zusammenzustellen.
-
Ehrfurcht vor dem Leben
Aus Anlass der Grässlichkeit der modernen Fabrikszüchtung warnte Rachel Carson nicht nur vor dem physischen Schaden, der Menschen und Tieren angetan wird, sie spricht auch über die damit verbundenen ethischen und anderen Fragen:
„Als Biologin, deren spezielles Interesse auf dem Gebiet der Ökologie (der Beziehung zwischen Lebewesen und ihrer Umgebung) liegt, halte ich es für unmöglich, dass unter den
Entspannung und Stressbewältigung
modernen fabriksähnlichen Einrichtungen gesunde Tiere gezüchtet werden können. Die Tiere wachsen auf und werden behandelt wie unbelebte Gegenstände." - Rache/ Carson
Geschwisterlichkeit unter den Menschen kann nicht verwirk licht werden, wenn wir so selbstsüchtig und brutal sind, zuzu lassen, dass wehrlose Tiere für die Produktion von Seren, die dazu verwendet werden, durch falsche Ess- und Denkgewohn heiten verursachte Krankheiten zu kurieren, gequält werden. Menschliche Gier und menschlicher Hass müssen durch die Vervollkommnung unserer höheren Natur überwunden wer den. Das kann durch Selbstbefragung auf physischer, mentaler und emotioneller Ebene geschehen. Mit der Beherrschung unseres kleinen Selbst (Ego) wird uns die Erkenntnis dämmern, dass alle Menschen, ungeachtet ihrer Rasse, ihres Glaubensbe kenntnisses, ihrer Farbe oder ihrer Stellung in der Gesellschaft Brüder sind, dass alles Leben heilig ist.
So beinhaltet Vegetarismus mehr als bloße Abstinenz von Fleischnahrung, um gesünder zu sein, es ist auch ein Erkennen unserer Verantwortlichkeit weniger intelligenten, niedrigeren Lebensformen gegenüber. Es ist eine Bemühung, im Menschen das Bewusstsein einer höheren moralischen Ebene zu erwe cken, um eine soziale Ordnung zu schaffen, in der das Leben sehr verlängert sein wird. So haben wir mehr Zeit, zu erkennen, wie der Sieg über unser niederes Selbst uns helfen kann, den Sinn unseres Lebens zu erfüllen.
-
-
Entspannung und Stress bewältigung
-
Stressmodell
Stress als Stimulus, Geisteszustand und Reaktion
-
-
-
-
Flucht-Kampf-Mechanismus
Gefahr- Adrenalin - Stimulierung des Sympathikus- Muskel anspannung, Beschleunigung von Herzschlag und Blutdruck, Erhöhung der Atemfrequenz, Schweißaussonderung, Verlang samung der Verdauung= Bereitschaft für Flucht/Kampf
Flucht-Kampf-Mechanismus im heutigen Großstadtdschungel ständig aktiviert- Folge: Stresssyndrom
Unsicherheit (in Beruf, Beziehungen/Familie, Wertesystem), Leistungsdruck, Entfremdung hinsichtlich der Arbeit und man gelnder Freundeskreis erhöhen Stresspotenzial
-
Stufen des Stresssyndroms
-
Einfache Aktivierung des Flucht-Kampf-Mechanismus.
-
Dauernde Muskelverspannungen, falsche Atemgewohnheiten.
-
Muskelschmerzen, Schmerzen insbesondere in Schultern, Nacken, unterem Rücken.
-
Geistig müde/ausgelaugt/angespannt/reizbar, alles wird zuviel.
-
Organische Probleme: klassisch - Magengeschwüre, Ver stopfung, Bluthochdruck, Kopfweh. Fast alleanderen Krankheiten werden durch Stress begünstigt/mitverursacht: Krebs, Aller gien, alle Verdauungsprobleme, Hautkrank heiten, Immun schwäche, Erkältungskrankheiten, Grippe etc.
-
Nervenzusammenbruch, Burn-out-Syndrom, körperlicher Zusammenbruch.
-
Tod
107
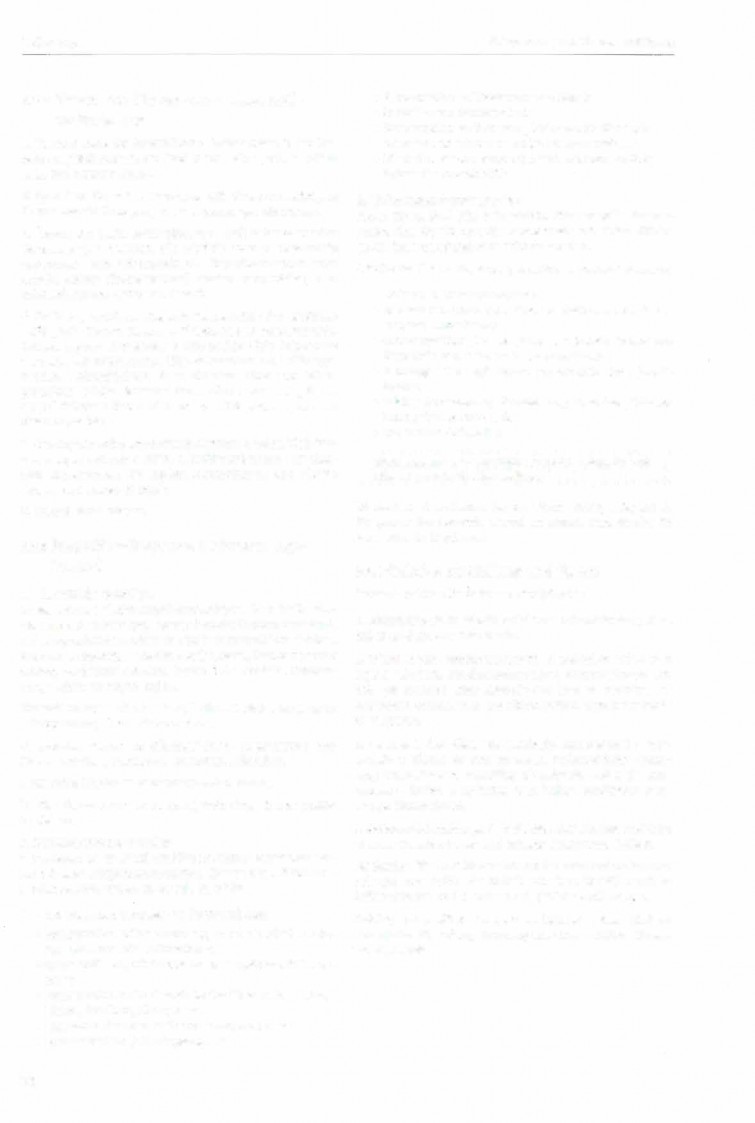
Hatha-yoga
-
-
-
Stressbewältigung durch Lebensstil- veränderung
-
Verminderung der Stressfaktoren, insbesondere in der Frei zeit: Ausgleich suchen, der Spaß macht, ohne „aufregend" zu sein. Kein Leistungsdruck.
-
Sport bzw. körperliche Bewegung hilft, Stress zu bewältigen: Körper braucht Bewegung, um Verspannungen abzubauen.
-
Äsanas sind beste Körperübungen: Durch Dehnung werden Verspannungen beseitigt, alle Muskeln werden gleichmäßig entwickelt. Kein Leistungsdruck. Körperbewusstsein wird erhöht. Cakras (Energiezentren) werden harmonisiert, man fühlt sich gut und entspannt danach.
-
Ernährung und Stress: Folgende Genussmittel erhöhen Stress anfälligkeit: Alkohol, Rauchen, Fleisch, Zucker, Auszugsmehle, Koffein. Ingwer-Zitronen-Tee belebt positiv. Viele Kräutertees verhelfen zur Entspannung. Eine Vollwertkost mit Vollkornge treiden, Hülsenfrüchten, Salat, Gemüse, Obst und Milch produkten erhöht Stressresistenz. Man sollte auf „Stress essen" {häufiges Naschen) verzichten. Zeit nehmen, um das Essen zu genießen.
-
Arbeitsplatz sollte ergonomisch gestaltet werden. Viele Ver spannungen entstehen durch Bildschirmarbeit am unsachge mäß eingerichteten Arbeitsplatz. Augenübungen und häufige Pausen sind ebenso hilfreich.
-
Freundeskreis pflegen.
-
-
Relaxation-Response (Entspannungs impuls)
-
Theoretische Grundlage
Stress aktiviert Flucht-Kampf-Mechanismus. Man bleibt akti viert bis zur Entwarnung. Körper braucht Entwarnungssignal. Bei entsprechendem Stimulus wird Parasympathikus aktiviert, Muskeln entspannt, Herzschlag verlangsamt, Hauttemperatur erhöht, Verdauung aktiviert, innere Ruhe erreicht. Entspan nung verhilft zur Regeneration.
Hirnwellen: Beta - Wachzustand, Delta - Schlafzustand, Alpha
-
Entspannung, Theta - Grenzzustand.
Alphawellen führen zu Glücksgefühlen, Regeneration von Körper und Geist, Inspiration, Kreativität, Lebenslust.
Notwendig: Rhythmus Anspannung-Entspannung.
Richtige Entspannung ist Schlüssel, trotz Stress immer positiv zu bleiben.
-
-
Kurzentspannungstechniken
Wir entspannen einen Teil des Körpers. Körper reagiert als gan zes mit einer Entspannungsreaktion. Können alle 1-2 Std. aus geführt werden. Dauer: ca. 30 sek. bis 2 Min.
Jede der folgenden Techniken reicht für sich aus:
-
Konzentration auf Bauchatmung, eventuell mit Visualisie rung von Licht oder Affirmationen
-
Augen schließen, mit dunkler Farbe alle geistigen Bilder zu malen
-
Konzentration auf Schlüsselteile des Körpers: Fußsohlen, Hüften, Schultern, Kiefer, Augen
-
Anspannen der Körperteile von unten nach oben
-
Autosuggestion: ,,Ich entspanne ... "
Entspannung und Stressbewältigung
-
Konzentration auf Erwärmung der Hände
-
Vorstellen von Landschaft etc.
-
Konzentration auf Schwere: ,,Meine rechte Hand wird schwerer und schwerer, und ich bin ganz ruhig ... "
-
Wiederholung von mantras; Gebet; Erinnern an Gott; Spüren der inneren Stille
-
-
Tiefenentspannungstechniken
Jeden Tag ca. 5-15 Min. Sehr wichtig. Führt zu voller Regene ration. Eine Erweiterung des Bewusstseins mit tiefem Glücks gefühl kann manchmal auch erfahren werden.
Schritte der Tiefenentspannung nach Swami Vishnu-devananda:
-
Hinlegen in Entspannungslage
-
Muskeln von unten nach oben der Reihe nach 5 Sek. an spannen, locker lassen
-
Autosuggestion: ,,Ich entspanne ... ", jeweils dreimal alle Körperteile von unten nach oben durchgehen
-
Autosuggestion bzgl. innerer Organe (wie oben, jeweils dreimal)
-
geistige Entspannung: Visualisierung eines Sees, Wieder holung eines mantra o. ä.
-
zum Schluss Affirmation
-
Merke: Längere Tiefenentspannung (mehr als 20 Min., ohne Ein schlafen) nur unter direkter Anleitung.
Mindestens einen halben Tag pro Woche richtig entspannen. Ein ganzes Wochenende einmal im Monat. Eine Woche im Jahr. Leben im Rhythmus.
-
-
Geistige Einstellung und Stress
-
-
Folgende geistige Einstellungen sind hilfreich:
-
Absorbiertsein in jeweils anfallende Arbeit/Tätigkeit; Spaß haben an dem, was man macht.
-
Erkennen von Handlungsalternativen und Selbstvertrauen in eigene Fähigkeit, Handlungsalternativen wahrzunehmen: ,,Ich habe die Situation unter Kontrolle und kann sie beeinflussen." Situationen vorausplanen und aktiv gestalten, anstatt nur passiv zu reagieren.
-
Vertrauen, dass alles, was geschieht, zum Besten ist. Mög lichkeiten: Glaube an Sinn im Leben. Philosophische Einstel lung. Gottvertrauen. Misserfolg als Lehrgeld. Leben als Lern prozess - karma. langfristige Ziele helfen, kurzfristige Miss erfolge hinzunehmen.
Prä0äyäma (Atemübungen) erhöht die Lebensenergie und führt zu mehr Selbstvertrauen und höherer Stressverträglichkeit.
Meditation führt zur Wahrnehmung des stets ruhigen inneren Pols und zum Gefühl der Einheit mit allem. Verhilft damit zu Selbstvertrauen und Vertrauen auf göttliche Kraft um uns.
Training des positiven Denkens im täglichen Leben führt zu dauerhafter Einstellungsänderung und damit erhöhter Stress verträglichkeit.
108
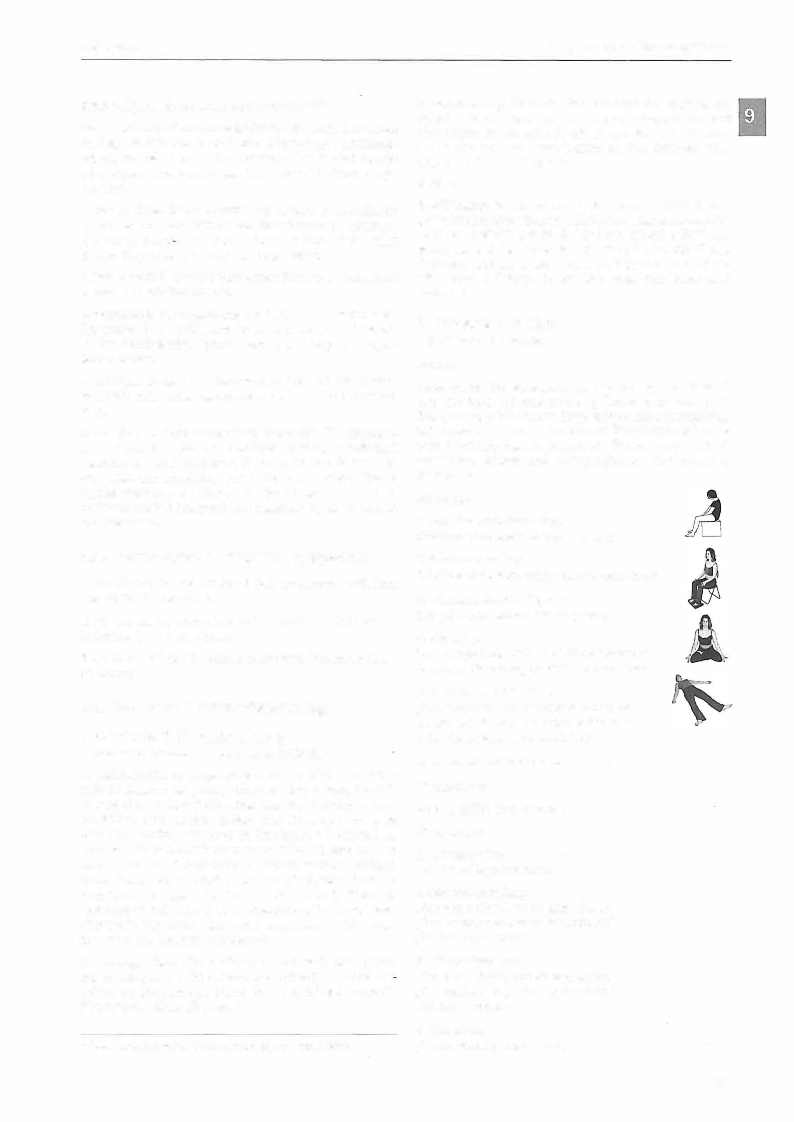
Hatha-yoga
9.3.s Allgemeines Anpassungsprinzip
Neben dem Modell des Stresssyndroms gibt es ein alternatives Modell, nämlich das Modell vom Allgemeinen Anpassungs prinzip. Es besagt, dass ein Organismus auf Veränderungen oder ungewohnte Belastungen in folgenden Schritten reagie ren kann:
-
Alarm: Stress bringt Systeme des Körpers in Alarmbereit schaft, was von Ausschüttung der Stresshormone, Aktivierung des Flucht-Kampf Mechanismus über erhöhte Wachsamkeit bis zum Empfinden von Angst und Ärger reicht.
-
Widerstand: Körper und Geist setzen dem Stress Widerstand entgegen (Trägheitsmoment).
-
Anpassung: Der Organismus passt sich an die veränderten Anpassungen an - Geist lernt, Körper wird stärker, flexibler etc. In der Trainingslehre spricht man vom Prinzip der Hyper kompensation.
-
Zusammenbruch: Bei Überbeanspruchung ist der Organis mus nicht mehr in der Lage sich anzupassen und bricht zusam men.
Das allgemeine Anpassungsprinzip findet auf alle Lebenspro zesse Anwendung. Wann welche Phase beginnt, ist individuell verschieden. Durch Einstellungsänderung ist man in der Lage, die Phase der Anpassung auf Kosten der anderen Phasen auszudehnen und so auf Stress positiv zu reagieren und Stress positiv zu erleben (Eustress) und negativen Stress zu vermei den (Disstress).
-
-
-
Physiologische Entspannungsgesetze
-
Ein Muskel, der mindestens 5 Sek. angespannt wird, kann anschließend entspannen.
-
Ein Muskel, der mindestens 10 Sek. passiv gedehnt wird, kommt zu tiefer Entspannung.
-
Ein Körperteil, der bewusst gemacht wird, kommt zur Ent spannung.
-
-
Saväsana* {Tiefenentspannung)
-
-
1. Klassische Tiefenentspannung
(nach Swami Vishnu-devananda, Dauer ca. 10-20 Min.)
-
Tiefenentspannungslage auf dem Rücken: Füße etwa schul terbreit auseinander geben, Arme vom Körper weg, Handflä chen nach oben. Kopf in der Mitte. Falls diese Haltung im unte ren Rücken unangenehm ist, kann man ein Kissen, eine Rolle oder eine gerollte Decke unter die Knie legen. Falls die Stellung im oberen Rücken oder Nacken unangenehm ist, kann man ein Kissen unter den Hinterkopf legen oder ein gerolltes Handtuch in den Nacken. Wenn möglich, ist es am günstigsten, dire_ kt auf dem Boden zu liegen. Man kann notfalls auch die Tiefenent spannung im Bett oder in einer sitzenden Haltung ausführen. Körperteile von unten nach oben anspannen; 5 Sek. ange spannt lassen, loslassen, nachspüren.
-
Autosuggestion: Körperteile von unten nach oben bitten, sich zu entspannen: ,,Ich entspanne die Füße (dreimal wieder holen). Ich entspanne die Waden (dreimal). Ich entspanne die Oberschenkel (dreimal) ... etc. "
* Savasana „Totenstellung", Entspannungslage auf dem Rücken.
Entspannung und Stressbewältigung
-
Visualisierung: Stelle dir eine wunderschöne Gegend vor, irgendwo in der Natur, wo du dich ganz geborgen und ganz wohl fühlen kannst. Male dir alle Einzelheiten aus. Die Natur um dich herum, den Himmel, spüre die Erde unter dir. Fühle dich eins mit deiner Umgebung.
-
Stille
-
Affirmation: Wiederhole eine oder mehrere Affirmationen:
„Mein Rücken fühlt sich ganz wohl", ,,Meine Bandscheiben sind stark und flexibel", ,,Ich bin in Harmonie mit mir selbst", ,,Ich werde meine Aufgabe freudig und erfolgreich erledigen" o. ä. Finde das, was am ehesten das ausdrückt, was du erreichen willst. Atme tief durch. Strecke und räkele dich. Setze dich/ stehe auf.
-
Autogenes Training
(angelehnt an J. H. Schultz)
Nutzen:
Konzentrative Selbstentspannung, Abschaltung und Umschal tung auf Ruhe, jederzeit Erholung; Überwindung von Angst, Ärger, Stress; Erhöhung von Konzentration und Leistungsfähig keit, besseres Schlafen, Lebensfreude; Überwindung von vege tativer Dystonie; bessere Gesundheit; Überwindung von Kopf schmerzen, Magen und Darmproblemen, Bluthochdruck, Asthma etc.
Haltungen:
-
Droschkenkutscherhaltung
(Oberkörper und Kopf nach vorne gebeugt)
-
Pharaonenstellung
(Rücken gerade, nicht anlehnen; Knie rechtwinklig)
-
Schneidersitz oder Yogasitz
(mit gekreuzten Beinen, Rücken gerade)
-
Rückenlage
(Beine ausgestreckt, Füße ca. 30-70 cm auseinander, Arme vom Körper weg, Handflächen nach oben)
-
Modifizierte Rückenlage
(Kopf unterstützt mit Kissen/Nackenrolle; Knie angewinkelt, Fußsohlen auf dem Boden oder dickes Kissen/Rolle unter den Knien)
-
Im Lehnstuhl (so wie es bequem ist)
Übungsdauer:
-
-
Mal täglich 2-20 Minuten
Übungsfolge:
-
Ruheeinstellung
,,Ich bin vollkommen ruhig."
-
Schwereeinstellung
,,Der rechte/linke Arm ist ganz schwer."
,,Das rechte/linke Bein ist ganz schwer."
,,Ich bin ganz schwer."
-
Wärmeeinstellung
,,Der rechte (linke) Arm ist ganz warm."
,,Das rechte (linke) Bein ist ganz warm."
,,Ich bin ganz warm."
-
Atemübung
,,Meine Atmung ist ganz ruhig."
109

Hatha-yoga
-
Herzerlebnis
„Mein Herz schlägt ruhig und gleichmäßig." Bei schwachem Herzen: ,,Mein Herz schlägt kräftig und regelmäßig."
-
Sonnengeflechtsübung
,,Mein Sonnengeflecht ist strömend warm."
-
Kopfeinstellung
,,Meine Stirn ist angenehm kühl."
Merke: Die Übungen folgen eine auf die andere in der gleichen Haltung. Empfehlenswert zum Erlernen ist es, zunächst Übung 1 zu praktizieren. Wenn Übung 1 beherrscht wird, können Übung 1 + 2 praktiziert werden, dann 1 + 2 + 3 etc.
Regelmäßige Übung führt zum gewünschten Erfolg. Bei Pro blemen oder Fragen solltest du Yogalehrer, Arzt, Therapeuten oder Heilpraktiker um Rat fragen.
-
-
-
-
-
Entspannung über das Fühlen
(Form von yoga-nidra*, Dauer ca. 15-25 Min.)
-
Lege dich auf den Rücken in die Entspannungslage.
-
Gefühl von Schwere/Leichtigkeit: Spüre die Kontaktpunkte des Körpers mit dem Boden, zunächst einzeln von unten nach oben: Fersen, Waden, Oberschenkel, Gesäß ... Spüre alle Kontaktpunkte des Körpers mit dem Boden gleichzeitig. Atme hinein. Spüre, wie du schwerer zu werden und in den Boden hineinzusinken scheinst, oder spüre, wie du leichter wirst, zu schweben scheinst.
-
Gefühl von Energie: Spüre die Fingerspitzen. Spüre die Wärme/das Kribbeln. Gehe mit dem Bewusstsein ein paar Mal von den Fingern die Arme entlang zum Hinterkopf. Spüre Finger, Arme, Nacken und Hinterkopf als Ganzes. Spüre die Energie dort. Spüre die Füße. Spüre die Wärme/das Kribbeln. Gehe mit dem Bewusstsein ein paar Mal von den Zehen die Beine entlang bis zum unteren Rücken. Spüre die Füße/Beine/ Gesäß/unteren Rücken als Ganzes gleichzeitig. Spüre die Energie dort. Spüre Füße, Hände, Schultern, Schädeldecke gleichzeitig. Spüre das Energiefeld um dich herum.
-
Gefühl der Ausdehnung: Spüre die nach links zeigenden Teile des Körpers, zunächst von unten nach oben: Linker Fuß, linker Unterschenkel ... Spüre dann alle nach links zeigenden Teile des Körpers gleichzeitig. Spüre die nach links ausstrahlende Energie. Atme nach links. Spüre, wie du nach links weiter zu werden scheinst. Ebenso nach rechts. Ebenso nach oben. Spüre dann die Ausdehnung und das Energiefeld in alle Richtungen. Atme in alle Richtungen. Fühle, wie du dich in alle Richtungen auszu dehnen scheinst. Genieße dieses Gefühl der Weite. Wenn du willst, wiederhole ein paar Mal geistig: Ich bin eins mit dem Unendlichen. Ich bin verbunden mit allem. Oder spüre einfach nur die Stille, den Frieden, die Entspannung.
-
Affirmation: Atme wieder tief durch. Wiederhole eine oder mehrere Affirmationen: ,,Mein Rücken fühlt sich ganz wohl",
„Ich bin in Harmonie mit mir selbst ", ,,Ich werde meine Aufgabe freudig und erfolgreich erledigen" o. ä. Finde das, was am ehes ten das ausdrückt, was du erreichen willst.
-
Atme tief durch. Strecke und räkele dich. Setze dich/stehe auf.
-
Yoga-nidra ist eine Yogatechnik aus der tantri'schen Tradition, die durch tiefe Entspannung und bewussten Schlaf den Zugang zu tiefen Bewusst seinsschichten ermöglicht. Sie wird meist in savasana ausgeführt.
110
Entspannung und Stressbewältigung
IV. Yoga-nidrä
(nach Swami Satyananda, Dauer ca. 15-30 Min.)
-
Vorbereitung
saväsana, Konzentration auf äußere Laute
-
Affirmation (Beispiele)
,,Ich erwecke mein spirituelles Potenzial."
„Mein Tun wirkt sich positiv auf die Entwicklung anderer Menschen aus."
,,Ich bin eine positive Kraft im Leben anderer Menschen."
,,Ich bin in allem, was ich unternehme, erfolgreich."
,,Ich bin wach und effizient."
,,Ich bin vollkommen gesund."
-
Bewusstsein durch den Körper schicken
(a)
-
Vom rechten Daumen hinunter zum rechten kleinen Zeh (jeden einzelnen Körperteil dabei spüren).
-
Vom linken Daumen zum linken kleinen Zeh.
-
Von den Fersen zum Hinterkopf.
rechter großer Zeh, zweiter Zeh ... alle Zehen• linker gro ßer Zeh, zweiter Zeh ... alle Zehen• rechte Fußsohle, linke Fußsohle, beide Fußsohlen • rechte Ferse, linke Ferse, beide Fersen• rechte Gesäßhälfte, linke Gesäßhälfte, gan zes Gesäß • unterer Bauch, oberer Bauch, ganzer Bauch • rechte Brust, linke Brust, ganze Brust • rechte Schulter, linke Schulter, beide Schultern• Oberarme, Ellbogen ... bis zu den kleinen Fingern • Rücken: oben, Mitte, unten, rechts, links, ganzer Rücken, Wirbelsäule; Hals, Nacken, beide • Kinn, untere Lippe, obere Lippe, beide Lippen, Zähne • Zunge • rechte Wange, linke Wange, beide Wangen • rechter Nasenflügel, linker Nasenflügel, ganze Nase• rechte/r/s Augenlid, Augapfel, Augenbraue, Schläfe, linke/r/s Augenlid, Augapfel, Augenbraue, Schläfe, Stirn, ganzes Gesicht• Hinterkopf, Scheitel, ganzer Kopf• rechter Arm, linker Arm, beide Arme • rechtes Bein, linkes Bein, beide Beine • Körpervorderseite, Körperrückseite • rechte Körperhälfte, linke Körperhälfte• ganzer Körper
Körperrückseite
-
(b) - Kontaktpunkte des Körpers mit dem Boden.
-
Körpervorderseite - alle nach oben zeigenden Körperteile.
-
-
Bewusstsein des Atems
Den Atemfluss nicht verändern. Beobachten des Atems in den Nasenlöchern, in der Brust, im Raum zwischen Nabel und Kehle, im Bauch. Zählen des Atems.
-
Sich der Gefühle und Empfindungen bewusst werden
Hitze/Kälte, Schwere/Leichtheit, Freude/Sorge, Liebe/Hass, ...
-
HIm: Stell dir vor, es ist ein heißer Sommertag, alles ist heiß, du schwitzt etc.
-
KÄLTE: ... du liegst draußen im Kalten, ohne Kleider, zitternd, eisiger Wind etc.
-
SCHWERE: ... der Körper wird immer schwerer. Wie Blei. Du kannst den Körper nicht mehr bewegen. Du kannst nicht einmal mehr Augenlider, Zehen oder Finger bewegen.
-
LEICHTHEIT: ... der Körper wird immer leichter, er verliert alle Schwere. Der Körper wird so leicht wie ein Stück Watte. Fühle, wie der Körper immer leichter wird etc.
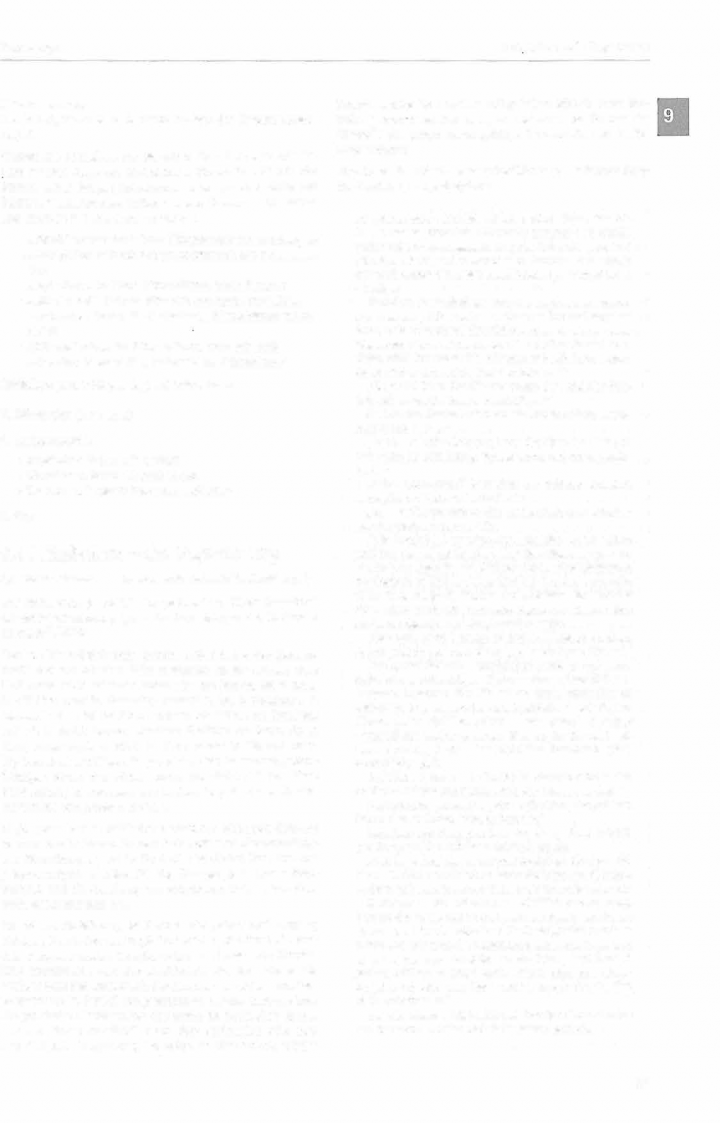
Hatha-yoga
-
-
Visualisierung
Landschaft, Symbole (z. B. cakras entlang des Körpers vorstel len) etc.
Wirbelsäule vorstellen, nur die Wirbelsäule. Betrachte mit dei nem inneren Auge die Wirbelsäule. Wirbelsäule ist wie der Stamm einer langen Lotosblume oder Seerose. Grün mit Blättern. Wassertropfen. Entlang dieses Stammes sind sieben Lotosblumen in verschiedenen Farben:
-
mD/ädhära: vier dunkelrote Blütenblätter, innen ockergelb
-
svädhiJthäna: sechs zinnoberrote Blütenblätter, innen weiß- blau
-
mafli-pDra: zehn blaue Blütenblätter, innen feuerrot
-
anähata: zwölf tiefrote Blütenblätter, innen dunkelblau
-
visuddha: sechzehn lila-dunkelgraue Blütenblätter, innen violett
-
äjfiä: zwei reinweiße Blütenblätter, innen reinweiß
-
sahasrära: tausend (lila, mehrfarbige) Blütenblätter Schließen: ganzer Körper liegt auf Lotosblume
-
-
Affirmation (s. Punkt 2)
-
Bewusstwerden
-
physischer Körper, wie er liegt
-
Umgebung, Raum, Menschen etc.
-
tief atmen, langsam bewegen, aufsetzen
-
-
Ül']'l
-
-
PräQäyäma - die Yogaatmung
-
(vgl. Swami Vishnu-devananda, ,,Das große illustrierte Yogabuch", Kap. 8)
im Geist").
IYS 1-2
1
Der Weise Patafijali definiert yoga in seinem Werk „Yogasütra" als citta-v.rtti-nirodhalJ (,,das Zur-Ruhe-Bringen der Gedanken
Das ist nicht möglich ohne Kontrolle über den präfla (Lebens kraft), der eng mit dem Geist verbunden ist. Wir können diese Verbindung leicht erkennen, wenn wir eine Person, die in tiefer Meditation oder in Gedanken versunken ist, beobachten. In diesem Zustand ist der Atem langsam oder hört manchmal fast auf. Ist der Geist aber von negativen Gefühlen wie Sucht, Ärger, Zorn, Sorge ergriffen, wird der Atem unregelmäßig und unru hig. Das steht in völligem Gegensatz zu dem langsamen, gleich förmigen Strom des Atems, wenn der Geist still ist. Diese Beobachtungen beweisen das Ineinandergreifen und Zusam menwirken von präfla und Geist.
Hatha-yoga ist als praktischer Aspekt von räja-yoga definiert worden, und in diesem System finden wir auch die verschiede nen Atemübungen, die die Kontrolle der vitalen Kraft bzw. des präfla ermöglichen sollen. Alle Yogaübungen, ja das ganze Yoga training, und die Ausübung von präfläyäma haben diese Kon trolle des präfla zum Ziel.
Wir können die Wirkung der Kontrolle des präfla an allen großen Heiligen, Propheten und yog,s beobachten, die durch die Kraft dieser angesammelten Energie, präfla, den Prozess der Entwick lung intensivieren und das allerhöchste Ziel des Lebens, die Freiheit oder das „Königreich des Himmels" erreichen konnten. Yogaatmung ist der Teil von präfläyäma, der die Kontrolle über die physische Manifestation des präfla im physischen Körper anstrebt. Wenn der Schüler auf dem spirituellen Pfad fort schreitet, wird ihm gelehrt, den präfla, welcher sich als geistige
Pränäyäma - die Yogaatmung
Energie manifestiert und nur mit geistigen Mitteln unter Kon trolle gebracht werden kann, zu meistern. Der Prozess der Kontrolle des präfla durch geistige Konzentration wird räja yoga genannt.
Eine kurze Geschichte veranschaulicht in vereinfachter Form die Ausübung von präfläyäma:
Ein müder, alter Holzfäller erkannte eines Tages, dass die Zeit, in der er körperlich nicht mehr imstande sein würde, seiner Arbeit nachzugehen, nahe war. Er war ein guter und gläubiger Mann, und so betete er zu Gott um einen Diener, der stark genug wäre, alle diese schwierigen Aufgaben zu erledigen.
Nachdem ein mitleidiger Gott die Klage seines ergebe nen Dieners gehört hatte, erschien er ihm und sagte zu ihm: ,,Dein Wunsch soll dir erfüllt werden. Ich will dir einen Riesen als Diener schicken, der alle Arbeiten für dich erle digen wird. Du musst ihn nur immer beschäftigt halten, sonst wird er dich auffressen, verstehst du?"
,,Oh ja! Ja! Mein Herr!", antwortete der Holzfäller freu dig. ,,Ich werde ihn immer beschäftigen."
Er ließ den Riesen sofort an die Arbeit gehen. ,,Putze mein Haus, Diener."
,,Ja, Herr!" In fünf Minuten hatte der Riese das Haus sei nes Herrn bis zum letzten Winkel durch und durch gesäu bert.
11 Sehr gute Arbeit", bemerkte der Meister lächelnd.
,,Nun jäte das Unkraut im Garten."
11Ja, Herr!", antwortete der Riese. Nach drei Minuten war der Garten wunderschön.
„Wie herrlich", bemerkte der Holzfäller, ,,mein Leben wird von nun an viel leichter sein." Dem Riesen wurde nun die Aufgabe gestellt, aus dem zwanzig Meilen entfernten Dorf Waren zu bringen. ,,Das wird den Burschen nun eine Weile beschäftigen", dachte der Holzfäller lächelnd bei sich. Aber nach einer Minute hatte der Riese seine Aufgabe vollendet und stand wieder vor ihm.
„Was nun, Herr?", fragte er drohend, ,,Welche andere Arbeit gibst du mir nun? Schnell, oder ich fresse dich auf." Nun geriet der arme Holzfäller in Panik. Er war kaum fähig, den arbeitswütigen Riesen weiter zu beschäftigen. langsam begannen ihm die Folgen seines Wunsches zu dämmern. Er erkannte, dass ihm bald keine Arbeit für den Riesen mehr einfallen würde - was dann? In seiner Verzweiflung ging er zu einem Weisen, der ihn nach sei nem Problem fragte. Der Holzfäller beschrieb seine
schreckliche Lage.
Der Weise besann sich eine Weile, dann wandte er sich an den Holzfäller und sagte: ,,Rufe den Riesen hierher."
Der Holzfäller gehorchte. ,,Nun befiehl ihm, den größten Baum, den er finden kann, zu bringen."
Innerhalb von Sekunden kam der Riese, einen mächti gen Baum auf den Schultern tragend, zurück.
,,Nun sage ihm, dass er auf den Wipfel des Baumes klet tern soll und dann so rasch er kann wieder hinunter", ordne te der Weise an. ,,Fahre fort, deine Befehle zu wiederholen." Nachdem er die Befehle des Holzfällers gehört hatte, begann der Riese mit Höchstgeschwindigkeit, den Baum hinauf- und hinunterzuklettern. Nach einiger Zeit wurde er müde und erkannte die Ausweglosigkeit seiner Lage, und so fiel er vor dem Holzfäller auf die Knie. ,,Herr! Herr! 0 großer, gütiger Meister! Bitte, erlöse mich von dieser Aufgabe, ich bitte dich, Herr, und ich verspreche dir, dich
nicht aufzufressen."
Der alte Mann erklärte sich mit Freuden einverstanden und war nun ein freier und viel weiserer Mensch.
111

Hatha-yoga
In dieser kleinen Geschichte repräsentiert der Holzfäller den Menschen, der Riese den unsteten Geist, der den Frieden des Menschen unentwegt stört. Durch die Praxis von japa, das Wiederholen eines mantra bzw. einer heiligen Silbe (das Hinauf- und Hinunterklettern), gibt der Geist endlich auf und wird ruhig und stetig. Der prär:,a kommt unter Kontrolle. Das Aufhören der Erscheinungsformen des Denkprinzips ist gelun gen und der yogT erreicht yoga (Vereinigung).
9.4.1 Das Wunder des Atems
Lieder regen den Menschen während der Arbeit an auszuat men. So wird die Lunge vollständig von verbrauchter Luft be freit. Man kann nicht singen, ohne allmählich auszuatmen, und dabei werden Unreinheiten ausgeschieden, die Lungen geleert und freigemacht für einen frischen unwillkürlichen Atemzug.
Wirkliche Atemkontrolle bedeutet, dass Ausatmen gelernt wird, nicht Einatmen. Die Energie wird durch die normale Befreiung des Atems am besten erneuert, nicht durch gewalt sames Vollpumpen der Lungen mit Luft. So kannst du, bei gro ßer physischer Anstrengung - wie dem Tragen einer schweren Tasche, schnellem Gehen, beim Umgraben des Gartens - durch Konzentration auf das langsame Ausströmen der Luft aus den Lungen besser mit deinen Kräften haushalten.
Redner, Sänger, Schwimmer und Läufer wissen das. Wir ande ren können es durch einfache Tests herausfinden. Zum Beispiel hat man, wenn man unter die kalte Dusche geht, das Bedürfnis, nach Luft zu schnappen und die Muskeln anzuspannen. Das verstärkt die Quälerei aber nur. Wenn du stattdessen versuchst, langsam und gleichmäßig auszuatmen, wirst du erstaunt sein, wie wenig dir die Temperatur des Wassers ausmacht. Die Atmung hilft dem Körper, sich Veränderungen anzupassen.
Wenn du das nächste Mal etwas Schweres heben musst, sei es ein großer Suppentopf, eine Schreibmaschine oder ein Koffer, versuche, einen vollen, tiefen Atemzug zu tun und den Atem während des Hebens anzuhalten. Wahrscheinlich ist die Last dann viel leichter. Die Wirkung ist wie wenn man erwartet, einen vollen Koffer zu heben, und dann feststellt, dass er leicht ist.
Jene, die das Levitationsspiel gespielt haben, haben gesehen, dass eine Person oder ein Tisch nur mit den Fingern gehoben werden kann, vorausgesetzt, dass alle Personen einer Gruppe während des Hebens tief und gleichmäßig atmen. Das zeigt die geheimnisvolle Hilfe, die von dem bewussten Einsetzen des Atems kommt.
Sorgfältige Atemkontrolle, mit Betonung der Ausatmung, hilft uns, bei jeder Art von Anspannung oder Stress zu entspannen. Die meisten von uns sind „halbe Atmer". Wir atmen ein, weil wir nicht anders können, aber wir atmen nicht vollständig aus. Das Resultat ist, dass wir viel seufzen, ein Zeichen unseres Bedürfnisses auszuatmen. Der Seufzer ist der Weg der Natur, unsere Lunge zu entleeren, wenn wir unseren Atemapparat lang genug vernachlässigt haben. Wir müssen lernen, auf systematische und geregelte Art zu seufzen. Wir wissen, dass jede Störung des Atems akuten Kummer erzeugt. Daraus folgt, wie der gesunde Menschenverstand und die Wissenschaft uns zeigen, dass jede Verbesserung unseres Atems Körper und Geist erhellen und heiter machen können.
Normalerweise atmen wir, ohne sichtbare Anstrengung, unge fähr 18-mal in der Minute, 1 080-mal pro Stunde, 25 920-mal pro Tag. Je mehr Luft wir ausatmen, umso mehr können wir
112
Prär:iäyäma - die Yogaatmung
auch wieder einatmen. Die Menge, die wir aufnehmen, heißt Vitalkapazität. Sie kann durch ein uhrengroßes Instrument, Spirometer genannt, gemessen werden.
Ein sorgfältiges Handhaben und Haushalten des Atems kann von praktischer, täglicher Hilfe sein, kann unsere Stimmung verbessern und sichtbar zu unserer Gesundheit und Vitalität beitragen. Jede Atemdisziplin dient dazu, unsere vitale Kapazität zu erhöhen. Das Bewusstwerden der Ausatmung wird zum wichtigsten Faktor. Die Hauptsache ist, diese Gewohnheit zu kultivieren. Atme aus, bevor du etwas Neues beginnst. Wenn du einmal die Grundgedanken des richtigen Atmens begriffen hast, wirst du auf vielerlei Art dafür belohnt werden. Sogar in der Zeit der Rolltreppen und Aufzüge gibt es Stufen, die man erklimmen kann, gewöhnlich unter Keuchen und Stöhnen. Aber versuche Folgendes: Wenn du die ersten zwei Stufen hinaufsteigst, halte die Schulterblätter unten, atme ein. Atme bei den nächsten beiden aus. In dem Rhythmus von zwei ein und zwei aus kannst du ganze Treppenfluchten hinauf gehen und oben ankommen, ohne nach Luft zu schnappen.
Was geschieht? Indem wir während des Steigens die Atmung rhythmisch beschleunigen, scheiden wir eine große Menge von Kohlendioxid aus und führen dem Körper mehr Sauerstoff zu.
Das Prinzip kann weiter erläutert und gefestigt werden, wenn wir unseren Atemrhythmus verkürzen, wenn wir einen Hügel oder einen langen Abhang hinaufwandern. In diesem Fall atmest du ein, während du drei Schritte machst, und aus wäh rend der nächsten drei, drei ein, drei aus, halte die Schulter blätter hinten. Ein Hügel, bei dem dir normalerweise der Atem ausgehen würde, kann durch diese einfache Veränderung des Atemtempos leicht bewältigt werden.
Wenn dich irgendeine Anstrengung ohne richtige Anpassung außer Atem kommen lässt, gibt es einen einfachen Weg, den Atem wieder zu normalisieren. Atme schneller, hechle für ein paar Sekunden wie ein Hund. Dann atme ein paarmal tief und leicht ein, hechle wieder und nimm ein paar volle Atemzüge. Das wird deinen Atem viel schneller beruhigen als gewaltsame Anstrengung, normal zu atmen.
Wenn ein Läufer den sogenannten „zweiten Wind" bekommt, bedeutet das, dass er ab einem bestimmten Punkt ein vergrö ßertes Bedürfnis unbewusst abgeschätzt hat und die schnelle re Ansammlung von Kohlendioxyd durch tieferes und stetigeres Aufnehmen von Sauerstoff ausgleicht.
Was die unglückliche Mehrheit von uns heutzutage braucht, ist ein Atmungsprogramm, das uns an unseren Schreibtischen, Öfen oder Maschinen helfen kann. Spannung und sogar Depression kann durch folgende Übung überwunden werden. Gib die Schulterblätter so nahe zusammen, wie es ohne Über anstrengung möglich ist, dann atme sanft und vollständig aus. Pausiere, dann atme mit einem tiefen, langsamen, sachten Atemzug ein, bis die Lungen angenehm gefüllt sind. Atme lang sam, mit einem langen Seufzer durch die Nase aus, ohne die Stellung der Schulterblätter zu verändern. Warum? Weil du dein Gehirn stimuliert hast und die Nervenanspannung durch die vermehrte Aufnahme von lebensspendendem Sauerstoff erleichtert hast.
Bei dem sogenannten Lampenfieber scheint man oft an einer leichten Form des Erstickens zu leiden. Schauspieler und erfah rene Redner wissen um die Wohltaten der Atemkontrolle. Jeder von uns kann von der Gewohnheit des Schauspielers, vor
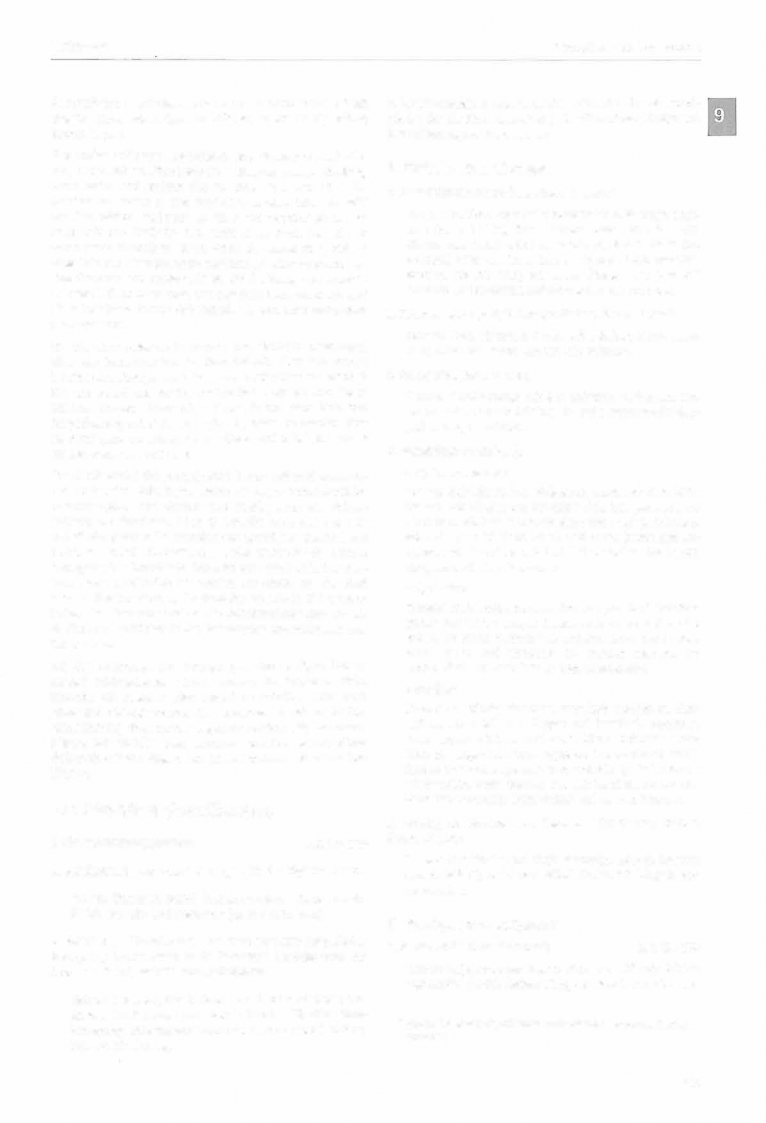
Hatha-yoga
dem Auftritt in der Kulisse stehen zu bleiben und sich selbst mit einigen tiefen Atemzügen zu stärken, bevor er die Bühne betritt, lernen.
Eine andere wirksame Möglichkeit, seine Atmung zu kontrollie ren, ist das Zählen. Sitze bequem in einer aufrechten Stellung, atme sacht und gleichmäßig zu einer Zahl von fünf ein. Pausiere eine Sekunde und atme dann zu einer Zahl von zwölf aus. Das nächste Mal atme zu einer Zahl von fünf ein und zu einer Zahl von fünfzehn aus. Führe diese Praxis fort, bis du einen guten Fortschritt siehst. Wenn du einmal fähig bist, zu einer Zahl von einundzwanzig auszuatmen, wirst du bemerken, dass Summen eine große Hilfe ist, um die Menge der ausströ menden Luft zu begrenzen. Das Summen beim Ausatmen gibt dir deine eigene Art von Arbeitslied. Das wird bhrämarT-prär:iä yäma genannt.
Es gibt viele Folgeerscheinungen des richtigen Ausatmens, aber die bedeutendste ist Bewusstheit. Richtiges Atmen bewirkt eine strenge Umstellung unserer täglichen Gewohnhei ten und macht uns auf irgendeine Weise wieder zum Herrn unseres Körpers. Bewusstes Atmen bringt eine bewusste Körperhaltung mit sich. Du beginnst gewahr zu werden, dass du nicht ganz vornübergebeugt sitzen und dabei gut atmen kannst, weder ein noch aus.
Der durchschnittliche Mensch geht herum mit weit auseinan der stehenden Schultern. Wenn er seine Schulterblätter zusammengibt, folgt daraus ganz zufällig auch die richtige Haltung der Schultern. Aber er erreicht noch viel mehr. Er befreit die gesamte Bauchregion von unnötigem Gewicht und Druck und schafft die passenden Bedingungen für die richtige Bewegung des Zwerchfells. Das wird das Atmen sofort erleich tern, denn gewöhnlich verwenden wir einen Teil der Kraft unserer Einatmung dazu, das Gewicht von Rippen und Brust zu heben. Das Zusammenziehen der Schulterblätter gibt uns ein Gefühl der Leichtigkeit in der Bauchregion und veranlasst uns, tief zu atmen.
Bei den anstrengenden Bedingungen des heutigen Lebens genügt automatisches Atmen unseren Bedürfnissen nicht. Sitzende Lebensweise oder monotone Arbeiten rufen nach neuer und bewusst kontrollierter Atemweise. Es würde sich loh nen, jeden Tag einen der hier angebotenen Vorschläge auszupro bieren. Wir werden bald erfahren, welchen konstruktiven Gebrauch wir von dieser, nun überschaubaren, Kraft machen können.
-
-
-
Prär:,äyäma (Atemübungen)
1. Grundatmungsarten (s. S. 167, 171)
-
Bauchatmung (Zwerchfellatmung) - für das tägliche Leben.
TECHNIK: Einatmen, Bauch hinaus; ausatmen, Bauch hinein. Gleich lang ein- und ausatmen (ca. 3-4 Sekunden).
-
Vollständige Yogaatmung - bei anstrengender körperlicher Bewegung; immer, wenn mehr Sauerstoff benötigt wird; bei äsanas und fortgeschrittenem prär:iäyäma.
TECHNIK: Einatmen, Bauch hinaus und Brust ausdehnen; aus atmen, Brust hinein und Bauch hinein. Wichtig: Atem bewegung solltefließend sein! Ausatmung doppelt so lang sam wie Einatmung.
Prär:,äyäma - die Yogaatmung
-
Kevala-kumbhaka bzw. Meditativer Atem ist eine Atemtech nik, bei der der Atem unforciert (z. B. während der Meditation) fast vollständig zur Ruhe kommt.
-
Einfache Atemübungen
-
Aufladeübung (im Stehen, Sitzen, liegen):*
TECHNIK: Auf Sonnengeflecht konzentrieren. Bewusst einat men (ca. 3-4 Sek.), Bauch hinaus, dabei Energie, Licht, Wärme zum Bauch schicken. Ausatmen, Bauch hinein (ca. 3-4 Sek.). Beim Ausatmen kann die Energie dahin geschickt werden, wo sie nötig ist. Diese Übung kann jederzeit gemacht und so oft wiederholt werden, wie man will.
-
Entspannender prär:iäyäma (im Stehen, Sitzen, liegen):
TECHNIK: 4 Sek. einatmen, 4 Sek. Luft anhalten, 8 Sek. ausat men, 4 Sek. mit leeren Lungen Luft anhalten.
-
Präl)äyäma (beim Gehen):
TECHNIK: Bauchatmung mit den Schritten verbinden. Ent weder gleiche Anzahl Schritte ein- und ausatmen oder dop pelt so lange ausatmen.
-
Prär:iäyäma (im stehen):
-
Ur;Jr;/Tyäna-bandha:
TECHNIK: Aufrecht stehen. Vollständig ausatmen, Knie leicht beugen, mit Händen das Gewicht auf die Knie geben, Bauch einziehen. Mit leeren Lungen den Atem solange anhalten, wie es bequen ist. Dann Bauch nach vorne lassen und ein atmen. Zwischenatmen. 2-4 Mal wiederholen. Am besten morgens nach dem Aufstehen.
-
Agni-sära:
TECHNIK: Wie bei u<;i<;iTyäna-bandha anfangen. Nach dem Aus atmen mit leeren Lungen Bauch nach vorne und zurück geben. So lange machen wie möglich, dann Bauch nach vorne geben und einatmen. 2-4 Runden machen. Am besten direkt im Anschluss an u<;i<;iTyäna-bandha.
-
Gorilla:*
TECHNIK: Vollständig einatmen, Brustkorb ausdehnen, dann Luft anhalten. Mit den Fingern auf Brustkorb trommeln. Dann Lippen schürzen und durch Mund stoßweise ausat men, bis Lungen leer. Dann u<;i<;iTyäna-bandha (Bauch einzie hen) solange wie bequem. Wieder vollständig einatmen und wiederholen. Beim zweiten Mal mit Handflächen auf den Brustkorb trommeln, beim dritten Mal mit den Fäusten.
-
-
Atmung zur Kontrolle des Niesreizes (im Gehen, Stehen, Sitzen, liegen):
TECHNIK: Vollständig und zügig einatmen. Extrem langsam und vollständig ausatmen. Wiederholen, bis Niesreiz ver schwunden.
-
-
Reinigungs-präQäyämas
1. Kapä/a-bhäti (Schnellatmung): (s. S. 159, 172)
TECHNIK: Mit gekreuzten Beinen hinsetzen. Wichtig: Rücken und Nacken gerade halten! Zügig mit dem Bauch ein- und
* Merke: Bei Blutdruckproblemen und Schwindel nur zu drei Vierteln einatmen!
113
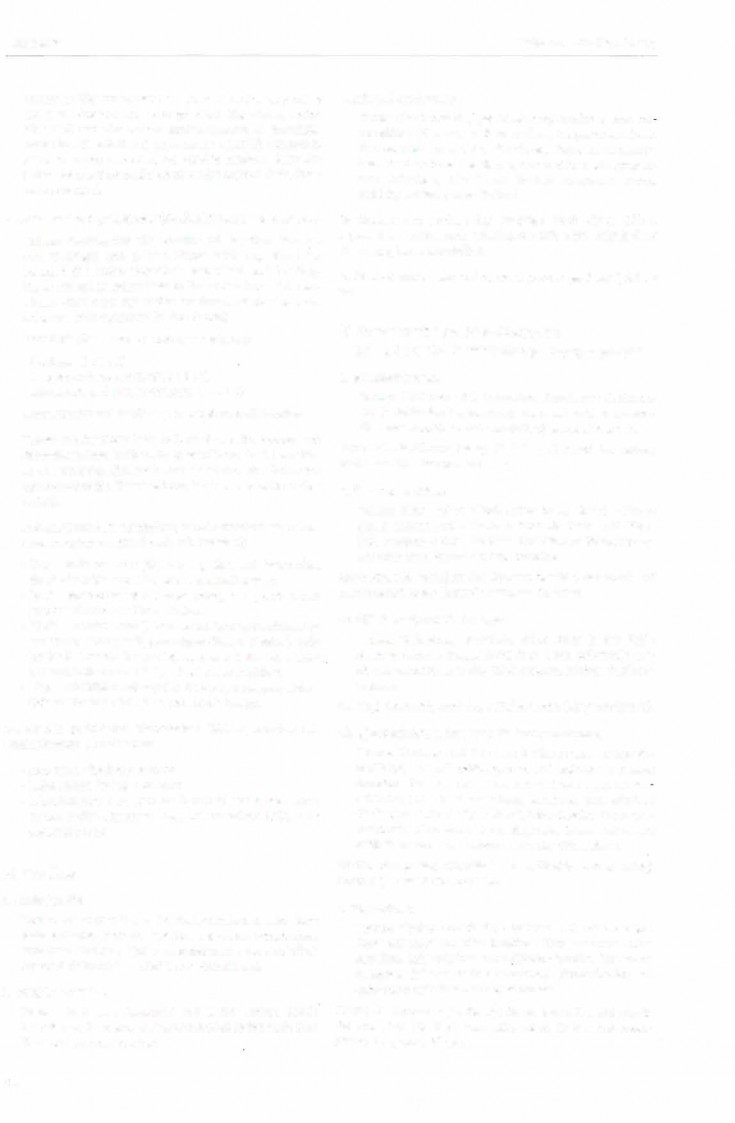
Hatha-yoga
ausatmen(Einatmung erfolgt entspannt und ca. doppelt so lange wie Ausatmung). Anfangs 20-30 Mal atmen, später bis auf 200 erweiterbar. Anschließend zwei tiefe Atemzüge, dann die Luft anhalten(Lungen zu 75% gefüllt). Ausatmen, wenn es unbequem wird. 3-5 Runden machen. Beim An halten kann miJ/a-bandha angewendet werden(kein jälan dhara-bandha).
6.Anuloma-vilama-präQäyäma(Wechselatmung) (s. S.159, 172)
TECHNIK: Nasenlöcher abwechselnd mit rechtem Daumen und Ringfinger und kleinem Finger schließen, wobei der Daumen das rechte Nasenloch verschließt und der Ring finger mit anliegendem kleinen Finger das linke. Links ein atmen, Atem anhalten, rechts ausatmen, rechts einatmen, anhalten, links ausatmen(= eine Runde).
Verhältnis(Einatmen : Anhalten : Ausatmen):
, Anfänger(1 : 1 : 2)
, fortgeschrittene Anfänger(1 : 2 : 2)
, Mittelstufe und Fortgeschrittene(1 : 4 : 2) Konzentration auf Reinigung der när;JTs oder äjfiä-cakra
TECHNIK mit bandhas: Beim Luftanhalten miJ/a-bandha und jälan-dhara-bandha üben. Fortgeschrittene: Auch beim Ein atmen miJ/a-bandha, nach dem Ausatmen vier Sekunden ur;Jr;JTyäna-bandha (Beschreibung der bandhas siehe weiter unten).
Samanu-TECHNIK(in Verbindung mit bija-mantras und cakra
Konzentration; eventuell auch mit bandhas):
, YArv1 - anähata-cakra(Herz-cakra), blau, Luft: Wind bläst durch alle när;JTs und bläst alle Unreinheiten weg.
, RArv1 - maQi-piJra-cakra(Nabel-cakra), orangerot, Feuer: Feuer verbrennt alle Unreinheiten.
' THArv1 - candra-cakra (Mond-cakra, über der rechten Au genbraue), silbrig weiß, gereinigtes Wasser(Nektar): Küh lender Nektar fließt hinunter, schwemmt alle Unreinhei ten und Aschen aus, kühlt, erfrischt, harmonisiert.
, LArv1 - miJ/ädhära-cakra(Wurzel-cakra), ockergelb, Erde: Erde macht alle när;JTs stark, beschützt, festigt.
-
-
Runden praktizieren. Verschiedene Weisen, mantras mit Wechselatmung zu verbinden:
-
, eine Runde für jeden mantra
, halbe Runde für jeden mantra
, links einatmen: YArv1, Luft anhalten: RArv1, rechts ausatmen: THArv1, rechts einatmen: LArv1, Luft anhalten: LArv1, links ausatmen: LArv1
-
-
Bandhas
-
Müla-bandha
TECHNIK: Zusammenziehen der Beckenbodenmuskeln. Kann beim Anhalten gemacht werden, bei vielen präQäyämas auch beim Einatmen. Zieht den präQa nach oben und öffnet SU$Umnä(feinstoffliche när;JT in der Wirbelsäule).
-
U<;i<;JTyäna-bandha
TECHNIK: Nach dem Ausatmen mit leeren Lungen Bauch hochziehen. Kann auch als Teil von mahäbandha nach dem Einatmen gemacht werden.
Prär:iäyäma - die Yogaatmung
-
Jälan-dhara-bandha
TECHNIK: Nach vollständiger Einatmung Brustkorb nach vor ne wölben, Kinn auf die Brust senken, Zungenoberseite an den Gaumen legen und zurückziehen, Kehle zusammenzie hen. Vor dem Ausatmen Kopf heben und Muskeln entspan nen. Schultern, Mund und Gesicht entspannt lassen. Wichtig: Rücken gerade halten!
Verhindert den Abfluss der Energien nach oben. Öffnet SU$Umnä im Kehlbereich. Erlaubt, die Luft nach vollständiger Einatmung lange anzuhalten.
-
Mahä-bandha - alle drei bandhas werden geichzeitig gehal ten.
-
-
Fortgeschrittene Atemübungen:
Die acht mahä-kumbhakas [vgl. Hatha(yoga)pradipikäl
-
BhrämarT(Biene)
TECHNIK: Einatmen mit Schnarchton, Ausatmen mit Summ ton (vollständige Yogaatmung). Kann mit oder ohne ban dhas bzw. kumbhaka(Atemanhalten) gemacht werden.
Entwickelt die Stimme, reinigt die Kehle, stimuliert den cakras,
verbessert die Atembeherrschung.
-
Sftaff und 3. sTtkärT
-
TECHNIK: Zunge rollen (sTta/T: spitze Rolle; sTtkärT: = Zunge gegen Zahnansatz), einatmen über die Zunge mit Zisch laut. Ausatmen über die Nase (vollständige Yogaatmung). Mit oder ohne kumbhaka bzw. bandhas.
Wirkt kühlend, reduziert den Appetit, beruhigt den Geist und harmonisiert außer Kontrolle geratene Energien.
4a. UjjäyT (geeignet für Anfänger)
TECHNIK: Vollständig einatmen, dabei Atem in der Kehle steuern, leichtes Geräusch machen. Dann vollständig aus atmen, dabei Atem in der Kehle steuern, leichtes Geräusch machen.
Beruhigt den Geist, erhöht die Vitalkapazität(Lungenvolumen).
4b. UjjäyT-kumbhaka(geeignet für Fortgeschrittene)
TECHNIK: Einatmen mit leichtem Geräusch durch beide Na senlöcher und mit miJ/a-bandha. Luft anhalten mit allen bandhas. Rechtes Nasenloch mit rechtem Daumen ver schließen und dabei vollständig ausatmen (mit leichtem Geräusch). Luft anhalten mit ur;Jr;JTyäna-bandha. Dann wie der durch beide Nasenlöcher einatmen. Konzentration auf mülädhära-cakra am unteren Ende der Wirbelsäule.
Erhöht den präQa, stimuliert das miJ/ädhära-cakra, reinigt
SU$umnä, erweckt die kuQr;ialinT.
-
Sürya-bheda
TECHNIK: Rechts vollständig einatmen mit miJ/a-bandha. Atem anhalten mit allen bandhas. Links ausatmen ohne bandhas. Luft anhalten mit udr;JTyäna-bandha. Von vorne beginnen (wieder rechts einatmen). Konzentration auf äjnä-cakra zwischen den Augenbrauen.
Erhöht die Feuerenergie. Reinigt die SU$Umnä. Erweckt kuQr;ia linT und zieht sie hoch zum äjfiä-cakra. Erhöht das präQa Niveau im ganzen Körper.
114
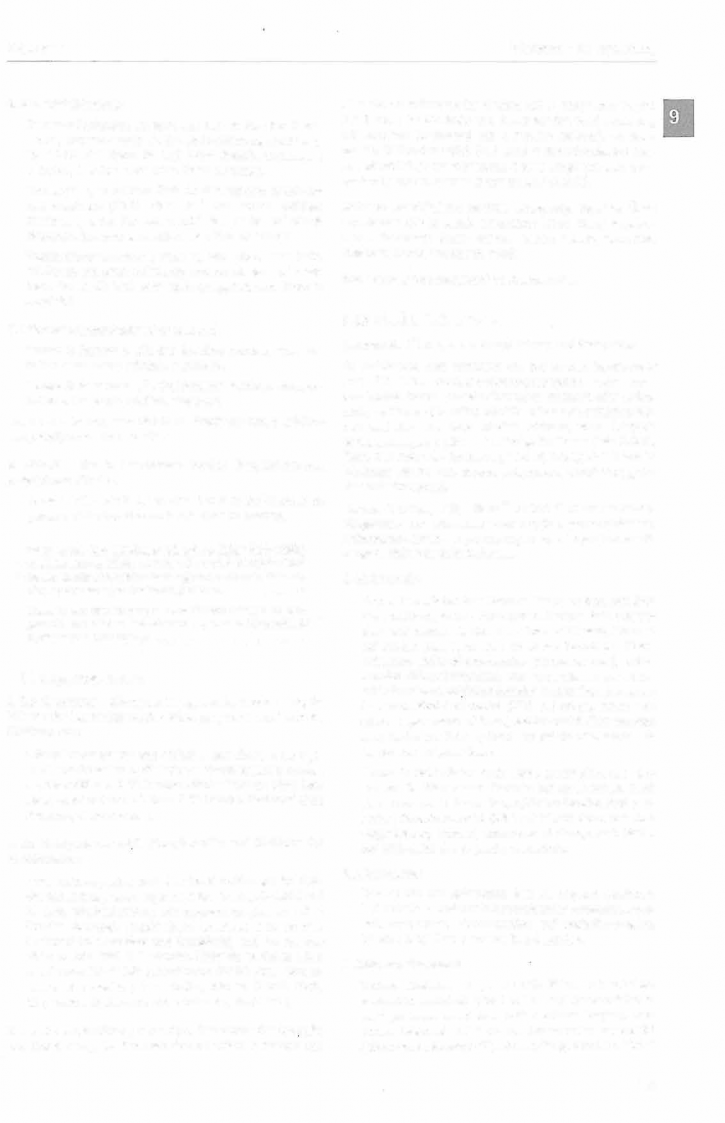
Hatha-yoga
-
Bhastrikii (Blasebalg)
TECHNIK (Mittelstufe): langsam und fest mit dem Bauch aus atmen, bequem einatmen. Ein- und Ausatmung gleich lang. Ca. 12-16 Mal. Dann die Luft (ohne Zwischenatmungen) anhalten, bandhas anwenden. Dann ausatmen.
TECHNIK (Fortgeschrittene, Stufe 1): Fest mit dem Bauch ein und ausatmen (12-20 Mal). Nach der letzten kräftigen Ausatmung linkes Nasenloch schließen, rechts vollständig einatmen, bandhas anwenden. Dann links ausatmen.
TECHNIK (Fortgeschrittene, Stufe 2): Wie oben, aber heftig mit Bauch und Brust vollständig und schnell ein- und ausat men. Ca. 12-40 Mal. Sehr stark energetisierend. Erweckt kw:l(;JalinT.
-
Mürcchii (ohnmachtähnlicher Zustand)
TECHNIK 1: Einatmen, alle drei bandhas machen, Atem an halten solange wie möglich, ausatmen.
TECHNIK 2: Ausatmen, alle drei bandhas machen, Atem an halten solange wie möglich, einatmen.
Um sie zu erlernen, lasse dich in der Praxis von einem erfahre nen prii(läyäma-Lehrer anleiten.
-
Plävinf - Nur in bestimmten Stadien fortgeschrittenen
prä(läyämas hilfreich.
TECHNIK: Luft schlucken, um dem Bauch mehr Volumen zu geben und die bandhas noch effektiver zu machen.
Merke 1: Wer fortgeschrittene prä(läyämas (ujjäyT, sürya-bheda, bhastrikä etc.) ausführen möchte, sollte vorher mindestens drei Runden kapäla-bhäti (Schnellatmung) und 15-20 Min. anuloma viloma-präoäyäma (Wechselatmung) machen.
Merke 2: Wer eine Neigung zu Mittelohrentzündungen, zu Lun genproblemen oder zu Bluthochdruck hat, sollte fortgeschrittene re praoäyämas nicht ausführen.
-
Übungsprogramme
-
-
Zur allgemeinen Hebung des Energielevels, Entspannung, Er höhung der Lungenkapazität, Vorbeugung von Heuschnupfen, Erkältung etc.:
, Grundatmungsarten und einfache Atemübungen ins tägli che Leben integrieren. Für jeden geeignet. Täglich 3 Runden kapä/a-bhiiti und 5-10 Runden Wechselatmung ohne ban dhas, eventuell anschließend 5-10 Runden bhriimarT ohne Anhalten, ohne bandhas.
-
Zur Reinigung der niidTs (Energiekanäle) und Erhöhung der Konzentration:
, Grundatmungsarten und einfache Atemübungen ins tägli che Leben integrieren. Täglich 3-5 Runden kapäla-bhäti und 20 Min. Wechselatmung mit bandhas (beginnend mit 4 Runden samanu). Anschließend eventuell 5-10 Runden bhrämaii (mit bandhas und kumbhaka) und 1-2 Runden einfache bhastrikä (Mittelstufe). Hilfreich: Tägliches Üben von äsanas (20-40 Min.), Meditation (20-30 Min.), vegeta rische Lebensweise (ohne Alkohol, Nikotin, Fleisch, Fisch, Eier, wenn möglich auch ohne Zwiebeln, Kno.blauch).
-
Zur starken Erhöhung von prä(la, Erweckung der ku(ldalinT
und Erweiterung des Bewusstseins: Grundatmungsarten und
Prär:iäyäma - die Yogaatmung
einfache Atemübungen ins tägliche Leben integrieren. Täglich 3-5 Runden kapä/a-bhäti und 20-40 Runden Wechselatmung mit bandhas (beginnend mit 4 Runden samanu). Anschlie ßend 5-15 Runden ujjäyT, 5-15 Runden sürya-bheda, 3-5 Run den bhastrikä (fortgeschrittene). Obiges Programm kann auch zweimal gemacht werden (morgens und abends).
Hilfreich: Anschließend mudräs. Notwendig: Tägliches Üben von äsanas (20-40 Min.), Meditation (20-30 Min.), vegetari sche Lebensweise (ohne Alkohol, Nikotin, Fleisch, Fisch, Eier, Zwiebeln, Lauch, Knoblauch, Pilze).
Siehe auch „Atmungssystem" im Anatomie-Teil.
-
-
Mudrä-Leiter 1-12
-
-
(mudräs sind Übungen zur Energieleitung und Erweckung)
Zu praktizieren nach Minimum von 3-6 Runden kapäla-bhäti und 20 Min. anuloma-viloma-prä(läyäma oder nach pascimottänäsana (vorwärtsbeugende Stellung) oder ardha matsyendräsana (Drehsitz). Mudräs sollten nur praktiziert wer den und sind nur dann wirklich wirksam, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: sattwige Ernährung (kein Fleisch, Fisch, Eier, Zwiebeln, Knoblauch, Alkohol, Tabak); täglich jeweils Minimum von 30 Min. äsanas, prä(läyäma, Meditation; guter Gesundheitszustand.
Genaue Anleitung nötig. Diese Übersicht dient nur als Erinne rungsstütze für Teilnehmer von ku(l<;ialinT-yoga-Seminaren, prä(läyäma-Kursen, Yogaschulungen und Yogalehrerausbil dungen, nicht zum Selbsterlernen.
-
Mahä-mudrä
TECHNIK 1: Zunächst linke Ferse an Perineum bzw. zwischen Geschlechtsorgan und Anus geben. Rechtes Bein ausstre cken. Mit beiden Händen an rechten Fuß fassen, Daumen auf großen Zeh. Nach dem Einatmen kumbhaka (Atem anhalten), Jälan-dhara-bandha (Kinnverschluss), müla bandha (Wurzelverschluss: Zusammenziehen der Anus schließmuskeln), u<;idTyäna-bandha (Hochziehen des Unter bauches), sämbhavT-mudrii (Blick auf tri-kutT, Raum zwi schen Augenbrauen, richten), nabho-mudrä (Zungenspitze nach hinten zur Kehle geben). 0()1 geistig wiederholen. 3- 12 Runden auf jeder Seite.
TECHNIK 2: Beide Beine nach vorne ausstrecken. Mit Hän den an die Füße fassen, Daumen auf große Zehen. Nach dem Ausatmen Luft anhalten, u<;i<;JTyäna-bandha, Kopf nach hinten. SämbhavT-mudrä (Blick auf tri-kutT, Raum zwischen Augenbrauen, richten), nabho-mudrä (Zunge nach hinten zur Kehle geben). 0()1 geistig wiederholen.
-
Asvinf-mudrii
TECHNIK: Sitz mit gekreuzten Beinen. Bequem einatmen. Luft anhalten. Mehrmals hintereinander Anusschließmus keln anspannen. Konzentration auf mülädhära-cakra. Mantra: LAfvl. Farbe: ockergelb. 1-3 Runden.
-
Müla-bandha-mudrii
TECHNIK: Einatmen, Lungen zu 90% füllen. Luft anhalten. Beckenbodenmuskeln (Geschlechts- und Anusschließmus keln) gut zusammenziehen. Halten solange bequem. Aus atmen. Mehrmals wiederholen. Konzentration auf svädhi
?thäna-cakra. Mantra: VAfvl. Farbe: silbrig. Bild: Mondsichel.
115
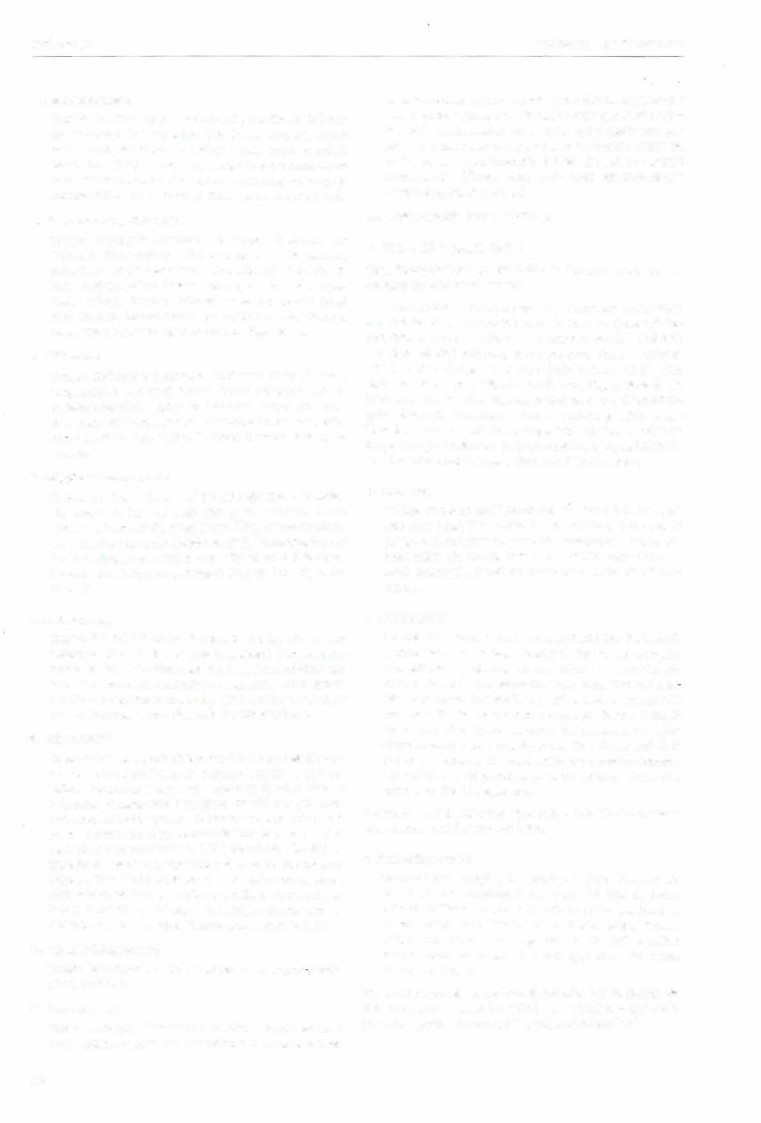
Hatha-yoga
-
Agni-sära-mudrä
TECHNIK: Im Sitzen Hände auf die Knie abstützen. Vollstän dig ausatmen. Luft anhalten (mit leeren Lungen). Mehr mals Bauch einziehen und wieder nach vorne drücken. Wenn die Luft nicht mehr angehalten werden kann, einat men. Mehrere Runden. Konzentration auf ma,:ii-p{Jra-cakra. Mantra: RAryl. Farbe: feuerrot. Bild: Flamme oder Dreieck.
-
Jä/an-dhara-bandha-mudrä
TECHNIK: Vollständig einatmen. Nach dem Einatmen Luft anhalten. Kinnverschluss (Kinn zum Brustbein hin senken) mit Zungen- und Kehlverschluss. Besonders stark Brust nach vorne wölben. Halten so lange wie angenehm. Dann ausat men. Mehrere Runden. Alternative: matsya-mudrä (Kopf nach hinten). Konzentration auf anähata-cakra. Mantra: YAryl. Farbe: blaugrau. Symbol: sechszackiger Stern.
-
Käki-mudrä
TECHNIK: Vollständig ausatmen. Kopf nach hinten beugen. Zungenspitze weit nach hinten. Bauch einziehen (wie in Ul;/<;/Tyäna-bandha). Halten so lange wie angenehm. Dann einatmen. Mehrere Runden. Konzentration auf visuddha cakra. Mantra: HAryl. Farbe: lila. Symbol: weißer Kreis in lila Dreieck.
-
U<;l<;/Tyäna-bandha-mudrä
TECHNIK: Im Sitzen Hände auf die Knie abstützen. Vollstän dig ausatmen. Luft anhalten (mit leeren Lungen). Bauch einziehen, Kinn auf die Brust setzen Uälan-dhara-bandha). Zungenspitze zur Kehle (nabho-mudrä). Konzentration auf das Hochsteigen des prä,:ia zum äjnä-cakra. 3-5 Runden.
Mantra: Oryl. Farbe: weiß. Symbol: Kreis im Dreieck, in der Mitte -:5b.
-
Nabho-mudrä
TECHNIK: Sitz mit gekreuzten Beinen. So wenig Luft ein- und ausatmen wie möglich (kevala-kumbhaka). Zungenspitze gegen die Mitte des Gaumens drücken. Konzentration auf sahasrära-cakra. Konzentration: Strahlendes Licht strömt von über der Schädeldecke in den Kopf. Oder: Guru sitzt im tausendblättrigen Lotos oberhalb der Schädeldecke.
-
Vajro/T-mudrä
TECHNIK (einfache Variation): Sitz mit gekreuzten Beinen (vor zugsweise nicht siddhäsana). Bequem einatmen. Luft an halten. Mehrmals Energie von unten nach oben ziehen: Folgendes hintereinander machen: Geschlechts-/Becken bodenmuskeln von vorne nach hinten und von unten nach oben zusammenziehen, Anusschließmuskeln von unten nach oben zusammenziehen. Mit Bewusstsein die W irbel säule hoch wandern. Zungenoberseite gegen den Gaumen drücken. Zum Punkt zwischen den Augenbrauen schauen. Aufmerksamkeit zum sahasrära-cakra. Kann auch beim An halten in der Wechselatmung, bei einigen äsanas und zur Sublimierung der sexuellen Energie angewandt werden.
-
Viparrta-kara{Ji-mudrä
TECHNIK: Sarvängäsana mit khecar'i-mudrä und ujjäyT prä,:iä yäma; 5-10 Min.
-
KhecarT-mudrä
TECHNIK 1 (einfache Variation): Kopf leicht oder stärker nach hinten legen. So wenig Luft wie möglich ein- und ausatmen
Prär;äyäma - die Yogaatmung
(keva/a-kumbhaka). Zunge nach hinten falten, Zungenspitze den Gaumen entlang so weit nach hinten geben wie mög lich. Bei geschlossenen Augen oder leicht geöffneten Au gen durch den Punkt zwischen den Augenbrauen senkrecht nach oben schauen. KhecarT bedeutet „die sich am Himmel Bewegende". (Übung kann auch nach viparTta-kara,:iT mudrä ausgeführt werden.)
-
Keva/a-kumbhaka mit Meditation
-
Bhastrikä-mudrä-Reihe
(Eine fortgeschrittene mudrä-Reihe zur Energieerweckung und Erweiterung des Bewusstseins)
Diese mudrä-Reihe ist nur zu praktizieren nach einem Minimum von 3-6 Runden kapäla-bhäti und 20 Min. anuloma-viloma prä,:iäyäma. Mudräs sollten nur praktiziert werden und sind nur dann wirklich wirksam, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: sattwige Ernährung (kein Fleisch, Fisch, Eier, Zwiebeln, Knoblauch, Alkohol, Tabak etc.); täglich jeweils ein Minimum von 30 Min. äsanas, prä,:iäyäma und Meditation; guter Gesundheitszu-stand. Genaue Anleitung nötig. Diese Übersicht dient nur als Erinnerungsstütze für Teilnehmer von ku,:i<;lalinT-yaga-Seminaren, prä,:iäyäma-Kursen, Yogaschulungen und Yogalehrerausbildungen, nicht zum Selbsterlernen.
Grundprinzip
TECHNIK: Erst 8-12 Mal bhastrikä-Atem. Dann 5-8 Mal agni sära oder nauli. T ief einatmen, Luft anhalten, in die mudrä gehen. Luft anhalten so lange wie angenehm. Dann ausat men, dabei die mudrä verlassen. 5-8 Mal agni-sära oder nauli. Eventuell 1-2 Mal zwischenatmen. Dann die nächste Runde.
-
Mahä-mudrä
TECHNIK: Linke Ferse unter den kanda-Punkt (am Perineum). Rechtes Bein ausstrecken. Oberkörper leicht nach links dre hen. Mit beiden Händen auf den linken Oberschenkel ab stützen. Erst 8-12 Mal bhastrikä-Atem. Dann 5-8 Mal agni sära oder nau/i. Tief einatmen, Luft anhalten, Oberkörper von der Hüfte her nach vorne beugen. Mit beiden Händen an rechten Fuß fassen, Daumen auf großen Zeh. Jälan dhara-bandha oder khecarT-mudrä. Zum Punkt zwischen den Augen schauen. Eventuell m[J/a- und u<;l<;/Tyäna-bandha. Luft anhalten so lange wie angenehm. Dann ausatmen und aufrichten. 5-8 Mal agni-sära.
2-4 Runden auf dieser Seite. Dann Seite wechseln und genauso viele Runden auf der anderen Seite.
-
Sakti-cälanT-mudrä
TECHNIK: Wenn möglich, in padmäsana (Lotosstellung) sit zen. 8-12 Mal bhastrikä-Atem. Dann 5-8 Mal agni-sära oder nau/T. T ief einatmen, Luft anhalten. Alle drei bandhas setzen. Hände oder Fäuste auf den Boden geben. Becken heben und senken, so lange wie du die Luft anhalten kannst. Dann ausatmen, 5-8 Mal agni-sära oder nauli. Mache 2-5 Runden.
Eventuell anschließend mahä-vedha-mudrä (wie 2., jedoch die Hände am Boden lassen bei gehobenem Gesäß ). Mahä-vedha bedeutet „großer Durchbruch", ,,großes Durchstoßen".
116
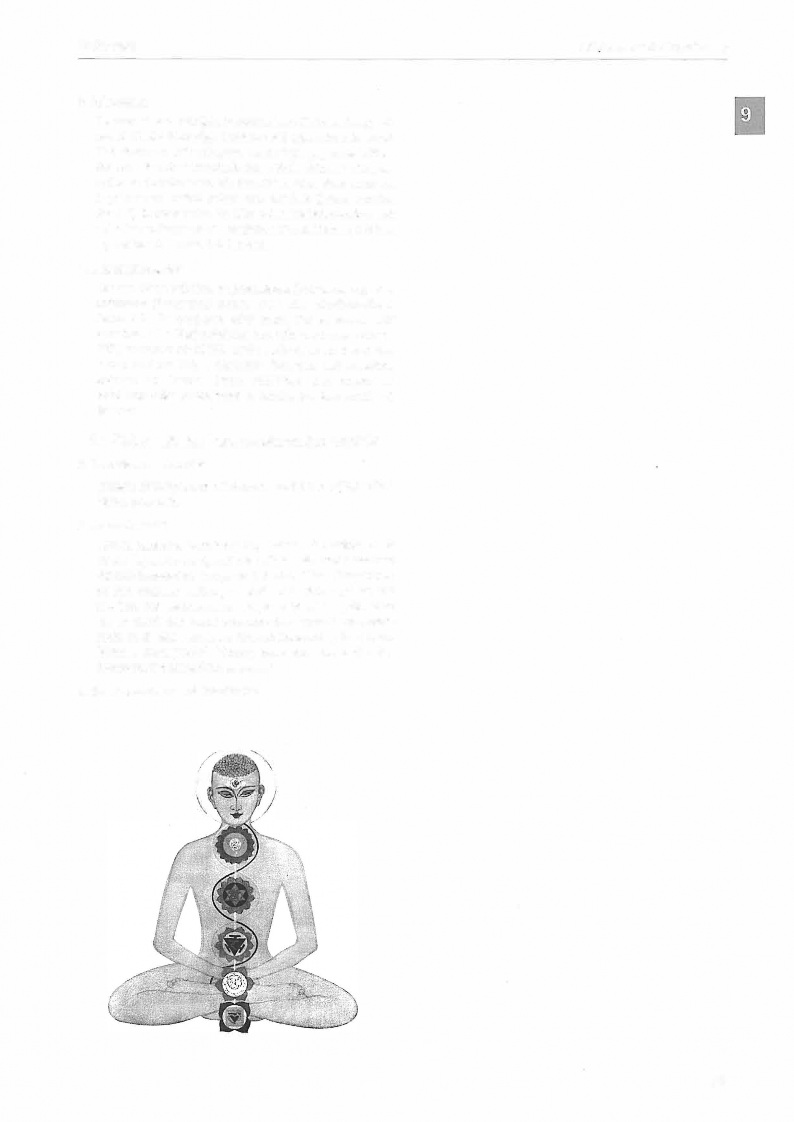
Hatha-yoga Pränäyäma - die Yogaatmung
-
Lo/a-mudrä
TECHNIK: Wenn möglich, in padmäsana (Lotosstellung) sit zen. 8-12 Mal bhastrikä. Dann 5-8 Mal agni-sära oder nauli. Tief einatmen, Luft anhalten. Acht Finger gegen die Mittel linie des Bauches unterhalb des Nabels drücken. Zungen spitze an den Gaumen. Mit den Augen nach oben schauen. Kopf vor und zurück geben bzw. pendeln (/o/aka bedutet Pendel). Konzentration im äjnä- oder sahasrära-cakra. Luft anhalten so lange wie angenehm. Dann ausatmen, 5-8 Mal agni-sära oder nauli. 2-5 Runden.
-
BhujanginT-mudrä
TECHNIK: Wenn möglich, im padmäsana (Lotosstellung) oder vajräsana (Fersensitz) sitzen. 8-12 Mal bhastrikä-Atem. Dann 5-8 Mal agni-sära oder nau/i. Tief einatmen, Luft anhalten. Wer Bluthochdruck hat, füllt die Lungen nur zu 80%, andere zu 90-100%. Hände nach vorne auf den Boden geben und zur Kobra, bhujanga, kommen. Luft anhalten, solange du kannst. Dann ausatmen und zurück zu vajräsana oder padmäsana kommen. 5-8 Mal nau/i. 2-5 Runden.
-
Schließen mit den harmonisierenden mudräs
-
-
ViparTta-karar:,T-mudrä
TECHNIK: sarvängäsana mit khecar1-mudrä und ujjäy1-prär,ä yäma. 5-10 Min.
-
KhecarT-mudrä
TECHNIK (einfache Variation): Kopf leicht oder stärker nach hinten legen. So wenig Luft wie möglich ein- und ausatmen (keva/a-kumbhaka). Zunge nach hinten falten, Zungenspit ze den Gaumen entlang so weit nach hinten geben wie möglich. Bei geschlossenen Augen oder leicht geöffneten Augen durch den Punkt zwischen den Augenbrauen senk recht nach oben schauen. KhecarT bedeutet „die sich am Himmel Bewegende". (Übung kann auch nach vipartta karar,T-mudrä ausgeführt werden.)
-
Keva/a-kumbhaka mit Meditation
-·---
\
'
1 1
1
'
117
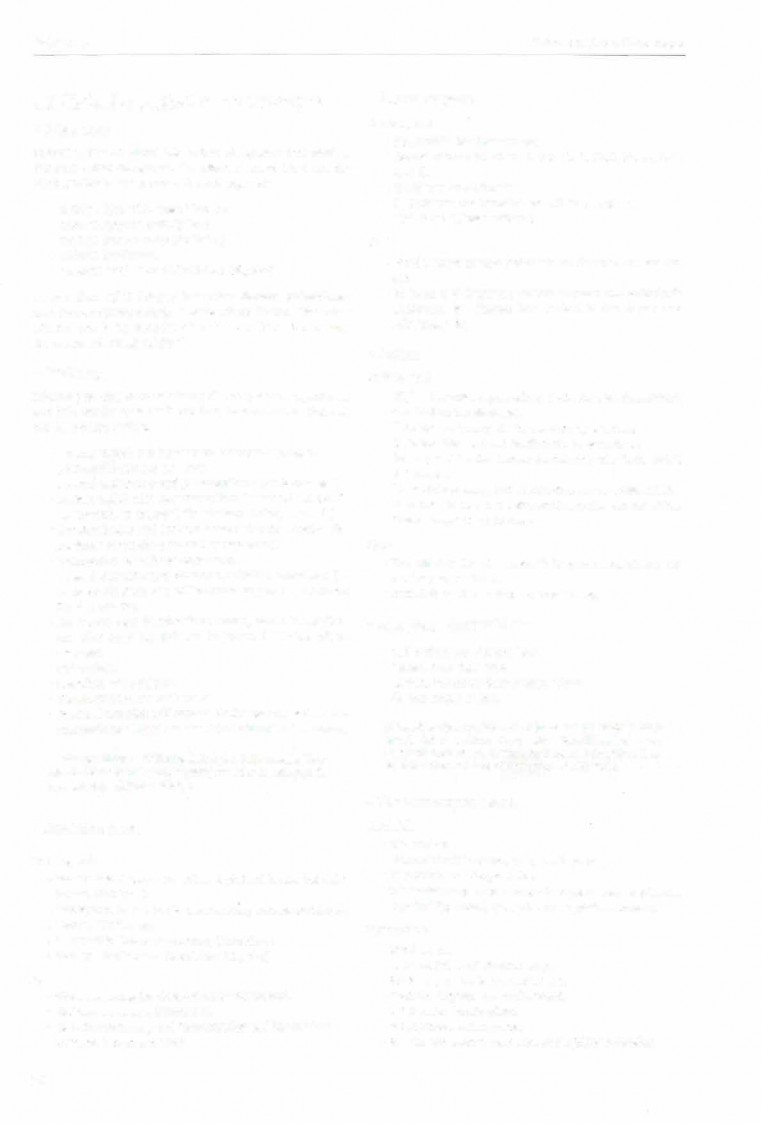
Hatha-yoga
9.5 Einfache yogische Hausrezepte
-
Allgemein
Yoga sagt, dass eine kombinierte Beachtung aller fünf Praktiken des hatha-yoga den ganzen Organismus harmonisiert und da mit beste Vorbeugung gegen Erkrankungen ist:
, Richtige Körperübungen (äsonas).
, Richtige Atmung (prä(läyäma).
, Richtige Entspannung (saväsäna).
, Richtige Ernährung.
-
Positives Denken und Meditation (dhyäna).
In speziellen Fällen können besondere tisanas, prti(läytimas und Konzentrationstechniken Anwendung finden. Wer aber wirklich krank ist, braucht eine fachkundliche Behandlung durch Arzt oder Heilpraktiker!
-
-
Erkältung
Erkältung ist eine gute Reinigung für den ganzen Organismus und hilft, wieder neue Kraft und Energie aufzutanken. Ruhe ist hier besonders wichtig.
, Dreimal täglich mit lauwarmem Salzwasser gurgeln (½ Teelöffel Salz auf 0,2 Liter).
, Dreimal täglich ja/a-netT (Nasenspülung mit Salzwasser).
, Dreimal täglich mit Wasserdampf inhalieren (evtl. mit Kamil le, Thymian, Teebaumöl, Tigerbalsam, Eukalyptus o. ä.).
, Vorwärtsbeuge und Drehsitz lange halten (bei starker kör perlicher Schwäche oder Fieber weglassen).
, Prä(läyäma, so weit wie angenehm.
, liegender prä(läytima: Einatmen, anhalten, ausatmen, je weils so langsam wie vollkommen angenehm, mehrere Runden am Tag.
, Mit Frucht- oder Gemüsesäften fasten, falls nicht möglich: nur Obst oder nur Rohkost, in jedem Fall keine Milch produkte.
-
Viel trinken.
-
Ausruhen, viel schlafen.
-
Tiefenentspannung mehrmals.
-
Eventuell natürliches Vitamin C, Echinacea und andere im munstärkende Mittel aus der Naturheilkunde einnehmen.
Merke: Manchmal ist Erkältung einfach eine Reinigung des Orga nismus oder eine Gelegenheit, geistig zur Ruhe zu kommen, die man als solche willkommen heißt.
-
-
Kopfschmerzen
Vorbeugend:
-
Regelmäßig äsanas, besonders Kopfstand (außer bei sehr hohem Blutdruck).
, Prä(läyäma, besonders Wechselatmung (anuloma-viloma).
-
Richtige Ernährung.
-
Regelmäßig Tiefenentspannung (saväsäna).
-
Positives Denken und Meditation (dhytina)
Akut:
-
Wechselatmung (anuloma-viloma-prä(läytima).
-
-
Tiefenentspannung (saväsäna).
-
Tiefe Bauchatmung und Konzentration auf Energiefluss zwischen Bauch und Kopf.
Einfache yogische Hausrezepte
-
-
Heuschnupfen
Vorbeugend:
-
Regelmäßig Wechselatmung.
-
Asanas, die den Brustkorb dehnen (z. B. Fisch, Kobra, Halb- mond).
-
-
Ernährung ohne Zucker.
-
-
Reduzierung des Verzehrs von Milchprodukten.
, Täglich neu (Nasenspülung).
Akut:
-
Mit der Zungenspitze mehrmals am Gaumen entlang fah ren.
-
So lange tief einatmen, extrem langsam und vollständig ausatmen, bis Niesreiz bzw. Jucken in den Augen ver schwunden ist.
-
-
Asthma
Vorbeugend:
-
Täglich 3 Runden kapä/a-bhäti, 10-20 Min. Wechselatmung und 10 Runden bhrämarT.
-
Tiefe Bauchatmung als Normalatmung erlernen.
-
Auf alles Süße und auf Milchprodukte verzichten.
-
Asanos, welche die Lungen ausdehnen, wie Fisch, Kobra, Halbmond.
-
Tiefenentspannung und Meditation, um zu entspannen.
-
Positives Denken und Lebensphilosophie, um mit Stress besser umgehen zu können.
Akut:
-
-
Tief mit dem Bauch atmen. Nicht versuchen, oberen Teil der Lungen zu füllen.
-
Arzt/Heilpraktiker aufsuchen bzw. fragen.
-
-
-
Allergien, Hautprobleme
-
Rohkostkur, 1-3 Monate lang.
-
Fasten, 5-10 Tage lang.
-
Lernen, mit Stress besser umzugehen.
-
Asanas länger halten.
Merke: Wer intensiv mit Yoga beginnt oder seine Praktiken inten siviert, kann vorübergehend eine Verschlimmerung von Hautproblemen etc. als Zeichen der Entgiftung feststellen. Nach einer Weile können dann alle Symptome verschwinden.
-
-
Verdauungsprobleme
Durchfall:
-
Viel trinken.
-
Monodiät mit braunem Reis, 1-8 Tage lang.
-
Vorwärtsbeuge länger halten.
-
Wechselatmung ohne bandhas in angenehmem Rhythmus.
-
Regelmäßig dhauti, agni-sära und u<;J<;JTyäna-bandha.
Verstopfung:
-
-
Viel trinken.
-
Rohkostdiät, 1-12 Wochen lang.
-
-
Rückbeugen wie Kobra und Bogen.
-
Drehsitz. Kopfstand. Schulterstand.
-
3-6 Runden kapäla-bhäti.
-
Prä(läyämas mit bandhas.
-
-
-
Regelmäßig dhauti, agni-sära und w;ir;/Tyäna-bandha.
118
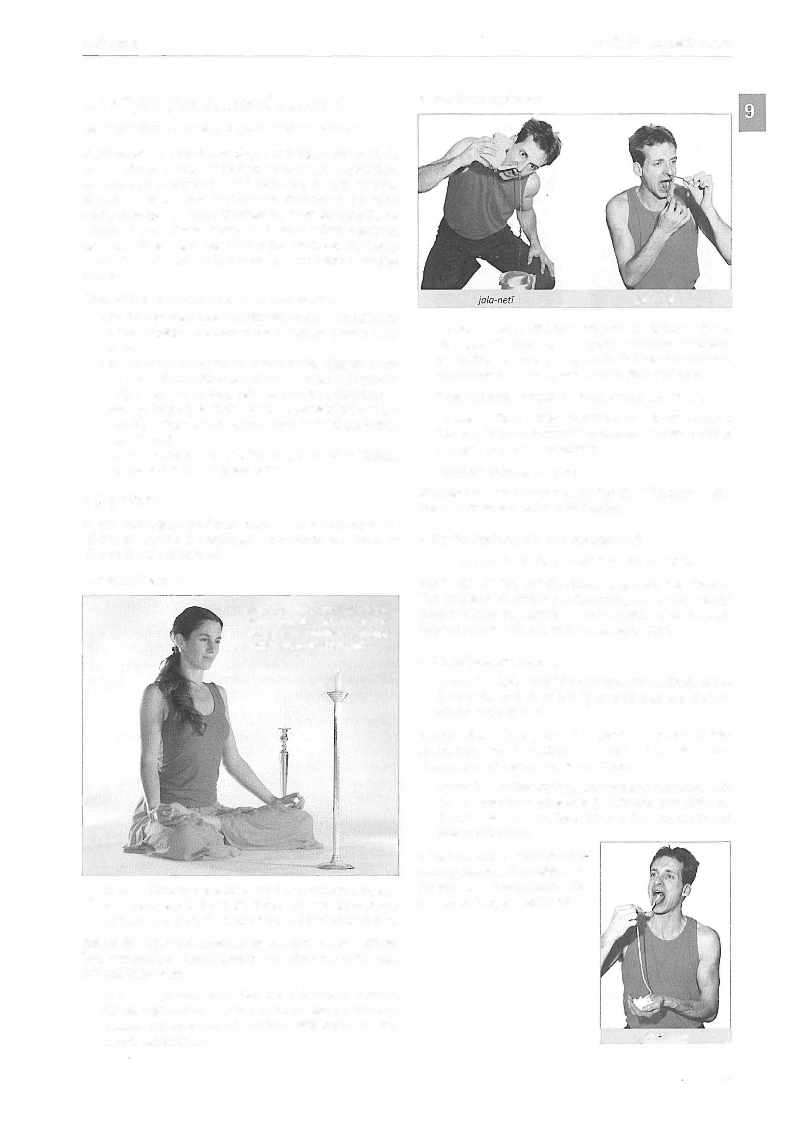
Hatha-yoga Kriyäs (Reinigungsübungen)
-
-
Kriyäs (Reinigungsübungen)
(vgl. Swami Vishnu-devananda, ,,Das große illustrierte Yogabuch")
Kriyas helfen, den physischen Körper zu reinigen, indem sie die Ausscheidungssysteme des Körpers anregen und unterstützen. Der menschliche Körper ist keine Maschine, die man regelmä ßig sauber machen muss. Der Körper ist vielmehr ein sich selbst reinigendes System. Durch Überlastung durch Schadstoffe, fal
-
sche Ernährung, Stress, Altern etc. kann es jedoch passieren, dass der Körper nicht alle Stoffwechselprodukte, Schlacken, Fremdkörper etc. ausscheiden kann. Hier sind kriyas besonders hilfreich.
Kriyas sind in folgenden Fällen besonders wichtig:
-
Neti'(Nasenreinigung)
sütra-netf
-
Ernährungsumstellung (Entgiftungsprozesse, Umstellungs schwierigkeiten und Entzugserscheinungen werden redu ziert).
-
Beginn intensiver Yogapraxis (Reinigung des physischen Kör pers lässt die Yogaübungen schneller wirken und lässt den pra,:w schneller fließen), insbesondere bei prar,ayama.
-
Geistige Trägheit, Faulheit, Müdigkeit, Antriebslosigkeit, De pression (körperliche Vergiftung kann zu geistigen Proble men führen).
-
Bei allen Arten von Krankheiten (es gibt in Indien Kliniken, die hauptsächlich mit kriyas heilen).
-
Sat-kriyäs
In der „Hatha(yoga)pradipika" werden sechs (?at) kriyas be schrieben. Sie sind die wichtigsten der kriyas, von denen es aber noch viele weitere gibt.
1. Trataka (Starren)
Merke: Trätaka nur ausführen, wenn auch die anderen Augen übungen regelmäßig gemacht werden. Nicht übertreiben!
TECHNIK 1 (Kerzenschau): Kerze mind. 1 m entfernt. 1-30 Min. lang ausbauen: Erst auf die Kerze schauen, dann Augen schließen und Nachbild beobachten. 1-5 Mal wiederholen.
Reinigt die Augen und entwickelt die Sehkraft. Beseitigt Müdig keit, entwickelt die Konzentration und öffnet das dritte Auge (tri-kutT; aji'ia-cakra).
TECHNIK 2 (Nasenschau): Auf die Nasenspitze starren. Aktiviert aji'ia-cakra. Zum Punkt zwischen den Augenbrauen schauen (sambhavT-mudra). Aktiviert aji'ia-cakra und ent wickelt Hellsichtigkeit.
TECHNIK 1 - Jala-netT (Nasenreinigung mit Salzwasser): Mit Kännchen für Nasenspülung (Iota) lauwarmes Salzwasser (½ Teelöffel Salz auf 0,2 Ltr.) durch die Nase rinnen lassen. Oder Salzwasser aus irgendeinem Gefäß hochziehen.
VARIATION: Kaltes Wasser aus hohler Hand hochziehen.
TECHNIK 2-Sütra-neti{Nasenreinigung mit einem Faden): In Wachs getränkten Baumwollfaden durch die Nase schieben und aus der Kehle herausziehen.
VARIATION: Katheter verwenden.
Stimuliert Selbstreinigung und aktiviert die Reflexzonen in den Nasendurchgängen. Aktiviert aji'ia-cakra.
-
-
-
Kapala-bhati (Schnell- bzw. Feueratmung)
TECHNIK : 20 bis 200 Mal schnell aus- und einatmen.
Reinigt die Lungen, löst die Ablagerungen auf den Alveolen (Lungenbläschen). Erhöht den Sauerstoffgehalt im Blut. Reinigt damit alle Zellen des Körpers. Regeneriert, lädt auf und verjüngt. Aktiviert Sonnen-geflecht, macht einen klaren Kopf.
-
Dhauti (Magenreinigung)
TECHNIK 1 - hrd-dhauti (Magenreinigung): Mullbinde von 4- 5 cm Breite und bis zu 5 m Länge schlucken und langsam wieder herausziehen.
Braucht einige Übung, um beherrscht zu werden. Reinigt Speiseröhre, beugt Erkältung und Husten vor, reinigt den Magen. Nur mit leerem Magen ausführen!
TECHNIK 2 - kufijara-kriya (Magenreinigung mit Salzwasser): 1-2 Ltr. lauwarmes Salzwasser (1 gestrichener Esslöffel auf 1 Ltr. Wasser) trinken. Zwei Finger in den Hals geben und Wasser erbrechen.
Reinigt den Magen. Hilft allen Ver dauungsorganen. Normalisiert die Funktion aller Schleimhäute. Nur mit leerem Magen ausführen!
hrddhauti _J
119
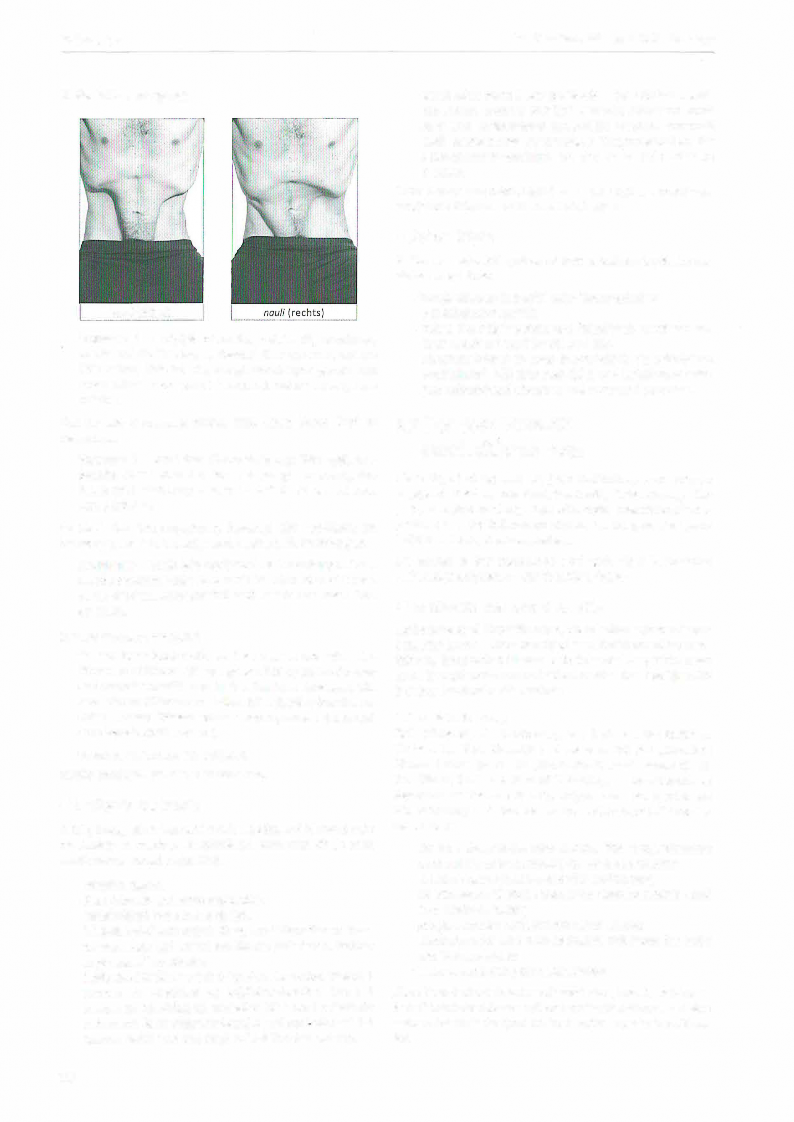
Hatha-yoga
-
Nauli (Darmreinigung)
nauli (Mitte)
VORÜBUNG 1 - ur;ic;fiyäna-bandha: Vollständig ausatmen, Hände auf die Knie legen, Gewicht über die Arme auf die Knie geben, Knie leicht gebeugt. Oberkörper gerade und etwas höher als waagerecht. Bauch einziehen, so lange wie möglich.
Gut für alle Verdauungsorgane. Hilft, einen klaren Kopf zu bekommen.
VORÜBUNG 2 - agni-sära (Feuerreinigung): Wie ur;ir;JTyäna bandha, aber anstatt den Bauch eingezogen zu lassen, den Bauch mit leeren Lungen abwechselnd einziehen und nach vorne drücken.
Aktiviert das Sonnengeflecht, beseitigt alle Probleme im Verdauungsbereich. Beseitigt auch emotionelle Spannungen.
HAUPTüBUNG - nauli: Wie ur;ir;JTyäna-bandha anfangen. Dann gerade Bauchmus-kein als zentrale Bauchmuskelwulst nach vorne drücken. Abwechselnd nach rechts und nach links schieben.
-
Basti (Enddarmreinigung)
TECHNIK: Eingefettetes dünnes Darmrohr in den After ein führen. In hüfthohes Wasser gehen. Mit ur;ir;JTyäna-bandha und zentraler nauli Wasser in den Enddarm einsaugen. Mit agni-sära im Dickdarm verteilen. Mit ur;ir;JTyäna-bandha bei vollen Lungen Wasser wieder herauspressen (eventuell auch kapä/a-bhäti machen).
VARIATION: Einlauf mit Einlaufgerät.
Reinigt Enddarm. Gut gegen Verstopfung.
-
Häufigkeit der kriyäs
Es ist günstig, alle kriyäs eine Weile lang (ca. 3-6 Monate) sehr regelmäßig zu machen. Anschließend kann man sie je nach individuellem Bedarf reduzieren.
-
Trätaka: Täglich.
, NetT: Jala-netT und sutra-netT täglich.
, Kapäla-bhäti: 3-5 Runden täglich.
, Dhauti: hrd-dhauti täglich üben, um Würgreflex zu über winden. Dann auf einmal pro Woche reduzieren. Kufijara kriyä einmal pro Woche.
, Ur;lr;JTyäna-bandha: Täglich 3 Runden. Agni-sära: Täglich 3 Runden im Anschluss an ur;ir;JTyäna-bandha. Nauli: 3 Runden im Anschluss an agni-sära. Wer nau/T vollständig beherrscht, kann ur;lr;JTyäna-bandha und agni sära auf 1-2 Runden reduzieren und nauli auf 3-5 Runden steigern.
Der YOGA V1ovA-Stil - ganzheitlicher yoga
, Basti: Echte basti: 1 Mal pro Woche. Oder Einlauf 1 Mal pro Monat. Wichtig: Wer Einlauf macht, sollte auch agni sära und kufijara-kriyä regelmäßig machen, eventuell auch asvinT-mudrä (mehrmaliges Zusammenziehen der Anus-Sphinkter-Muskeln), um den Darm nicht träge zu machen.
Beim Fasten: Alle kriyäs täglich oder fast täglich auszuführen, erhöht die Effizienz des Fastens beträchtlich.
-
-
Neben-kriyäs
Neben den $Ot-kriyäs gibt es zahlreiche weitere kriyäs. Zu den einfachen gehören:
, Zunge schaben mit Löffel oder Zungenschaber.
, Mit Salzwasser gurgeln.
-
Zähne mit Finger putzen und Zahnfleisch massieren mit einer Mischung aus Olivenöl und Salz.
, BhrämarT (Biene) ist zwar hauptsächlich ein prä,:,äyäma (Atemübung), hilft aber auch Kehle und Luftröhre zu reini gen: Schnarchend einatmen und summend ausatmen.
-
-
-
Der YoGA V1ovA-Stil - ganzheitlicher yoga
Diese Yogarichtung kann an jede Zielrichtung bzw. -gruppe angepasst werden, wie Kraft/Flexibilität, Entspannung, Hin gabe, Energieerweckung, Psychotherapie, medizinisch/thera peutisch u. a. Der hatha-yoga wird als Teil des gesamten ganz heitlichen Yogasystems angesehen.
Die äsanos in der Yogastunde sind nach einer bestimmten Reihenfolge aufgebaut - der YOGA VIDYA-Reihe.
-
Bandbreite des YOGA V1DYA-Stils
Hatha-yoga sind Körperübungen, die in Indien entwickelt wur den. Man kann sie unter verschiedenen Gesichtspunkten prak tizieren. Entsprechend lassen sich folgende Hauptrichtungen bzw. Hauptyogastile unterscheiden, welche der YoGA VIDYA-Stil in seiner Bandbreite alle umfasst:
-
Sportliche Richtung
Ziel ist hierbei, die Entwicklung von Kraft und Flexibilität zu fördern. Im YOGA V1DYA-Stil gibt es zum Beispiel „Sukadevs Fitness-Reihe" (auch als „Hanumän-Fitness" bekannt) für Konditions-, Kraft- und Flexibilitätstraining. In dieser intensiven Yogareihe wurden die Grundprinzipien aus dem sportlichen Fitnesstraining und dem klassischen hatha-yoga miteinander verbunden:
-
20 Min. dynamische Sonnengrüße (für Fortgeschrittene auch mit Sprungvariationen) für Konditionstraining
, 10 Min. anstrengende äsanas für Krafttraining
, 30 Min. sanft gehaltene äsanas für Flexibilitätstraining und Koordinationstraining
, prä,:,äyäma zum Aufladen mit neuer Energie
-
Meditation für eine tiefe spirituelle Erfahrung der Ruhe und Verbundenheit
-
Tiefenentspannung zur Regeneration
-
,,YOGA V1ovA-Bodywork-Partner-Asanas" und „YOGA VIDYA-Fitness Reihe" beinhalten äsanas mit fordernden Variationen und sind weitere Beispiele für sportlich-fordernden yoga im YOGA V1DYA Stil.
120
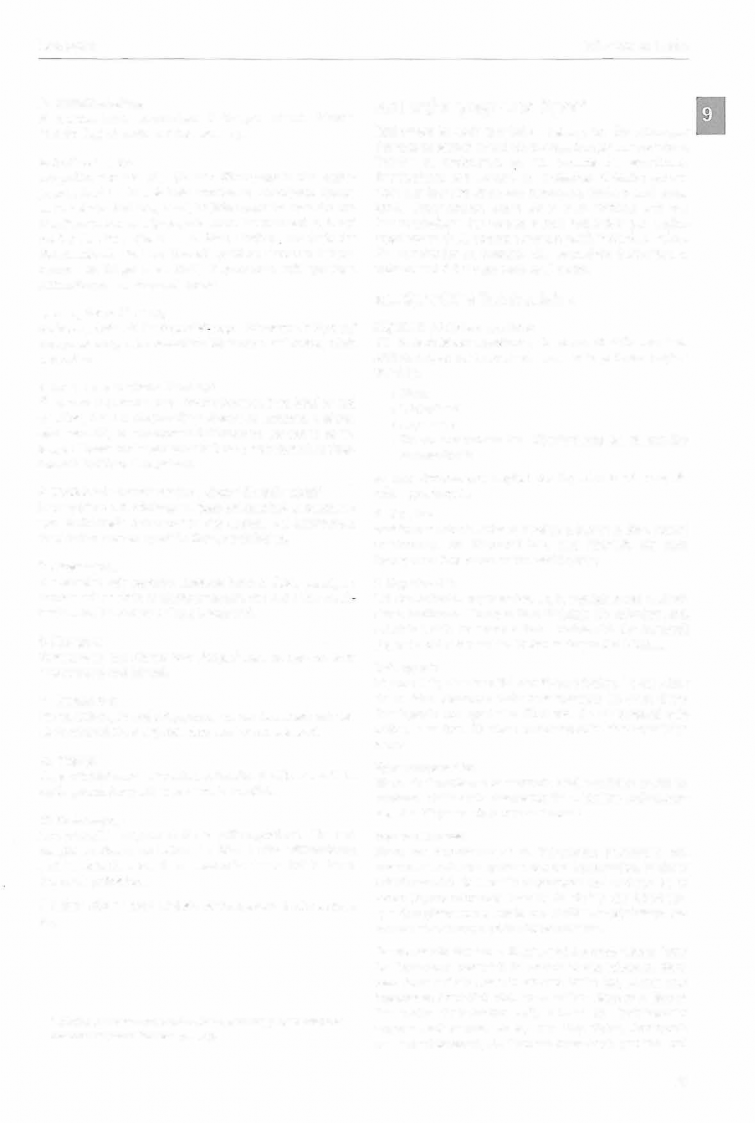
Hatha-yoga
-
Entspannungsyoga
Es werden keine schwierigen Stellungen erlernt. Schwer gewicht liegt vielmehr auf Entspannung.
-
Spiritueller yoga
Integration von bhakti-, raja- und jfiana-yoga in den hatha yogo-Unterricht. Zum Beispiel werden im bhakti-yoga asanas als Hingabe zu Gott aufgefasst; imjfiana-yoga löst man sich von Identifikationen; im raja-yoga konzentriert man sich z. B. auf bestimmte Affirmationen oder Eigenschaften. Innerhalb der Variationsbreite des YOGA V1ovA-Stils gehören dazu zum Beispiel asanas als Hingabe zu Gott, Yogastunden mit geistigen Affirmationen, zur Herzensöffnung.
-
Energetische Richtung
Hatha-yoga als Teil des kur_Jc;JalinT yoga. Schwerpunkt liegt auf Energiewirkungen, insbesondere Wirkungen auf pra(_)a, nac;JTs und cakras.
-
Psychotherapeutische Richtung*
Asanas als körperorientierte Psychotherapie. Dem Schüler wird geholfen, tiefer in die jeweiligen asanas zu kommen. Dadurch wird versucht, an unbewusste Schichten im Menschen zu ge langen. Dieser Zweig wird innerhalb der psychologischen Yoga therapie bei YOGA V1ovA gelehrt.
-
Medizinisch-therapeutische Richtung (Yogatherapie)*
Dazu gehören z. B. Rückenyoga, Yoga bei spezifischen Beschwer den, individuelle Anpassungen der asanas. Bei bestimmten Krankheiten werden spezielle asanas empfohlen.
-
Mantra-yoga
Yogastunden mit mantras. Mantras können dabei gesungen, rezitiert oder geistig wiederholt werden, mit und ohne Musik begleitung. Besonders tief und berührend.
-
Klangyoga
Yogastunden mit Einsatz von Klangschalen, Gongs etc. Sehr entspannend und lösend.
-
Hormonyoga
Die Yogaübungen und prär_Jayamas wirken besonders auf den Hormonhaushalt. Energetisierend und harmonisierend.
-
Yinyoga
Das sanfte statische Dehnen in bestimmten Positionen steht im Vordergrund. Auch mit Einsatz von Hilfsmitteln.
-
Businessyoga
Alltagstauglich abgewandelte Yogaübungsreihen, die zum Beispiel im Stehen und Sitzen, im Büro, in Geschäftskleidung geübt werden können. Einsatz besonders in der betrieblichen Krankheitsprävention.
Daneben gibt es noch Kinder-, Schwangeren-, Senioren-yoga etc.
* Merke: Für bestimmte Aspekte dieser Richtung gibt es juristische Einschränkungen (Heilpraktikergesetz).
Hatha-yoga und Sport
-
-
-
Hatha-yoga und Sport
Hatha-yoga ist auch sportliches Training. Um die Wirkungen des yoga zu verstehen und um die Yogaübungen für sportliches Training zu optimieren, ist die Kenntnis der sportlichen Trainingslehre von Nutzen. Im Englischen bedeutet „sport" nicht nur Sport im Sinne von Bewegung, sondern auch Spiel, Spaß, Unterhaltung. Sport dient dem Training und der Gesunderhaltung des Körpers mittels Körperübungen. Hatha yoga kann auch als optimale Sportart gesehen werden, welche die verschiedenen Systeme des Menschen hervorragend trainiert und dabei auch noch Spaß macht.
-
Sportliche Trainingslehre
Allgemeines Anpassungsprinzip
Der Mensch ist ein Organismus, der sich an die Prämissen bzw. Anforderungen der Umwelt anpasst. Der Organismus reagiert wie folgt:
-
Alarm
-
Widerstand
-
Anpassung
-
Überbeanspruchung bzw. Überforderung bis hin zum Zu- sammenbruch
-
-
-
Je nach Anforderung reagiert der Organismus mit Atrophie oder Hypertrophie.
-
Atrophie
Verkümmern durch Nichtverwenden, z. B. Arm in Gips, Muskel verkümmert. Ein Körperteil bzw. eine Fähigkeit, die nicht beansprucht bzw. genutzt wird, verkümmert.
-
Hypertrophie
Mit den Anforderungen wachsen, z. B. entwickeln sich Muskeln durch bestimmte Übungen. Eine Fähigkeit, die gefordert wird, entwickelt sich. Im engeren Sinne bezieht sich der Ausdruck
,,Hypertrophie" nur auf das Dickenwachstum des Muskels.
Trainingsreiz
ist jeder Reiz, der einen Teil des Körpers fordert. Da der Alltag der meisten Menschen recht bewegungsarm ist, sollte dieser Trainingsreiz von speziellen Übungen, die anstrengend sein sollten, ausgehen. Überbeanspruchung sollte aber vermieden werden.
Hyperkompensation
Wenn ein Organismus beansprucht wird, entwickelt er sich im gewissen Maße auch gleichzeitig für zukünftige Anforderun gen. Der Körper reagiert vorausschauend.
Regenerationszeit
Wenn der Organismus einen Trainingsreiz bekommen hat, braucht er auch eine gewisse Zeit zur Regeneration. In dieser Zeit können sich die Muskeln regenerieren und wachsen. Bei zu kurzer Regenerationszeit besteht die Gefahr der Überbean spruchung/Abnutzung sowie von Unfällen/Muskelrissen und anderen Verletzungen (siehe Spitzensportler).
Gesetz der abnehmenden Erträge und der wechselnden Reize Der Organismus passt sich den verschiedenen Reizen an. Wenn man daher auf eine ganz bestimmte Weise übt, kommt man irgendwann körperlich nicht mehr weiter. Wenn man körper lich weiter fortschreiten will, müssen die Trainingsreize abgewechselt werden. Es ist, vom körperlichen Standpunkt aus, empfehlenswert, die Übungen zu wechseln und sich auch
121

Hatha-yoga
mal weniger aktive Zeiten zu gönnen (vom energetischen, geis tigen und spirituellen Standpunkt aus gibt es aber noch andere Betrachtungsweisen). Es braucht weniger Training, eine Fähigkeit zu behalten, als sie aufzubauen.
9.8.2 Sport und Trainingsarten
-
Herz-Kreislauf-Training (HKT = Ausdauertraining)
Definition: Gleichförmige Bewegungen, die mindestens 6-12 Min. ausgeführt werden, mindestens 40% der Skelett muskulatur beanspruchen und den Puls in eine Zielzone brin gen. HKT führt zur Steigerung der Herzmuskeleffizienz, Sauer stoffaufnahme des Muskels wird erhöht, Lungenvolumen ver größert sich u.ä. HKT hat darüber hinaus auch eine allgemeine positive Wirkung auf den ganzen Organismus. Puls sollte bei diesem Training stabil sein, daher auf Pulsfrequenz achten.
, Als gutes HKT im yoga zählt der Sonnengruß.
Regenerationszeit: 1-2 Tage
Training: mind. 2 Mal pro Woche
Optimale Pulsraten für HKT und Gewichtsabnahme (Faustre geln):
Trainingspuls für HKT:
, 220 minus Lebensalter minus 20-30% mindestens; 6-12 Min. beibehalten; mindestens 2 Mal pro Woche
Trainingspuls für Gewichtsabnahme:
-
220 minus Lebensalter minus 35-45%; mindestens 30-60 Min. beibehalten; mindestens 2 Mal pro Woche
Regenerationszeit für HKT:
-
1-2 Tage
-
-
Muskelkrafttraining
Muskelkraft ist eine Fähigkeit der Muskelfasern.
Entwicklung der Muskelkraft geschieht durch:
, Veränderung der Innervation des Muskels, es entstehen mehr Nervenendungen, mehr Muskelfasern können sich gleichzeitig zusammenziehen durch Erhöhung der Maxi malkraft erhöht sich die Innervation des Muskels.
-
Dickenwachstum - einzelne Muskelfasern werden dicker.
-
Verbesserung der Kapillarisierung des Muskels. Es entste hen mehr Blutgefäße, bessere Durchblutung. Kraftausdau er hängt von der Kapilarisierung ab.
Zwei Formen von Muskelübungen
-
Dynamisches Training
-
Bewegung gegen einen Widerstand. Besteht aus positiver (konzentrischer) Bewegung (Gewicht gegen die Schwer kraft heben, Muskel zieht sich zusammen) und negativer (exzentrischer) Bewegung (Gewicht gegen Widerstand langsam absenken).
-
-
Statisches Training (isometrische Anspannung)
-
Gleichmäßige Anspannung des Muskels gegen gleichmäß igen Widerstand. Isometrische Anspannung führt schnel ler zur Muskelstärke und Entspannung. Regenerationszeit ist kürzer
-
Hatha-yoga und Sport
Bestandteile der Muskelkraft
Muskelkraft besteht aus folgenden, teilweise unabhängigen, aber auch miteinander verbundenen Bestandteilen:
-
Maximalkraft
beschreibt das Gewicht, das maximal gehoben werden kann, bevor Muskelversagen eintritt.
Optimales Maximalkrafttraining im Kraftsport:
-
Ein Gewicht so hoch wählen, dass man es maximal 3-6 Mal heben kann bis zum Muskelversagen.
-
Isometrisches Training mit einem Gewicht bzw. Widerstand, der maximal 10-20 Sek. gehalten werden kann. Beim Maxi malk rafttraining verändert sich die Innervation des Mus kels, d. h. es entstehen mehr Nervenendungen, mehr Mus kelfasern können sich gleichzeitig zusammenziehen.
-
-
Kraftausdauer
beinhaltet, wie oft wir ein Gewicht heben und senken können. Dies hängt von der Kapilarisierung (Anzahl der Blutgefäße im Muskel) ab. Durch eine bessere Kapilarisierung kann die entsprechende Milchsäure schneller abtransportiert werden. Wenn ein Gewicht so gewählt wird, dass es mindestens 15-20 Mal vor dem Muskelversagen gehoben werden kann, ist dies optimales Kraftausdauertraining.
-
Muskeldicke
bezeichnet den Umfang der einzelnen Muskelfaser. Eine Er höhung der Muskeldicke wird erreicht, wenn der Muskel 45-60 Sek. stark (evtl. bis zum Muskelversagen) beansprucht wird.
-
Sprungkraft
bezeichnet die Fähigkeit des Muskels, sich schnell zusammen zuziehen. Wird im klassischen yaga etwas vernachlässigt. Kann durch vinyäsas entwickelt werden (Sprünge zwischen den äsanas).
Regenerationszeit beim Krafttraining:
-
Beim Üben bis zum Muskelversagen: 2-3 Tage.
-
Beim Üben bis zum Anstrengen, aber ohne Muskelversa- gen: 1-2 Tage.
-
Yoga und Muskelkrafttraining
Yoga ist hauptsächlich ein isometrisches Training. Es ist wichtig, langsam in die Yogastellungen hinein- und aus ihnen heraus zugehen. Dadurch wird der Muskel auch durch positive und negative Bewegung trainiert. Entwicklung von Muskelstärke ist wichtig, da dies Sehnen, Bänder und Knochen schützt und auch mittrainiert.
-
-
Koordinationstraining
Koordination kann mit allem erreicht werden, was für den Körper schwierig und ungewohnt ist. Hierbei sind die Gleich gewichtsübungen besonders empfehlenswert, da diese zur Verbesserung der Durchblutung des Gehirns führen (Steige rung der Vernetzung der Gehirnzellen/Synapsen im Gehirn). Koordinationsübungen sind gute Vorbeugung gegen Alters schwachsinn (Demenz) und führen zur Erhöhung der Konzen trationsfähigkeit.
Die Regenerationszeit ist recht kurz (2-4 Std.).
-
Flexibilitätstraining
Flexibilität ist eine Funktion des Bindegewebes, welches die
122
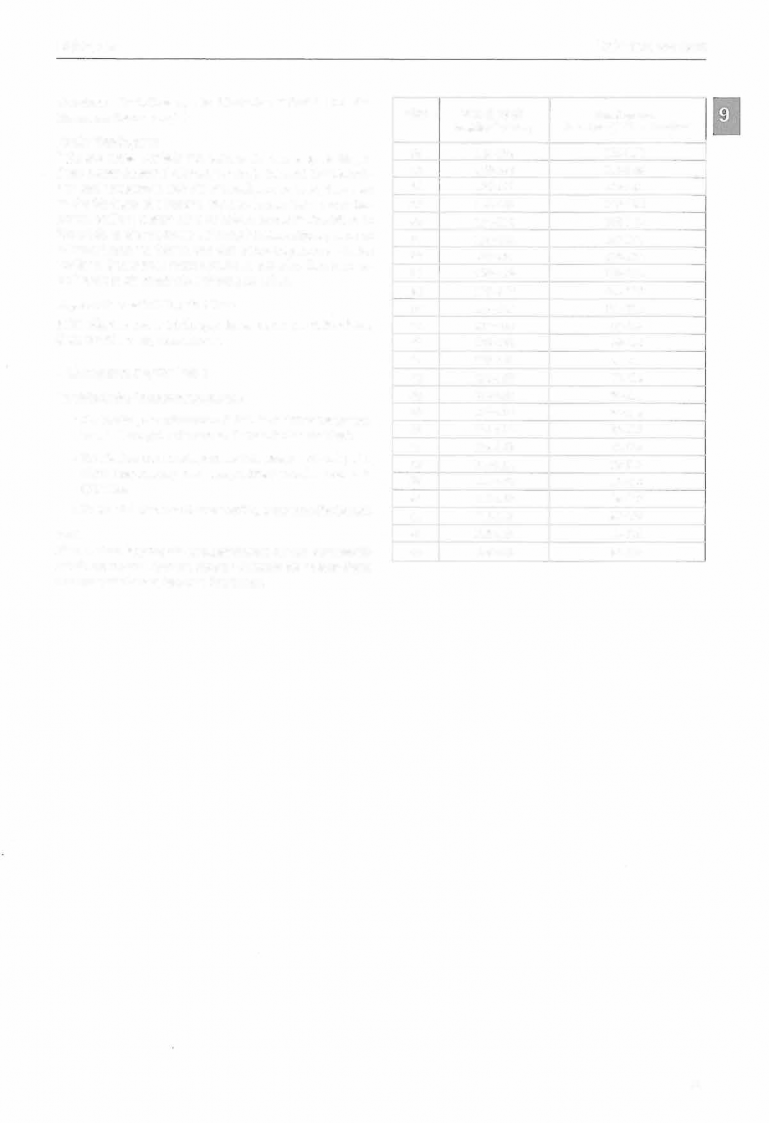
Hatha-yoga Hatha-yoga und Sport
einzelnen Muskelfasern, die Muskelfaserbündel und den Muskel als Ganzes umgibt.
idealer Trainingsreiz
Dehnung eines Muskels mindestens 20 Sek. lang. Je länger, desto besser (maximal allerdings 3 Std.). Erst nach 20 Sek. deh nen und entspannen sich die Muskelfasern so weit, dass man an das Bindegewebe kommt. Wippen, kurzes Halten, von Stel lung zu Stellung gleiten ohne zu halten, ist der Flexibilität nicht förderlich. In die maximale Dehnung hineinzuwippen, kann zu Mikroverletzungen führen und den Dehn-Anspannungs-Reflex auslösen. Daher ist es meist anzuraten, bei schnellem Sonnen gruß nicht in die maximale Dehnung zu gehen.
Regenerationszeit: ½ Tag bis 2 Tage
Beim Erlernen neuer Stellungen ist es daher am optimalsten, diese 2 Mal am Tag auszuführen.
-
Entspannungstraining
Physiologische Entspannungsgesetze
-
Ein Muskel, der mindestens 5 Sek. lang aktiv angespannt wurde, kann gut entspannen (isometrisches Training).
-
Ein Muskel, der mindestens 10 Sek. passiv gedehnt (d. h. ohne Anspannung des Antagonisten) wurde, kann ent spannen.
-
Ein Muskel, den man bewusst spürt, entspannt (Bodyscan).
Fazit
Alles in allem ist yoga ein ausgezeichnetes System zur Gesund erhaltung unseres Körpers. Yoga ist vielleicht die vollständigste und ausgeglichenste Sportart überhaupt.
Alter
34
Kreislauftraining
Fettabbau/Fettstoffwechsel
20
140-160
110-130
22
139-158
109-129
24
137-157
108-127
.26
136-155
107-126
28
134-154
106-125
30
133-152
105-124
32
132-150
103-122
36
38
40
42
44
48
120-138
95-112
50
119-136
94-111
52
118-134
92-109
56
116-133
115-131
91-108
90-107
58
113-130
89-105
60
112-128
88-104
62
111-126
87-103
64
109-125
86-101
66
108-123
85-100
46
54
Trainingspuls Trainingspuls
130-149 102-121
129-147 101-120
127-146 100-118
126-144 99-117
125-142 98-116
123-141 97-114
122-139 96-113
123

Hatha-yoga Notizen
124
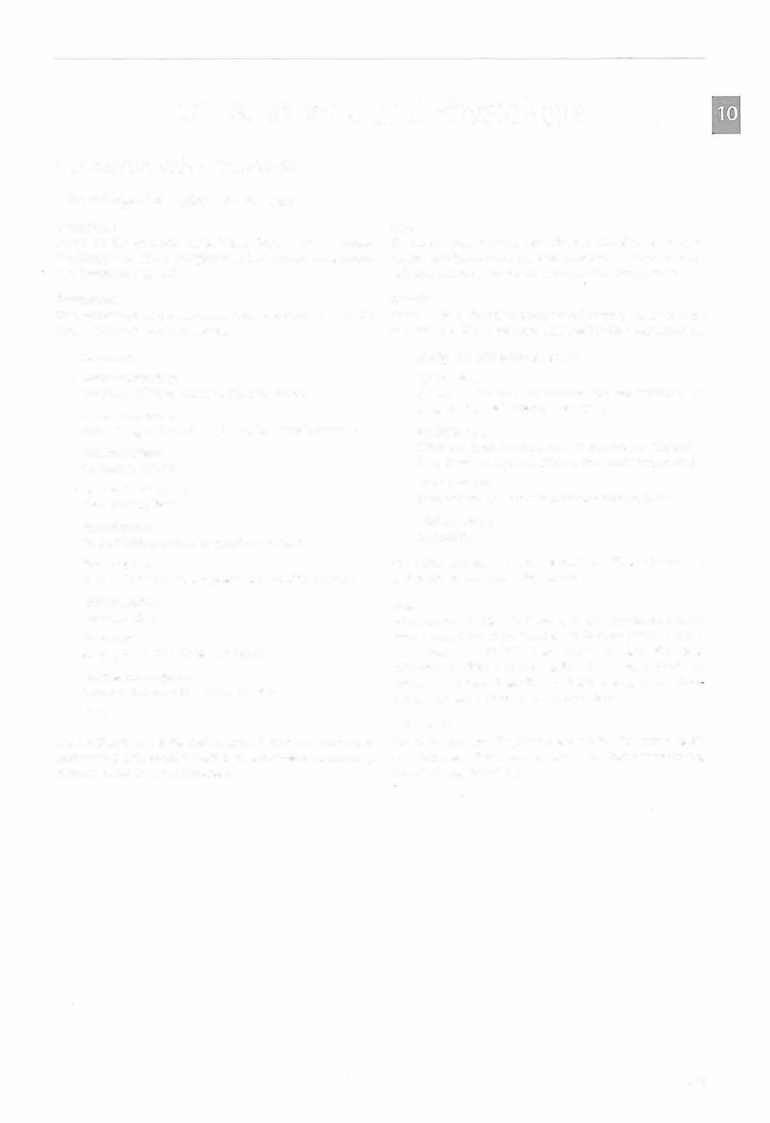
10. Anatomie und Physiologie
10.1 Anatomische Grundlagen
-
-
Grundlegender Aufbau des Körpers
Organismus
Damit ist der gesamte menschliche Körper mit all seinen Funktionen gemeint. Der Organismus baut sich aus verschiede nen Organsystemen auf.
Organsystem
Ein Organsystem ist das Zusammenspiel mehrerer Organe, die eine gemeinsame Aufgabe haben.
Einteilung:
-
Bewegungsapparat
Knochen, Gelenke, Muskeln, Sehnen, Bänder
-
Verdauungssystem
Mund, Magen-Darm-Kanal, Leber, Bauchspeicheldrüse
-
Atmungssystem
Atemwege, Lungen
-
Herz-Kreislauf-System
Herz, Gefäße, Blut
-
Immunsystem
weiße Blutkörperchen, lymphatische Organe
-
Nervensystem
Gehirn, Rückenmark, periphere Nerven, Sinnesorgane
-
Hormonsystem
Hormondrüsen
-
Harnwege
Nieren, Harnleiter, Blase, Harnröhre
-
Fortpflanzungssystem
Innere und äußere Geschlechtsorgane
-
Haut
Dabei arbeitet aber jedes System nicht einfach nur alleine und autonom für sich, sondern steht in direkter Wechselbeziehung mit allen anderen Organsystemen.
Organ
Ein Organ ist ein Verbund verschiedener Gewebe. Jedes Organ besitzt ein Stützgewebe aus Bindegewebe, das es zusammen hält und ihm die Form verleiht, und ein Funktionsgewebe.
Gewebe
Damit ist ein Verbund gleichartiger Zellen mit gleicher Funktion gemeint, z. B. bilden mehrere Muskelzellen das Muskelgewebe.
Es gibt vier Grundgewebearten:
-
Epithelzellen
kleiden alle inneren und äußeren Körperoberflächen aus (z. B. Haut, Schleimhäute, Blutgefäße)
-
Bindegewebe
Stütz- und Haltefunktion; verleiht dem Körper Stabilität (z. B. Knochen, Knorpel, Bänder, aber auch Fettgewebe)
-
Nervengewebe
Verarbeitung und Weiterleitung von Informationen
-
Muskelgewebe
Kontraktion
Alle Zellen und Gewebe des menschlichen Körpers lassen sich in eine dieser vier Kategorien einteilen.
Zelle
Zellen stellen die kleinste Baueinheit des Organismus dar. Ein erwachsener Mensch besitzt etwa 75 Billionen (bildlich in Zah len 75 000 000 000 000) Zellen. Alleine das Blut bildet jede Sekunde drei Millionen neue rote Blutkörperchen. Einige Zellen werden nur wenige Tage alt (z. B. Epithelzellen), andere über dauern das ganze Leben (z. B. Nervenzellen).
Zellorganellen
Dies sind sozusagen die „Organe einer Zelle", die unterschiedli che Aufgaben übernehmen, wie z. B. Energiegewinnung, Sekretbildung, Zellteilung.
125
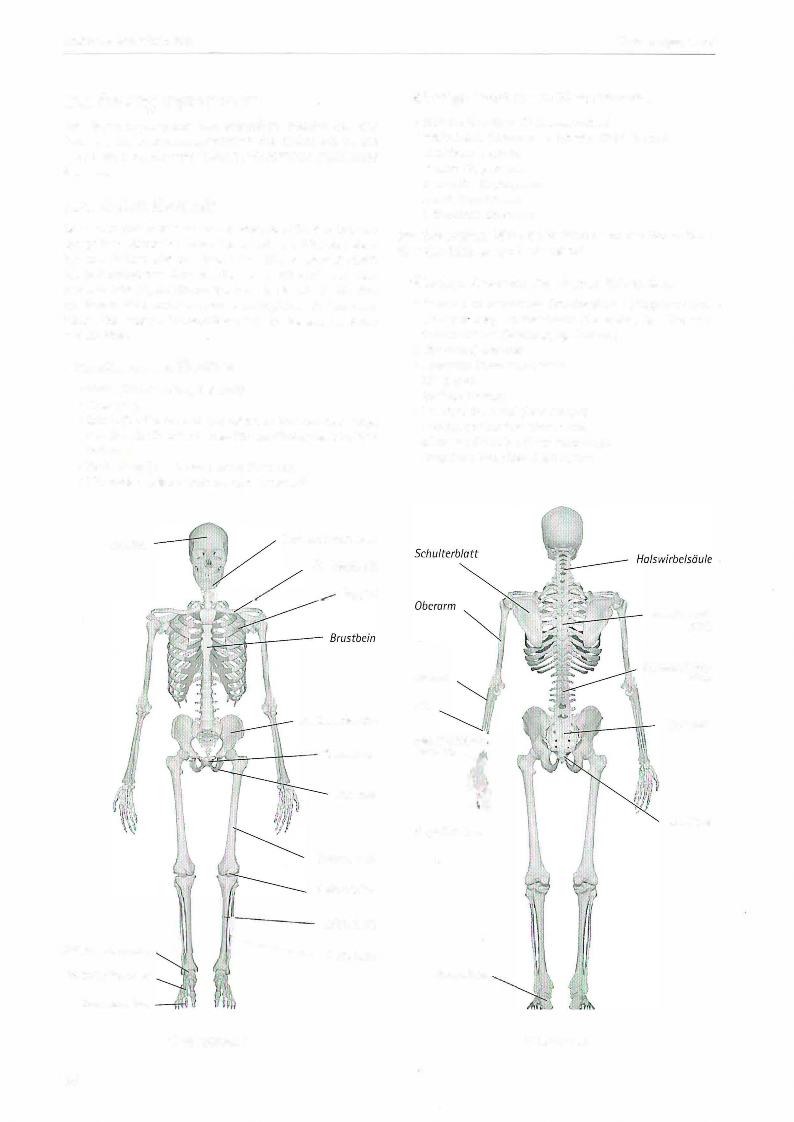
Anatomie und Physiologie
-
-
Bewegungsapparat
Der Bewegungsapparat des Menschen besteht aus den Knochen, die zusammen genommen das Skelett bilden, und den für die Bewegung und Haltung erforderlichen Muskeln und Gelenken.
-
Skelett allgemein
Das Skelett des Menschen besteht aus etwa 206 Knochen und knorpeligen Elementen. Gemeinsam mit den Bändern, Mus keln und Sehnen gibt das Skelett dem Körper seine Stabilität bei größtmöglicher Beweglichkeit. Zum Körperstamm zählt man den Schädel, die Wirbelsäule und den Brustkorb. Die obe ren Extremitäten umfassen den Schultergürtel, die Arme und Hände. Die unteren Extremitäten sind das Becken, die Beine und die Füße.
-
-
-
-
Funktionen des Skelettes
-
Statik (Stützfunktion, Stabilität}
-
Bewegung
-
Schutz (für Organe z. B. das Gehirn im Schädel oder Lunge und Herz im Brustkorb, oder für das Rückenmark im Wir belkanal}
-
Blutbildung (v. a. in den platten Knochen)
-
Mineralienspeicher (Kalzium und Phosphat)
Bewegungsapparat
-
-
Wichtige Knochen des Körperstamms
-
Schädel (Cranium; 29 Einzelknochen}
-
Wirbelsäule (Columna vertebralis; 33-34 Wirbel}
-
Brustkorb (Thorax):
7 echte Rippenpaare
3 unechte Rippenpaare
2 freie Rippenpaare
1 Brustbein (Sternum)
Der Körperstamm bildet die Verbindung zu den Extremitäten über den Schulter- und Beckengürtel.
-
-
Wichtige Knochen der oberen Extremität
-
Knochen im Bereich des Schultergürtels (Cingulum mem bri super ioris), Schlüsselbeine (Claviculae, Sg. Clavicula), Schulterblätter (Scapulae, Sg. Scapula)
-
Oberarm (Humerus}
-
Unterarm (Ossa antebrachii) Elle (Ulna}
Speiche (Radius)
-
Knochen der Hand (Ossa manus) Handwurzelknochen (Ossa carpi) Mittelhandknochen (Ossa metacarpi) Fingerknochen (Ossa digiti manus)
Schädel Unterkieferknochen
Schlüsselbein
;, t Rippen
Beckenschaufel Schambein
Sitzbein
Oberschenkel Kniescheibe
Speiche Elle
Handwurzel- �r
knochen -----lJ,
/
-0\:',/:1;_,�\�,\,
-
'.�1
-
Fingerknochen
Brustwirbel
säule
Lendenwirbel
säule
Kreuzbein
Steißbein
. I Schienbein
Fußwurzelknochen Mittelfußknochen Zehenknochen
1 Wadenbein
Fersenbein
126
VORDERANSICHT
RÜCKANSICHT
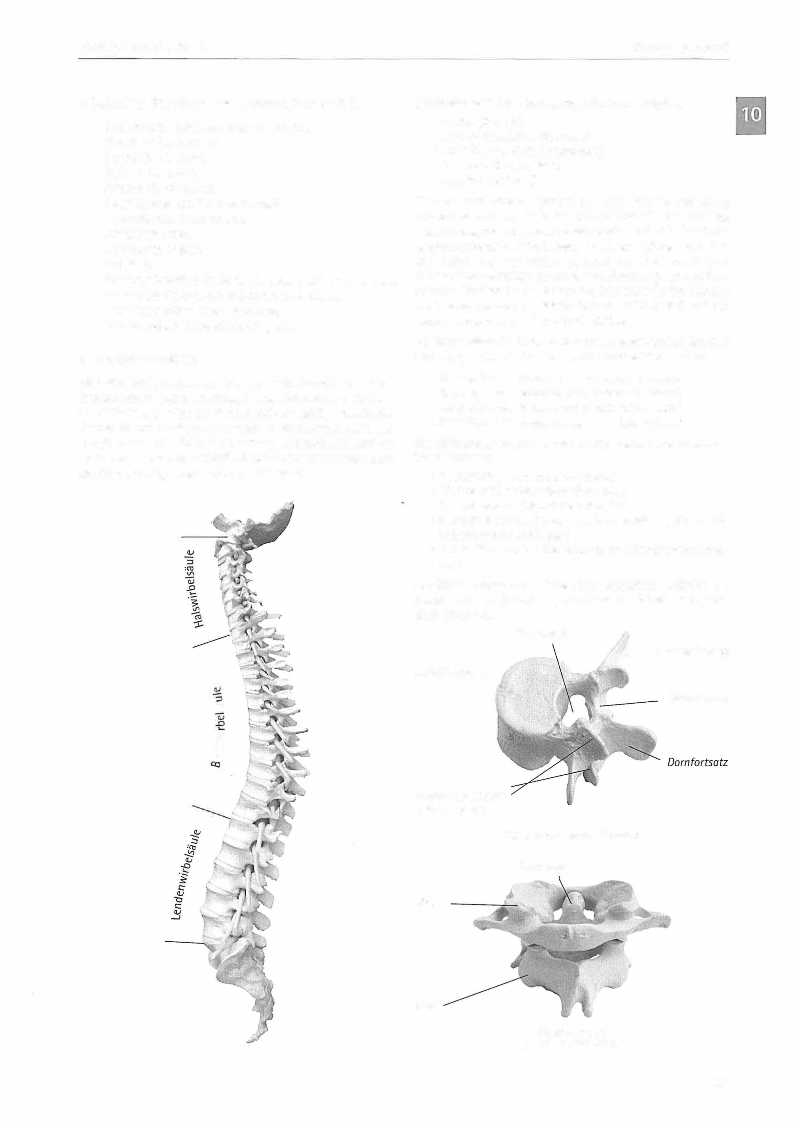
Anatomie und Physiologie
-
Wichtige Knochen der unteren Extremität
-
Beckengürtel (Cingulum membri pelvini): Kreuzbein (Os sacrum)
Darmbein (Os ilium) Sitzbein (Os ischii) Schambein (Os pubis)
-
Oberschenkel (Os femoris; Femur)
-
Unterschenkel (Ossa cruris):
Schienbein (Tibia) Wadenbein (Fibula)
-
Fuß (Pes):
-
Fußwurzelknochen (Ossa tarsi). Dazu gehören u. a. auch Fersenbein (Calcaneus) und Sprungbein (Talus).
Mittelfußknochen (Ossa metatarsi) Zehenknochen (Ossa digitorum pedis)
-
-
-
Wirbelsäule
Die Wirbelsäule besteht aus Wirbeln, Zwischenwirbelscheiben (Bandscheiben), Zwischenwirbelgelenken, Bändern und Muskeln. Die Wirbelsäule erfüllt durch ihren Aufbau wichtige Funktionen für den Körper. Zunächst ermöglicht sie dem Körper, seine Hal tung in senkrechter Form einzunehmen und auch zu halten. Sie bietet also Statik und ermöglicht gleichzeitig Bewegung, denn die Wirbel sind gegeneinander flexibel gelagert.
Bewegungsapparat
Damit sind vielfältige Bewegungen im Raum möglich:
-
Flexion (Beugen)
-
(Hyper-) Extension (Strecken)
-
Lateralflexion (Seitwärtsneigung)
-
Zirkumduktion (Kreisen)
-
Rotation (Drehung)
Obwohl zwei einzelne Wirbel nur eine geringe Bewegung zueinander zulassen, ist in der Summe über alle Gelenke eine große Bewegung der gesamten Wirbelsäule möglich. Durch die
„Doppel-S-Form" der Wirbelsäule ist sie auch für das Abfedern und Aufnehmen von Stößen geeignet und bietet damit dem Gehirn einen wichtigen Schutz vor Erschütterung. Eine weitere wichtige Funktion ist der Schutz des Rückenmarks (im Rücken markskanal, der von den Wirbellöchern gebildet wird) und der inneren Organe in Brust- und Bauchhöhle.
Die Wirbelsäule ist beim Erwachsenen physiologisch doppelt S-förmig gekrümmt. Von oben nach unten zeigt sich eine:
-
Halslordose (Krümmung zeigt nach vorne - ventral)
-
Brustkyphose (krümmung zeigt nach hinten - dorsal)
-
Lendenlordose (Krümmung zeigt nach vorne - ventral)
-
Sakralkyphose (krümmung zeigt nach hinten - dorsal)
Die Wirbelsäule (Columna vertebralis) besteht aus folgenden Wirbelkörpern:
-
7 Halswirbel (Vertebrae cervicales)
-
12 Brustwirbel (Vertebrae thoracicae)
-
5 Lendenwirbel (Vertebrae lumbales)
-
5 Kreuzbeinwirbel (Os sacrum; Verschmelzung bis zum 25. Lebenjahr abgeschlossen)
-
4-5 Steißbeinwirbel (Os coccygis; miteinander verschmol- zen)
Die Wirbel haben eine einheitliche Grundform, lediglich die beiden obersten Halswirbel, auf denen der Schädel ruht, wei chen davon ab.
'"'
\/\
E 2
Wirbelkörper
Wirbel/ach
�
- Querfortsatz
Wirbelbogen
oberer und unterer Gelenkfortsatz
Atlas
Axis
GRUNDFORM EINES WIRBELS
Dens axis
ATLAS UND AXIS (1. UND 2. HALSWIRBEL)
127
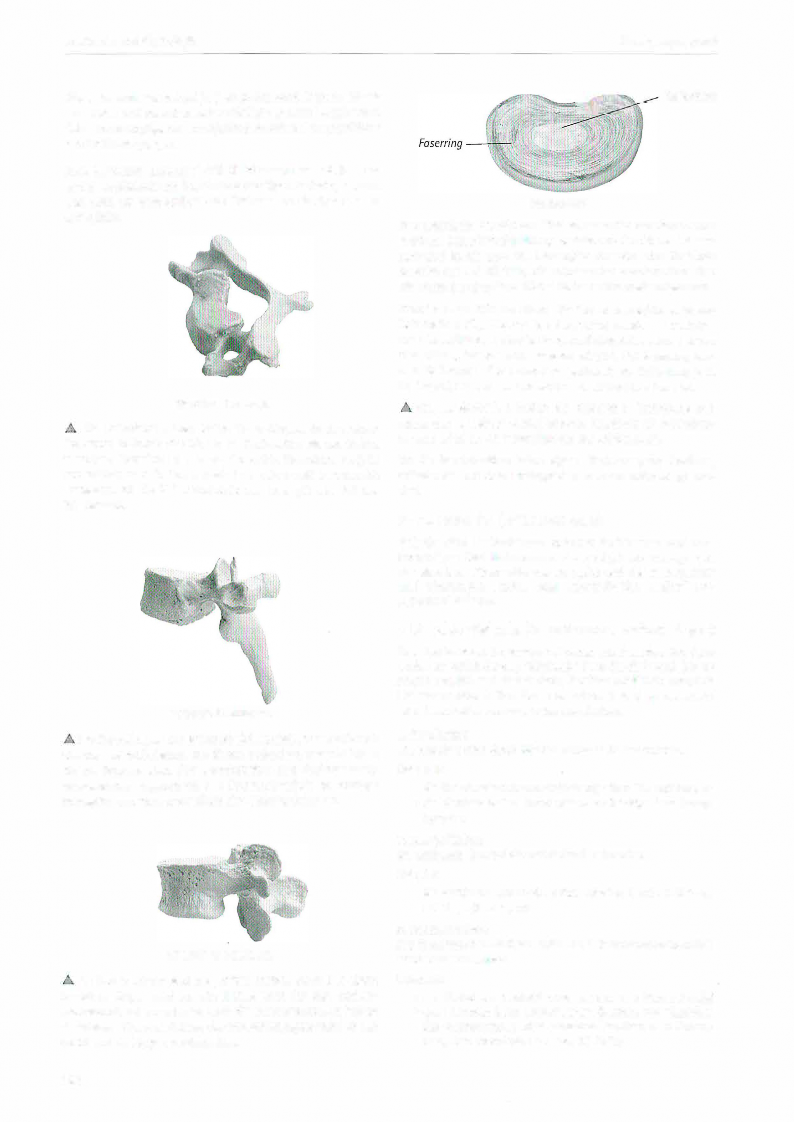
Anatomie und Physiologie
Atlas, der erste Halswirbel (Cl), trägt den Kopf. Er ist ringförmig aufgebaut und besitzt weder Wirbelkörper noch Dornfortsatz. Sein oberes Kopfgelenk ermöglicht dem Schädel das Ausführen von Nickbewegungen.
Axis, der zweite Halswirbel (C2) bildet zusammen mit Atlas das untere Kopfgelenk und hat einen zahnartigen Fortsatz, genannt Dens axis, der dem Schädel eine Drehung um die eigene Achse ermöglicht.
TYPISCHER HALSWIRBEL
Die Halswirbel haben kleine Wirbelkörper. In den Quer fortsätzen befinden sich Löcher für Blutgefäße, die das Gehirn versorgen. Vertebra prominens, der siebte Halswirbel (C7), ist gut tastbar, da sein Dornfortsatz besonders weit hervorsteht. Insgesamt ist die Halswirbelsäule der beweglichste Teil der Wirbelsäule.
TYPISCHER BRUSTWIRBEL
Die Wirbelkörper der Brustwirbelsäule sind etwas größer als die der Halswirbelsäule. Sie bieten außerdem Gelenkflächen für die Rippenenden. Ihre Dornfortsätze sind dachziegelartig übereinander angeordnet. Die Brustwirbelsäule ist weniger beweglich und nimmt vor allem eine Haltefunktion ein.
TYPISCHER LENDENWIRBEL
Die Lendenwirbel sind die größten Wirbel. Sie haben einen massiven Körper und nur ein kleines Loch für den Rücken markskanal. Bei ihnen fehlen auch die Querfortsätze, sie haben stattdessen Rippenfortsätze, die entwicklungsgeschichtlich auf verkümmerte Rippen zurückgehen.
128
Bewegungsapparat
.--:;e, _ . Gallertkern
_:.�;_ �j ·'.
BANDSCHEIBE
Das Kreuzbein besteht aus fünf miteinander verschmolzenen Wirbeln. Diese Verschmelzung beginnt um das 16.-18. Lebens jahr und ist bis zum 25. Lebensjahr beendet. Das Steißbein besteht aus 4-5 Wirbeln, die miteinander verschmolzen sind. Die Form der einzelnen Wirbel ist hier nicht mehr erkennbar.
Zwischen den Wirbeln sitzen die Bandscheiben/Zwischenwir belscheiben (Sg. Discus/Disci intervertebrales). Sie bestehen aus einem äußeren, straffen Ring aus Kollagenfasern und einem Gallertkern, der weich und wasserhaltig ist. Bei Belastung wer den die Bandscheiben zusammengedrückt, bei Entlastung (z. B. im liegen) nehmen sie wieder ihre ursprüngliche Form an.
Die Bandscheiben bilden die elastische Verbindung zwi schen den einzelnen Wirbelkörpern, fungieren als Stoßdämp fer und erhöhen die Beweglichkeit der Wirbelsäule.
Da die Bandscheiben keine eigene Blutversorgung besitzen, müssen sie aus dem umliegenden Gewebe mitversorgt wer den.
-
-
-
Gelenke (articulationes)
Gelenke sind Verbindungen zwischen knöchernen und/oder knorpeligen Skelettelementen. Sie ermöglichen Bewegungen der einzelnen Abschnitte des Rumpfes und der Extremitäten und übertragen Kräfte. Man unterscheidet „echte" und
,, unechte" Gelenke.
-
Unechte Gelenke (Synarthrosen, Haften, Fugen)
Unechte Gelenke sind solche, bei denen zwischen den Knochen enden ein verbindendes Füllgewebe liegt. Sie sind wenig bis gar nicht beweglich und dienen dazu, Knochen möglichst unverrück bar zusammenzuhalten. Nach der Art des jeweiligen Füllgeweb es unterscheidet man drei Arten sog. Haften.
-
Bandhaften
Die Knochen sind durch Bänder miteinander verbunden. Beispiele:
-
die Zwischenknochenmembran zwischen Elle und Speiche
-
die häutigen Stellen (Fontanellen) am Schädel eines Neuge- borenen
-
-
Knorpelhaften
Sie enthalten Knorpel als verbindendes Gewebe. Beispiel:
-
die Verbindung der beiden Schambeine durch die Scham- beinfuge (Symphyse)
-
-
Knochenhaften
Die Einzelknochen sind sekundär durch Knochengewebe mitei nander verschmolzen.
Beispiele:
-
das Kreuzbein (besteht zunächst aus fünf Einzelwirbeln)
-
das Hüftbein beim Erwachsenen (besteht vor Abschluss des Wachstums aus drei einzelnen Knochen, dem Scham bein, dem Darmbein und dem Sitzbein)
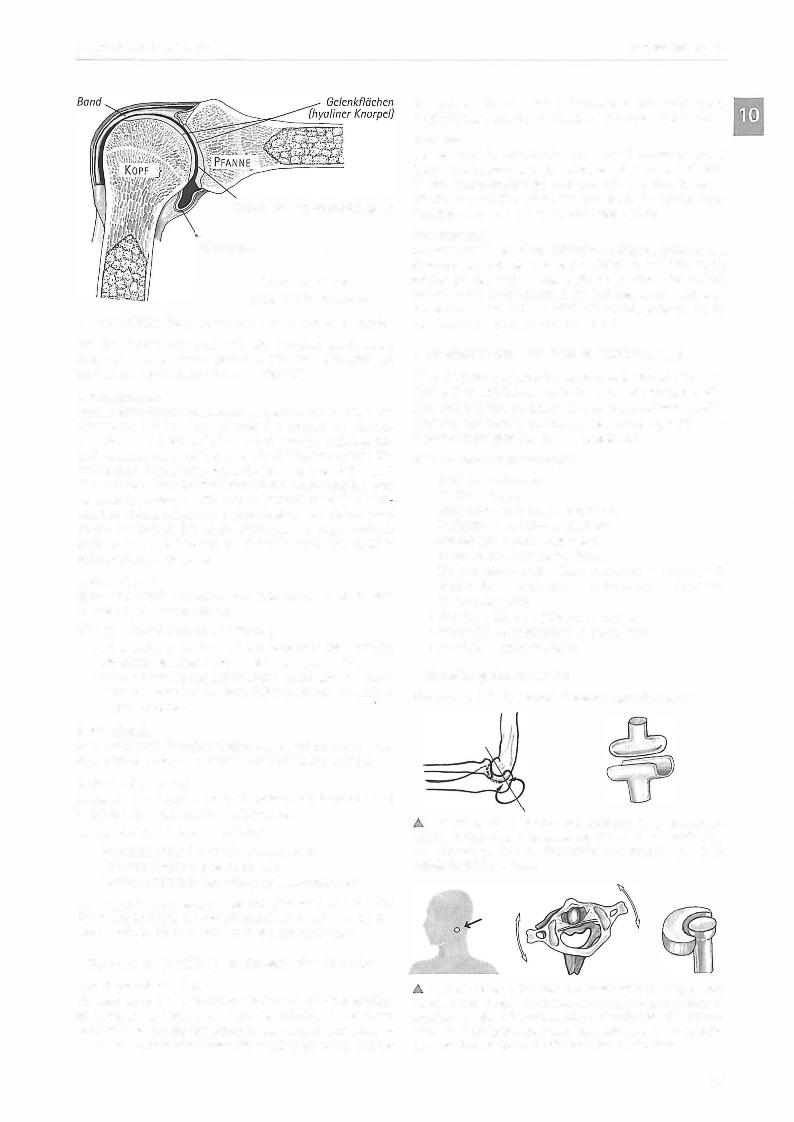
Anatomie und Physiologie
Gelenkspalt mit Gelenkflüssigkeit
Gelenkkapsel
TYPISCHER AUFBAU EINES ECHTEN GELENKES
-
Echte Gelenke (Diarthrose, Juncturae synoviales)
Bei den echten Gelenken sind die Knochen durch einen Gelenkspalt voneinander getrennt. Die freie Beweglichkeit wird durch vier Grundstrukturen ermöglicht:
-
Gelenkflächen
werden durch glatten Gelenkknorpel gebildet und ermöglichen reibung�loses Gleiten und schützen den Knochen vor Abnutz ung. Die Knorpelflächen sind normalerweise unverkalkt, gefäß und nervenfrei und besitzen eine „Stoßdämpferfunktion". Die Ernährung der Gelenkknorpel findet über die Gelenkflüssigkeit (Synovia) statt. Eine optimale Versorgung mit Nährstoffen setzt regelmäßige Bewegung (Be- und Entlastung) des Gelenks vor aus. Bewegungsmangel und unphysiologisch hohe Belastungen führen besonders bei alten Menschen zu degenerativen Veränderungen (Arthrosen) des Gelenkknorpels. Das Regene rationsvermögen ist gering.
-
Gelenkkapsel
bildet eine straffe Umhüllung des Gelenkraumes und ist eine Fortsetzung der Knochenhaut.
Die Kapsel besteht aus zwei Schichten:
-
einer äußeren, straffen und kollagenfaserhaltigen Schicht, die festen Halt bietet und vor Verrenkungen schützt
-
einer inneren, locker aufgebauten, gefäß- und nervenrei chen Gelenkinnenhaut (Synovialhaut), die die Gelenkflüs sigkeit produziert.
-
-
Gelenkspalt
ist ausgefüllt mit Gelenkflüssigkeit. Diese setzt die Reibung der Gelenkflächen herab und ernährt gleichzeitig den Knorpel.
-
Bänder (Ligamenta)
bestehen aus straffem kollagenfaserigem Bindegewebe und verbinden die Knochenenden miteinander.
Je nach Funktion unterscheidet man:
-
Verstärkungsbänder (für die Gelenkkapsel)
-
Führungsbänder (bei Bewegungen)
-
Hemmungsbänder (zur Bewegungseinschränkung)
-
Bei längerer Ruhigstellung eines Gelenkes verkürzen sich die Bindegewebsfasern, die Gelenkkapsel schrumpft und die Be weglichkeit des Gelenks kann stark eingeschränkt sein.
-
-
Strukturen & Hilfseinrichtungen der Gelenke
Zwischenscheiben (Disci)
Die Zwischenscheiben bestehen aus Knorpel oder aus straffem Bindegewebe und liegen innerhalb des Gelenkspalts. An ihrem Rand sind sie mit der Gelenkkapsel verwachsen und teilen so das Gelenk in zwei Abteilungen. Sie verteilen den Druck und ha-
Bewegungsapparat
ben auch eine Polsterfunktion. Zwischenscheiben kommen z. B. im Kiefergelenk oder im Schlüsselbein-Brustbein-Gelenk vor.
Meniskus
Der Meniskus ist eine Sonderform einer Zwischenscheibe. In jedem Knie befinden sich zwei Menisken. Er hat eine C-förmige Gestalt (halbmondförmig) und unterteilt das Gelenk unvoll ständig. Er ermöglicht eine Verteilung des Gelenkdrucks durch Vergrößerung der der kraftaufnehmenden Fläche.
Schleimbeutel
Schleimbeutel liegen als spaltförmige Hohlräume zwischen den Gelenken und den sie umgebenden Muskeln und Sehnen. Sie verbessern das Gleiten dieser Strukturen über das Gelenk, indem sie den Druck verteilen. Sie sind ausgekleidet mit einer Synovialmembran und ausgefüllt mit Synovia. Teilweise beste hen auch Verbindungen zum Gelenkspalt.
-
Gelenkformen und Bewegungsrichtungen
Die Bewegungsmöglichkeiten eines Gelenks werden durch die Form der Gelenkflächen sowie durch die Anordnung von Bän dern und Muskeln bestimmt. Eine geordnete Bewegungsfüh rung und Hemmung in bestimmten Extremstellungen ist für die Funktionstüchtigkeit der Gelenke unerlässlich.
Wichtige Bewegungsrichtungen:
-
Extension = Strecken Flexion = Beugen
-
Abduktion = vom Körper wegführen
Adduktion = zum Körper hinführen
-
Anteversion = nach vorne wenden Retroversion = nach hinten führen
-
Zirkumduktion = Kreisen (eine kombinierte Bewegung, z.B. Anteversion - Abduktion - Retroversion - Adduktion im Schultergelenk)
-
Rotation = um die eigene Achse drehen
-
Supination = Auswärtsdrehen (Hand, Fuß)
-
Pronation = Einwärtsdrehen
-
-
Einteilung der Gelenke
Gelenke mit 1 Freiheitsgrad (2 Bewegungsrichtungen)
Scharniergelenk = Flexion und Extension (z . B. Ellenbogen gelenk, Mittel- und Endgelenke der Finger). Ein walzenförmiger Gelenkkörper greift in die rinnenförmige Vertiefung seines hohl zylinderförmigen Partners.
Drehgelenk, auch Rad- bzw. Zapfengelenk genannt (z. B. Kopf gelenk, zwischen Atlas und Axiszahn; oberes Elle-Speiche-Gelenk). Rotation um eine Längsachse. Eine walzenförmige Gelenkfläche steht einer hohlzylinderförmigen Gelenkfläche gegenüber. Beide Knochen sind mit einem ringförmigen Band verbunden.
129
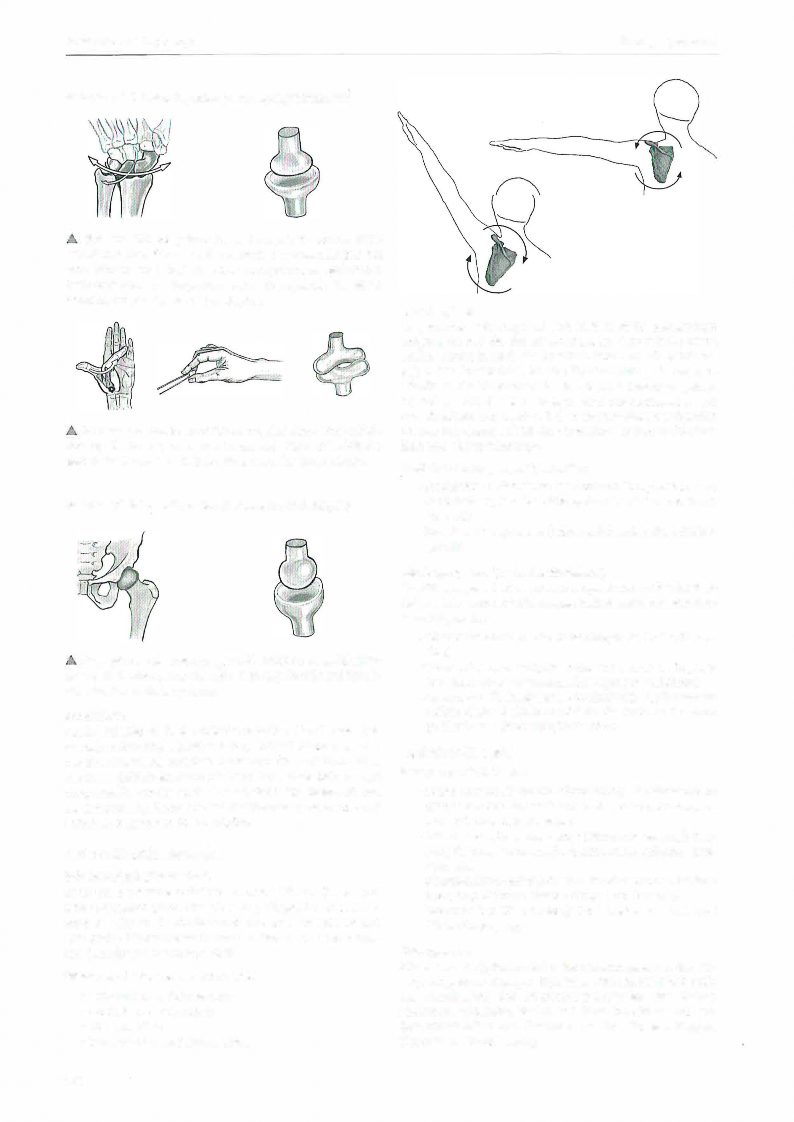
Anatomie und Physiologie
Gelenke mit 2 Freiheitsgraden (4 Bewegungsrichtungen)
Eigelenk, Ellipsoidgelenk (z. B. Handgelenk; oberes Kopf gelenk zwischen Atlas und Hinterkopf). Der Gelenkkörper hat eine Eiform und liegt in einer entsprechend geformten Gelenkpfanne. Im Gegensatz zum Kugelgelenk ist keine Rotation um die eigene Achse möglich.
Sattelgelenk: Flexion und Extension, Abduktion und Adduk tion (z. B. Grundgelenk des Daumens). Eine Gelenkfläche gleicht der Form eines Sattels, die andere der eines Reiters.
Gelenke mit 3 Fr�iheitsgraden (6 Bewegungsrichtungen)
Kugelgelenk: alle Bewegungen inkl. Rotation (z. B. Schulter gelenk, Hüftgelenk). Der Gelenkkopf ist kugelförmig und liegt in einer konkaven Gelenkpfanne.
Sonderform
Straffe Gelenke (z. B. die Gelenke zwischen Hand- bzw. Fuß wurzelknochen und Mittelhand- bzw. Mittelfußknochen, oder das lliosakralgelenk zwischen Beckenschaufel und Kreuzbein). Die Beweglichkeit ist durch die Form ihrer Gelenkkörper und durch straffe Bänder stark eingeschränkt. Die Gelenkflächen der Knochen sind flach; nur eine Gleitbewegung nach vorn und hinten ist in geringem Maße möglich.
-
Gelenkbeschreibungen
Schultergelenk (Kugelgelenk)
Es ist das beweglichste Gelenk am menschlichen Körper und wird vorwiegend durch Muskeln, zum geringen Teil auch durch Bänder gesichert. Da die Gelenkpfanne nur sehr klein ist und nur wenige Bänder dieses Gelenk verstärken, sind Verrenkun gen (Luxationen) besonders häufig.
Bewegungsrichtungen des Oberarmes:
-
Anteversion++ Retroversion
-
Abduktion++ Adduktion
-
Zirkumduktion
-
Innenrotation++ Außenrotation
Bewegungsapparat
Schultergürtel
Im gesamten Schultergürtel sind weitaus mehr Bewegungen möglich, als nur die des Schultergelenks. Zum Schultergürtel zählen weiterhin noch die Schulterblätter und die Schlüssel beine. Das Schulterblatt ist eine Knochenplatte, die fast voll ständig in die Muskulatur der Brustkorbrückwand eingebaut ist, und nur mittels kleiner Gelenke über das Schlüsselbein mit dem Brustbein und damit mit dem übrigen Skelett verbunden ist. Das Schultergelenk ist die Verbindung zwischen Schulter blatt und Oberarmknochen.
Zusätzliche Bewegungsmöglichkeiten:
-
Protraktion ++ Retraktion (Nachvornewölben/Zurückziehen der Schultern; Schulterblätter gleiten dabei über den Brust korb mit)
-
Elevation ++Depression (Anheben/Absenken des Schulter- gürtels)
Ellenbogengelenk (Drehscharniergelenk)
Das Ellbogengelenk ist ein zusammengesetztes Dreh-Scharnier Gelenk. Innerhalb der Gelenkkapsel befinden sich drei verschie dene Teilgelenke:
-
Oberarmknochen ++ Elle (Scharniergelenk; Flexion/Exten sion)
-
Oberarmknochen++Speiche (der Form nach ein Kugelge lenk, kann aber nur Scharnierbewegungen ausführen)
-
Speiche++ Elle (Radgelenk= Drehgelenk). Der besondere Aufbau dieses Gelenks ermöglicht die Drehung der Hand im Ellenbogen (Pronation/Supination).
Handgelenk (Eigelenk)
Bewegungsmöglichkeiten:
-
Drehbewegung (Pronation/Supination): Handinnenfläche zeigt nach oben bzw. nach unten. Geht nur im Zusammen hang mit dem Schultergelenk.
-
Palmarflexion/Dorsalextention (Flächenbewegung): Beu gung Richtung Handinnenfläche/Streckung Richtung Hand rückseite.
-
Ulnarabduktion/Radialabduktion (Randbewegung): Seitliche Bewegung Richtung kleinen Finger bzw. Daumen.
-
Zirkumduktion (Handkreisen): Kombination aus Dreh- und Flächenbewegung.
Fingergelenke
Mittel- und Endgelenke sind reine Scharniergelenke, die Fin gergrundgelenke hingegen Eigelenke. Eine Besonderheit stellt das Sattelgelenk des Daumengrundgelenkes dar. Neben Abduktion, Adduktion, Flexion und Extension gibt es noch das Gegenüberstellen des Daumens zu den übrigen Fingern (Opposition, Pinzettengriff).
130
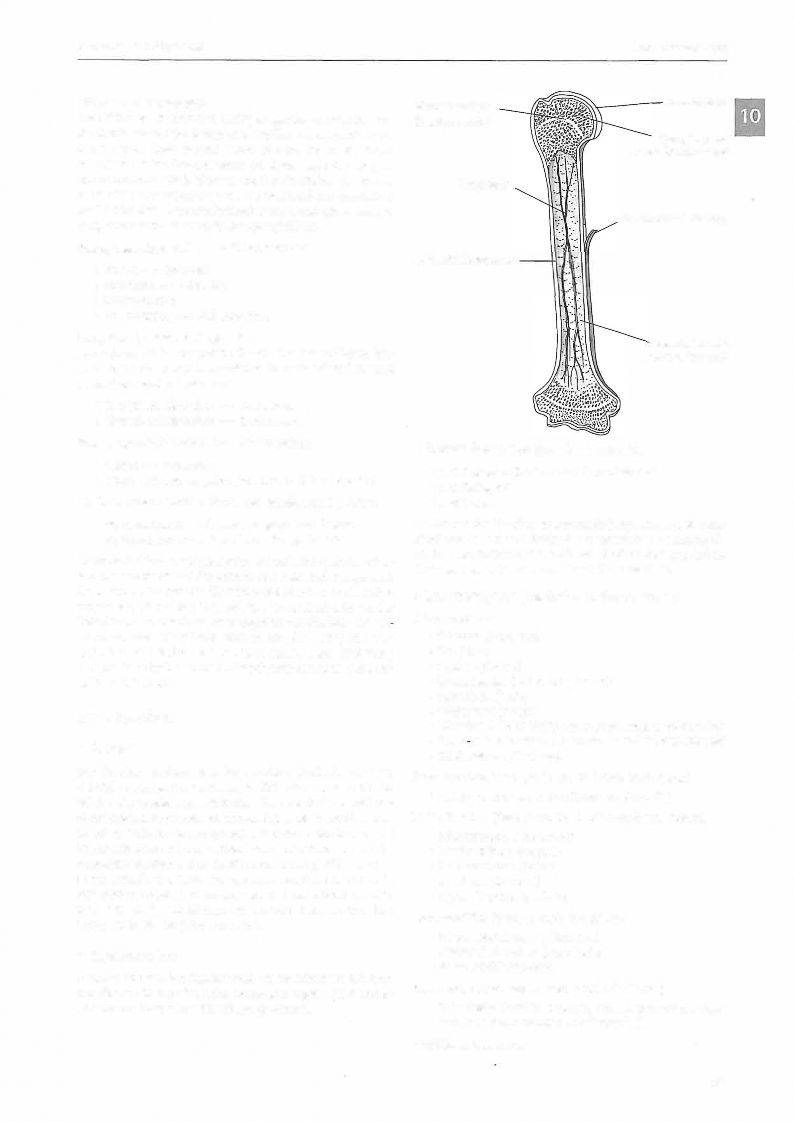
Anatomie und Physiologie Bewegungsapparat
Hüftgelenk (Kugelgelenk)
Das Hüftgelenk besitzt eine kräftig ausgebildete Gelenkkapsel, die durch einen sehr festen und straffen Bandapparat sowie durch einen Muskelmantel gesichert wird. Es ist ein Kugel gelenk und seine Bewegungsmöglichkeiten sind fast so groß wie im Schultergelenk, können jedoch beim Stehen und Gehen nicht völlig ausgenutzt werden. Die Gelenkpfanne umschließt zwei Drittel des Oberschenkelkopfes und bietet einen stabilen Halt, aber relativ eingeschränkte Beweglichkeit.
Bewegungsmöglichkeiten des Oberschenkels:
, Flexion - Extension
-
Abduktion++ Adduktion
-
Zirkumduktion
-
Innenrotation++ Außenrotation
Kniegelenk (Drehscharniergelenk)
Das Kniegelenk ist das größte Gelenk des menschlichen Kör pers. Es ist ein zusammengesetztes Drehscharniergelenk und besteht aus zwei Teilgelenken:
-
Oberschenkelknochen - Schienbein
-
Oberschenkelknochen - Kniescheibe
Wachstumsfuge (Epiphysenfuge)
Blutgefäße
Kartikalis/Kompakta
Gelenkfläche
Spongiosa mit rotem Knochenmark
Knochenhaut (Periost)
Markhöhle mit gelbem Fettmark
Bewegungsmöglichkeiten des Unterschenkels:
-
Flexion - Extension
-
leichte Rotation im gebeugten Knie (z. B. im Lotossitz) Die Bewegungen werden durch zwei Bandsysteme geführt:
-
die Seitenbänder - sichern das gestreckte Gelenk
-
die Kreuzbänder - sichern in der Beugestellung
-
-
Durch die beiden Menisken werden die Gelenkflächen des Ober schenkelknochens und des Schienbeins aneinander angepasst. Sie besitzen eine gewisse Elastizität und gleichen so die Belas tungen aus, die auf das Knie wirken. Die Menisken sind mit der Gelenkkapsel verwachsen, aber trotzdem verschiebbar. Bei Ver letzungen des Kniegelenks reißt wegen der geringeren Ver schiebbarkeit häufiger der Innenmeniskus. Nach Entfernung der Menisken treten vorzeitig Gelenkveränderungen mit Knor peldestruktion auf.
-
-
Knochen
-
-
-
Aufbau
Der Knochen wird von einer Knochenhaut {Periost) umgeben, die viele sensible Nervenfasern besitzt. Hier setzen auch die Sehnen der Muskeln an. Die äußere Knochenrinde besteht aus dichtem Material (Substancia compacta), innen liegen Knochen bälkchen (Substancia spongiosa) mit vielen Hohlräumen und im Schaftbereich die Markhöhle. Diese Hohlräume dienen der Gewichtsreduktion und sind mit Knochenmark gefüllt. Im roten Knochenmark, das beim Erwachsenen hauptsächlich noch in den platten Knochen vorkommt, werden die Blutzellen gebil det. Das gelbe Knochenmark enthält Fettgewebe. Das Knochengewebe ist gut durchblutet.
-
Eigenschaften
Knochen ist nach dem Zahnschmelz die zweithärteste Substanz des Körpers. Er hat eine hohe Druck- und Zugfestigkeit und ist widerstandsfähig gegen Biegebeanspruchung.
-
Bestandteile des Knochenmaterials
-
50% Kalksalze (Kalzium- und Phosphatsalze)
-
30% Kollagenfasern
-
20% Wasser
Die Gestalt der Knochen ist genetisch festgelegt. Ihre Struktur hängt von der Art und Größe der mechanischen Belastung ab. Die Knochen befinden sich in einem ständigen Auf- und Abbau, der einer feinen hormonellen Regulation unterliegt.
-
-
Knochentypen (nach der äußeren Form)
Röhrenknochen
-
Oberarm (Humerus)
-
Elle (Ulna)
-
Speiche (Radius)
-
Oberschenkel (Os femoris; Femur)
-
Schienbein (Tibia)
-
-
Wadenbein (Fibula)
-
Mittelhand-/Mittelfußknochen (Ossa metacarpi/-tarsalia)
-
-
Finger /Zehenknochen (Phalangen, Ossa digiti manus/pedis)
-
Schlüsselbein (Clavicula)
Kurze Knochen {Ossa brevia, Sg. Os breve; Stabilisieren)
-
Hand-/Fußwurzelknochen (Ossa carpi/tarsalia)
Platte Knochen (Ossa plana, Sg. Os planum; bieten Schutz)
-
Schädelknochen (Cranium)
-
Schulterblätter (Scapula)
-
Beckenknochen (Pelvis)
-
Brustbein {Sternum)
-
Rippen (Costae, Sg. Costa)
Unregelmäßige Knochen (Ossa irregularia)
-
Wirbel (Vertebrae, Sg. Vertebral
-
Unterkieferknochen (Mandibula)
-
einige Schädelknochen
Sesambeine (Ossa sesamoidea; Schutz der Sehne)
-
Kniescheibe {Patella), Daumen (Pollex), Großzehgrundge lenk (Articulatio metatarsophalangealis 1)
-
Fersenbein (Calcaneus)
131
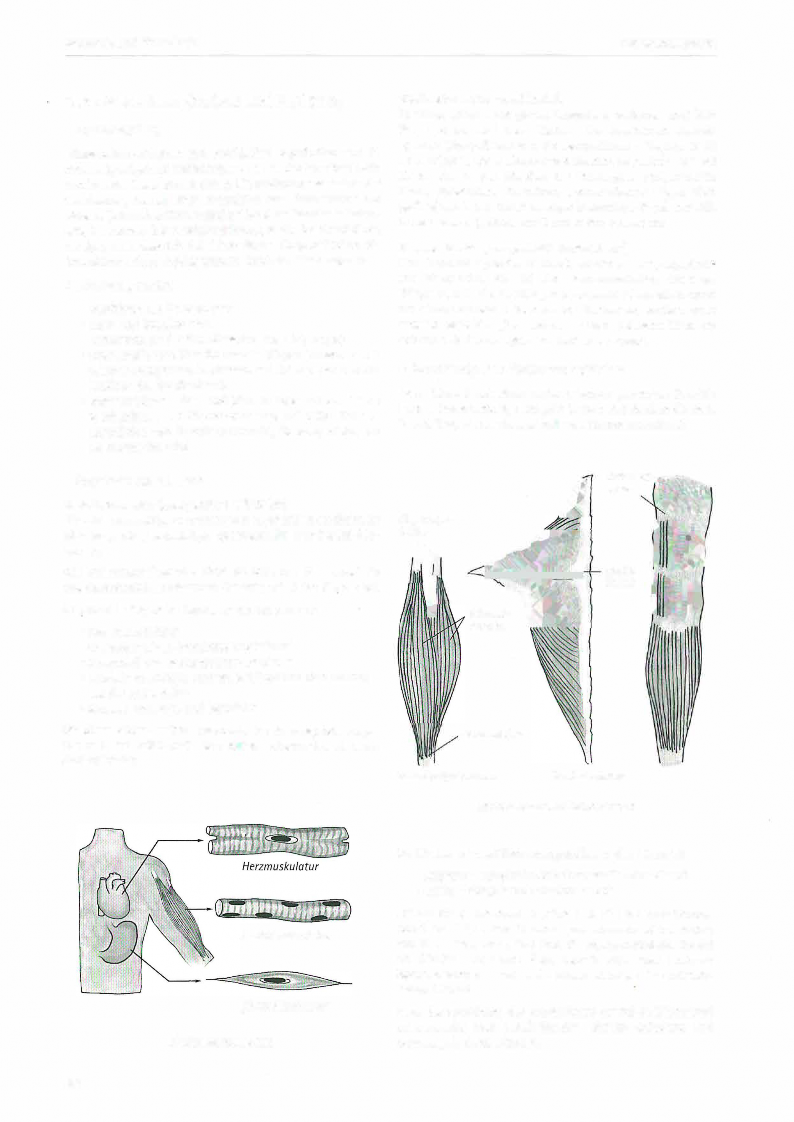
Anatomie und Physiologie
10.2.s Muskulatur (Aufbau und Funktion)
-
Muskelzellen
Muskelzellen enthalten sog. Myofibrillen. Myofibrillen sind fa denförmig aufgebaut und bestehen u. a. aus den Proteinen Aktin und Myosin. Diese können sich in Längsrichtung gegeneinander verschieben, was zu einer Kontraktion bzw. Entspannung des Muskels (Musculus) führt. Dabei greifen diese Proteine teleskop artig ineinander, bei Muskelverkürzung mehr, bei Erschlaffung weniger, ohne dass sich dabei ihre eigene Länge verändert. Die Kontraktion erfolgt impulsgesteuert durch das Nervensystem.
-
Muskelgewebe
-
Ausführen von Bewegungen
-
Statik und Stützfunktion
-
Unterstützung der Blutzirkulation (Muskelpumpe)
-
Eigenempfindung über die Lage des Körpers im Raum durch Mechanorezeptoren in Muskeln und Sehnen (auch in Ge lenkkapseln, Knochenhaut)
-
Wärmebildung - das unwillkürliche Muskelzittern ist ein Mechanismus zur Wärmeerzeugung bei Kälte. Bei der Kontraktion wird Energie verbraucht, die zum größten Teil als Wärme frei wird.
-
Muskelgewebearten
Skelettmuskulatur (quergestreift, willkürlich)
Die sehr regelmäßige Anordnung der Myofibrillen erscheint im
Bewegungsapparat
Glatte Muskulatur (unwillkürlich)
Die Kontraktionen der glatten Muskulatur verlaufen unwillkür lich, spontan und unter Einfluss des vegetativen Nerven systems (Sympathikus und Parasympathikus = Vagus) . Es ist nicht möglich, diese Muskulatur willentlich zu beeinflussen. Sie findet sich in den Wänden der Hohlorgane (Magen-Darm Kanal, Gallenblase, Bronchien, harnableitende Wege, Blut gefäße) und kommt auch im Auge (Sehschärfe, Pupillenweite), in den Haaren (,,Gänsehaut") und in den Drüsen vor.
Herzmuskulatur (quergestreift, unwillkürlich)
Das Herzmuskelgewebe ist eine Sonderform der quergestreif ten Muskulatur. Ein Teil der Herzmuskelzellen dient als Taktgeber, d. h. sie sind fähig, Erregungen nicht nur als Antwort auf einen von außen kommenden Nervenreiz, sondern auch spontan (selbständig) zu bilden. Die Herzmuskulatur ist an die extremen Anforderungen des Herzens angepasst.
-
-
-
Bauprinzip der Skelettmuskulatur
Jeder Muskel hat einen unterschiedlich geformten Muskel bauch. Dieser fleischige Teil geht in die meist deutlich dünnere Sehne über, die den Muskel mit dem Knochen verbindet.
Sehoe
Ursprungs
-
Zwischen-
' sehne ((/rt/Jl
sehne
�
�
plotte !
111111/�
r
Mikroskop als gleichmäßige, quergestreifte Hell-Dunkel-Bän derung.
Das Skelettmuskelgewebe bildet 40-50% des Körpergewichts
und trägt damit besonders zum Gesamtgewicht des Körpers bei. Es kommt in folgenden Bereichen des Körpers vor:
-
Skelettmuskulatur
-
Gesichtsmuskeln (mimische Muskulatur)
-
Zwerchfell und Beckenbodenmuskulatur
-
Muskeln von Zunge, Rachen, Kehlkopf und dem oberen Teil der Speiseröhre
-
Muskeln von Auge und Mittelohr
Die Kontraktionen werden vom zentralen Nervensystem ausge löst und sind größtenteils dem Willen unterworfen, d. h. sie sind willkürlich.
� Mo,ke/�»
bäuche
Ansatzsehne
zweiköpfiger Muskel flacher Muskel
UNTERSCHIEDLICHE MUSKELTYPEN
I /J/11111/!
Skelettmuskulatur
glatte Muskulatur
MUSKELGEWEBEARTEN
Ein Muskel hat zwei Verbindungsstellen zu den Knochen:
-
Ursprung - rumpfnahe Anheftungsstelle (Muskelkopf)
-
Ansatz - rumpfferne Anheftungsstelle
Hat ein Muskel mehrere Ursprünge, die sich in einem Muskel bauch vereinigen und in einer gemeinsamen Sehne enden, spricht man von zwei-, drei- bzw. vierköpfigen Muskeln. Besitzt ein Muskel nur einen Kopf, jedoch eine oder mehrere Zwischensehnen, bezeichnet man ihn als zwei oder mehrbäu chigen Muskel.
Nach der Anordnung der Muskelfasern zur Sehne (Fiederung) unterscheidet man parallelfaserige, einfach gefiederte und doppelt gefiederte Muskeln.
132
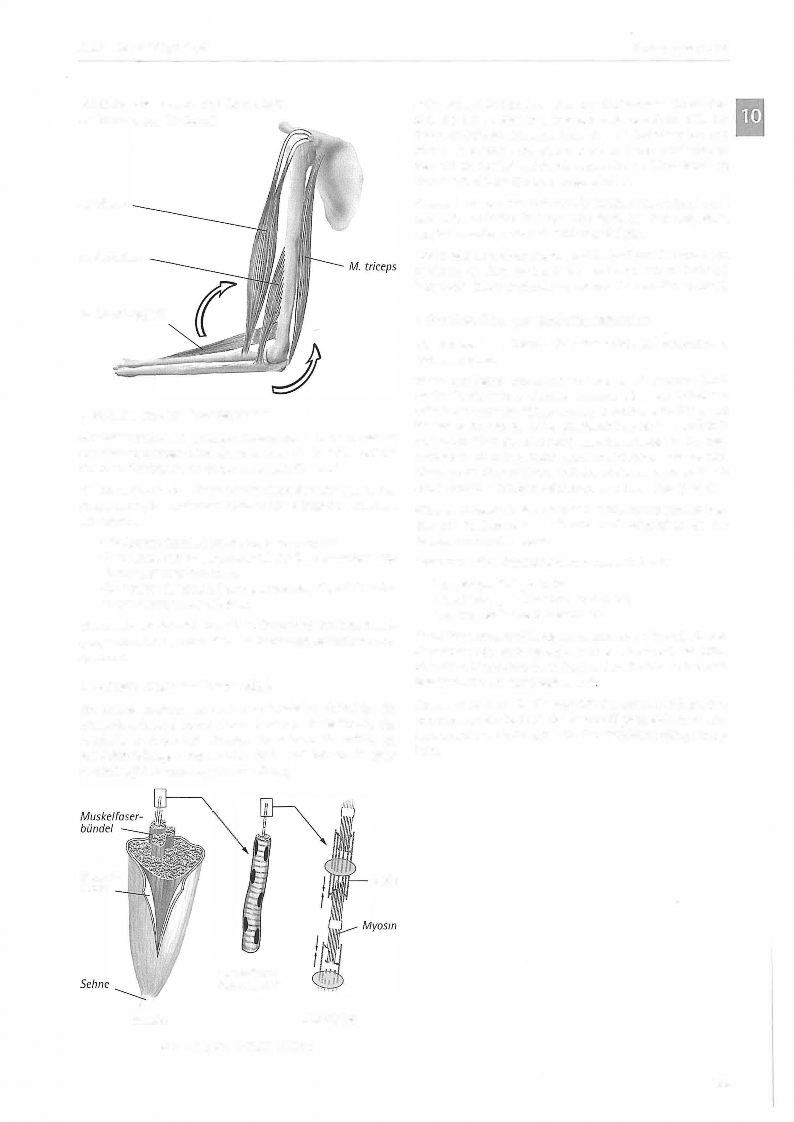
Anatomie und Physiologie
WIRKUNG VON AGONIST UND ANTAGONIST AM BEISPIEL DES ÜBERARMS
M. biceps
M. brachialis
M. brachioradialis
-
Entstehen von Bewegungen
Muskelkontraktionen erzeugen Bewegungen dadurch, dass an den Sehnen gezogen wird, die wiederum die Zugkräfte auf die Knochen übertragen, an denen sie angeheftet sind.
Für die fließende Ausführung der meisten Bewegungen ist das Zusammenspiel mehrerer gleichzeitig wirkender Muskeln erforderlich.
-
Ein Agonist (Spieler) führt eine Bewegung aus.
-
Sein Antagonist (Gegenspieler) ist für die entgegengesetzte Bewegung verantwortlich.
-
Synergisten (Mitspieler) sind die Muskeln, die bei einer Be- wegung zusammen arbeiten.
Wenn sich der Agonist kontrahiert (anspannt) um eine Bewe gung auszuführen, muss sich der Antagonist gleichzeitig ent spannen.
-
-
Aufbau eines Skelettmuskels
Ein Muskel besteht aus mehreren Muskelfaserbündeln. Ein Muskelfaserbündel besteht aus einzelnen Muskelfasern. Die Muskelfaser ist die fadenförmige Muskelzelle. Sie enthält die kontraktionsfähigen Myofibrillen Aktin und Myosin in einer regelmäßigen Anordnung (Querstreifung).
Bewegungsapparat
Jeder Muskel besitzt eine Hülle aus Bindegewebe (Muskelfas zie), die den Muskel in seiner anatomischen Form hält. Die Faszie umhüllt die einzelnen Muskeln und Muskelgruppen und grenzt sie sowohl untereinander als auch vom umliegenden Gewebe ab. Muskel und Faszie setzen sich am Muskelende als Sehne fort, die am Knochen angeheftet ist.
Sehnen bestehen aus zugfesten, kollagenen Faserbündeln und sind unterschiedlich in Länge und Form. Sie sind dick, stark, relativ unelastisch und sehr widerstandsfähig.
Der Muskel ist reich an Nerven und Blutgefäßen. Die rote Farbe verdankt er dem Blutreichtum und dem rotem Farbstoff Myoglobin (Sauerstoffspeicher, Verwandter des Hämoglobins).
-
-
-
-
Stoffwechsel der Skelettmuskulatur
Der Muskel kann Energie für seine Arbeit auf verschiedene Weise gewinnen.
Wenn genügend Sauerstoff vorhanden ist (aerobe Stoff wechsellage), werden Glukose (Traubenzucker) und Fettsäuren
vollständig unter Energiegewinnung zu Kohlendioxid (C02) und Wasser verbrannt. Bei hoher Muskelleistung ist der Sauerstoff
nachschub über das Blut nicht ausreichend. Bei der Energie gewinnung ohne Sauerstoff (anaerobe Stoffwechsellage) wird Glukose erst über mehrere Zwischenstufen umgewandelt. Als Abfallprodukt entstehen Milchsäure und deren Salz (Laktat).
Wird ein Muskel für eine längere Periode angespannt, so wer den die Kontraktionen nach und nach schwächer, bis der Muskel nicht mehr reagiert.
Diese muskuläre Ermüdung wird verursacht durch:
-
ungenügende OrZufuhr
-
Erschöpfung der Reserven an Glukose
-
Anstieg der Laktat-Konzentration
-
Durch konstante, mittellastige Muskelbeanspruchung (z. B. Aus dauersport oder hatha-yoga) erhöht sich die Anzahl der Mito chondrien (Kraftwerke der Zellen) und der Kapillaren des Mus kels (Durchblutung wird verbessert)
Zudem erhöht sich die Vitalkapazität der Lunge. Durch die tiefe Atmung wird das Blut mit viel Sauerstoff angereichert. So wird eine ausreichende Energie- und Sauerstoffversorgung ermög licht.
Muskel faszie
Aktin
Muskel
Muskelfaser (Muskelzelle)
Myofibrille
AUFBAU EINES SKELETTMUSKELS
133
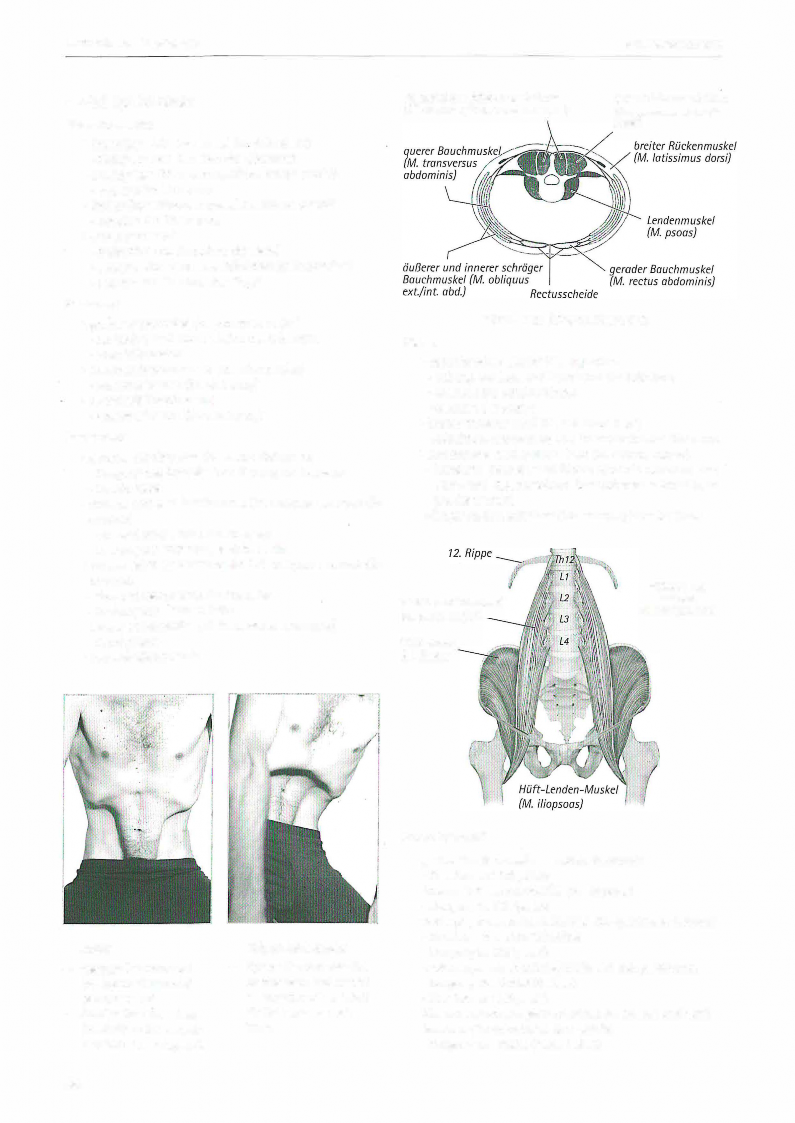
Anatomie und Physiologie Bewegungsapparat
-
Wichtige Muskeln
Obere Extremität
-
dreieckiger Schultermuskel (M deltoideus)
-
Abduktion und Rotation des Oberarms
-
-
zweiköpfiger Oberarmmuskel (M. biceps brachii)
-
Beugung im Unterarm
-
-
dreiköpfiger Oberarmmuskel (M. triceps brachii)
-
Strecken des Unterarms
-
-
Unterarmmuskeln
-
Supination und Pronation der Hand
-
Beugen, Abduktion und Adduktion im Handgelenk
-
Beugen und Strecken der Finger
Brustwand
Autochthone Rückenmuskulatur (M. erector spinae: medialer Trakt)
langer Rückenaufrichter (Longissimus: lateraler Trakt)
-
-
großer Brustmuskel (M. pectoralis major)
-
Adduktion und Innenrotation des Oberarms
Rücken
BAUCH- UND RücKENMUSKULATUR
-
Atemhilfsmuskel
-
-
Zwischenrippenmuskeln (M. intercostales)
-
Atemmuskulatur (Brustatmung)
-
-
Zwerchfell (Diaphragma)
-
Atemmuskulatur (Bauchatmung)
Bauchwand
-
-
gerader Bauchmuskel (M. rectus abdominis)
-
Beugung des Rumpfes bzw. Hebung des Beckens
-
Bauchpresse
-
-
äußerer schräger Bauchmuskel (M. obliquus externus ab dominis)
-
Vor- und Seitneigung des Rumpfes
-
Drehung zur entgegengesetzten Seite
-
-
innerer schräger Bauchmuskel (M. obliquus internus ab dominis)
-
-
trapezförmiger Muskel (M. trapezius)
-
Hebung, Senkung und Retraktion der Schultern
-
Drehung des Schulterblattes
-
Drehung des Kopfes
-
-
breiter Rückenmuskel (M. latissimus clorsi)
-
Adduktion, Retroversion und Innenrotation des Oberarms
-
-
autochthone Rückenmuskulatur (M. erector spinae)
-
hunderte überwiegend kleine Muskeln zwischen den Dorn- und Querfortsätzen benachbarter Wirbelkörper (medialer Trakt)
-
langer Rückenaufrichter (Longissimus; lateraler Trakt)
VERLAUF DER
-
Vor- und Seitneigung des Rumpfes
-
Drehung zur gleichen Seite
-
-
-
Querer Bauchmuskel (M. transversus abdominis)
- Bauchpresse
-
Beckenbodenmuskeln
großer Lendenmuskel (M. psoas major)
Hüftmuskel (M. iliacus)
INNEREN HÜFTMUSKULATUR
Nauli
-
Gerader Bauchmuskel (M. rectus abdominis) ist angespannt.
-
Schräge Bauchmuskeln (M. obliquus int./ext. ab dominis) sind entspannt.
134
Ur;Jr;JTyäna-bandha
-
Querer Bauchmuskel (M. transversum abdominis) ist angespannt und zieht die Bauchdecke nach Innen.
Untere Extremität
-
großer Gesäßmuskel (M. gluteus maximus)
-
Strecken im Hüftgelenk
-
innere Hüft-Lenden-Muskel (M. iliopsoas)
- Beugung im Hüftgelenk
-
-
-
vierköpfiger Oberschenkelmuskel (M. quadriceps femoris)
-
Streckung des Unterschenkels
-
Beugung im Hüftgelenk
-
-
zweiköpfiger Oberschenkelmuskel (M. biceps femoris)
-
Beugung des Unterschenkels
-
Strecken im Hüftgelenk
-
-
Wadenmuskeln (M. gastrocnemius, M. soleus) und Achil lessehne (Tendo calcanei bzw. achillis)
-
Beugung des Fußes (Ferse heben)
-
-
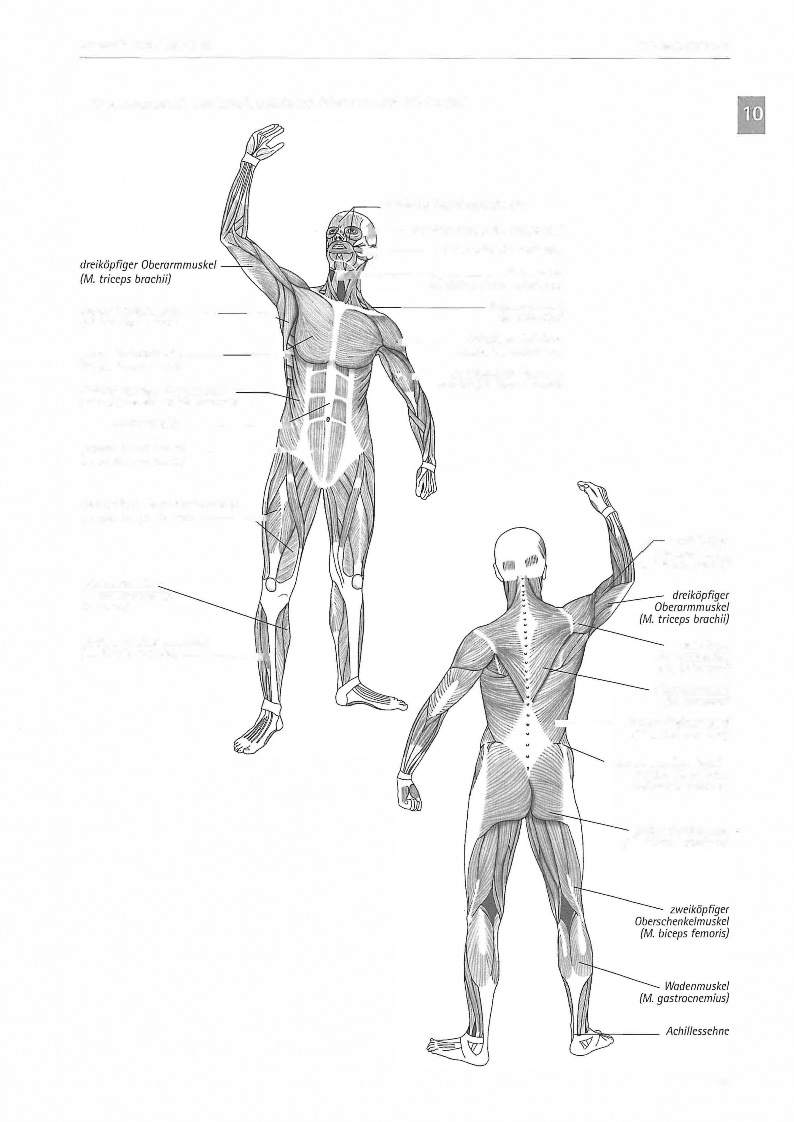
Anatomie und Physiologie Bewegungsapparat
-
Gesamtansicht des Muskelsystems (Vorder- und Rückseite)
breiter Rückenmuskel -- -----...
(M. latissimus dorsi)
großer Brustmuskel -1�
(M. pectoralis major)
äußerer schräger Bauchmuskel (M. obliquus abdominis externus)
Rectusscheide -------1,r.11
gerader Bauchmuskel -------fHr"'--+,
(M. rectus abdominis)
vierköpfiger Oberschenkelmuskel
(M. quadriceps femoris) ---<, &
Wadenmuskeln
(M. gastrocnemius,
M. soleus)
vorderer Schienbeinmuskel
(M. tibialis anterior) ,
mimische Gesichtsmuskulatur
&;--- Schläfenmuskel (M. temporalis)
YJJ Kaumuskel (M. masseter)
a
,1� Halswender
(M. sternoc/eidomastoideus)
Kapuzenmuskel (M. trapezius)
dreieckiger Schulter
muskel (M. deltoideus)
� zweiköpfiger Oberarm
muskel (M. biceps brachii}
zweiköpfiger Oberarmmuskel (M. biceps brachii)
dreieckiger Schultermuskel (M. deltoideus)
Kapuzenmuskel (M. trapezius)
� breiter Rückenmuskel
(M. latissimus dorsi)
äußerer schräger Bauch muskel (M. obliquus abdominis externus)
großer Gesäßmuskel (M. glutaeus maximus)
135
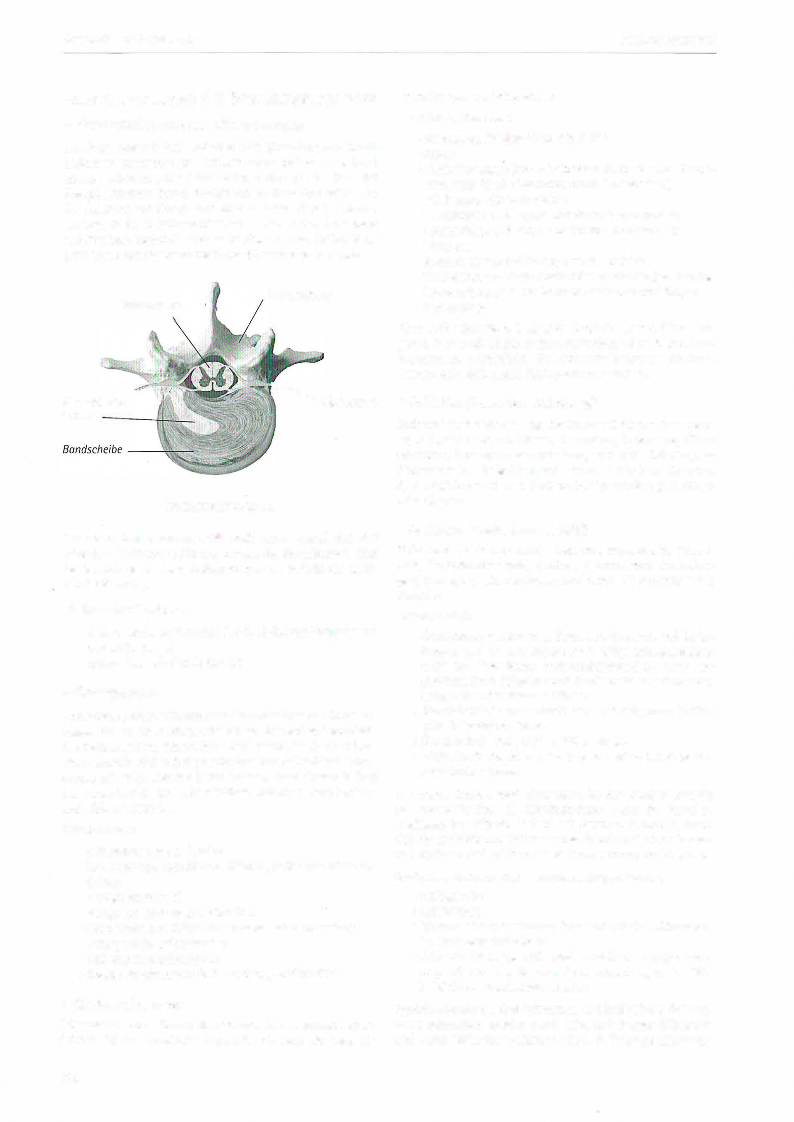
Anatomie und Physiologie
10.2.6 Erkrankungen des Bewegungsapparates
-
Bandscheibenvorfall (Discusprolaps)
Durch ein Missverhältnis zwischen (Fehl-)Belastung und Belast barkeit im Zusammenspiel mit Alterungsvorgängen der Band scheibe (Abnahme des Flüssigkeitsgehalts und der Elastizität des gallertartigen Kerns, Rissbildung im Faserring) wölbt sich der Faserring vor (Protrusion) oder es treten Anteile des Gal lertkerns in die Zwischenwirbellöcher oder in den Spinalkanal aus (Prolaps). Dadurch kann es zu einer schmerzhaften Kom primierung von Nervenwurzeln des Rückenmarks kommen.
Bewegungsapparat
Erkrankungen der Wirbelsäule. Ursachen können sein:
-
verspannte (Rücken-)Muskeln (80%)
-
Stress
-
Fehlbelastungen (am Arbeitsplatz; durch falsches Schuh werk oder falsche Matratze; durch Fettleibigkeit)
-
Fehlhaltung der Wirbelsäule
-
Hohlrücken z. B. wegen verkürzten Psoasmuskeln
-
Rundrücken z. B. wegen verkürzten Brustmuskeln
-
Skoliose
-
-
Bandscheibenvorwölbung/-vorfall, Ischialgie
-
Veränderungen (degenerativ oder entzündlich) an den Ge
Rückenmark
Bandscheiben vorfall
Wirbelkörper
-,,,.,.,
-
Spinalnerv
lenkverbindungen von Brustwirbelkörpern und Rippen
-
-
Osteoporose
Aber auch schwere, z. T.lebensbedrohliche innere Erkrankun gen können Rückenschmerzen verursachen, wie z. B. Knochen metastasen, Herzinfarkt, Bauchspeicheldrüsenentzündung, Nieren- oder Gallenkolik, Eileiterschwangerschaft.
-
-
Arthritis (Gelenkentzündung)
Arthritis ist eine Entzündung der Innenschicht der Gelenkkap sel und geht meist mit Rötung, Schmerzen, Schwellung, Über wärmung, Bewegungseinschränkung und evtl. Gelenkerguss (Flüssigkeit im Gelenkinneren) einher. Zahlreiche Ursachen sind möglich: Infektionen, Stoffwechselkrankheiten (z.B. Gicht)
BAN DSCH EI BENVORFALL
Der akute Bandscheibenvorfall stellt einen Notfall dar, der sofortiger ärztlicher Abklärung bedarf. Als Komplikation kann der komprimierte Nerv absterben bzw. es kommt zur Quer schnittslähmung.
Häufigste Lokalisationen:
-
untere Lendenwirbelsäule (L4-5, LS-51) mit Kompression des Ischiasnerves
-
untere Halswirbelsäule (C6-C7)
-
-
Osteoporose
Unter Osteoporose versteht man eine Abnahme der Knochen masse, die zu einer schmerzhaften mechanischen Instabilität des Skelettes führt, mit erhöhter Gefahr von Knochenbrüchen. Man unterscheidet zwischen primärer und sekundärer Osteo porose (als Folge anderer Erkrankungen). Ganz allgemein liegt der Osteoporose ein Missverhältnis zwischen Knochaufbau und -abbau zugrunde.
Risikofaktoren:
-
Osteoporose in der Familie
-
hoher Konsum von: Alkohol, Nikotin, Kaffee und Milchpro- dukten
-
Bewegungsmangel
-
Mangel an Kalzium und Vitamin D
-
Östrogenmangel (frühe Menopause, keine Geburten)
-
Untergewicht, schlanker Typ
-
Diabetes (Zuckerkrankheit)
-
diverse Medikamente (z.B. Kortison, Abführmittel)
-
-
Rückenschmerzen
Rückenschmerzen können eine Vielzahl von Ursachen haben. Oftmals bilden dauerhaft verspannte Muskeln die Basis für
136
oder Rheuma.
• Arthrose (Gelenkverschleiß)
Unter einer Arthrose versteht man eine degenerative Erkran kung des Gelenkknorpels, welche mit Schmerzen, Schwellun gen, Bewegungseinschränkung und einer Deformierung der Gelenke.
Ursachen sind:
-
Überlastung des Knorpels durch eine dauernde Fehlbelas tung: z. B. kann eine angeborene Hüftgelenksfehlstellung oder ein erworbener Beckenschiefstand zu einer un gleichmäßigen Belastung und damit zu einer Arthrose der entsprechenden Gelenke führen
-
Knorpelschädigungen durch lang zurückliegende Unfälle oder Gelenkoperationen
-
Übergewicht (Knie, Hüften, Wirbelsäule)
-
erblich bedingte Störung des Knorpels, wie z. B. bei der Fin- gergelenksarthrose
Der kranke Knorpel wird abgerieben, bis der Knochen erreicht ist. Gewissermaßen als Abstützreaktion bildet der Knochen Ausläufer. Im weiteren Verlauf der Arthrose kommt es durch den Knorpelabrieb zu Reizungen des Gelenks mit Schwellungen und Ergüssen und später auch zu Verformungen der Gelenke.
Bestimmte Gelenke sind besonders häufig betroffen:
-
Hüftgelenke
-
Kniegelenke
-
Fingergelenk-Polyarthrose: Fingerendgelenke, Mittelgelen ke, Daumensattelgelenke
-
Arthrose der kleinen Wirbelsäulengelenke, häufig zusam men mit anderen degenerativen Erkrankungen der Wir belsäule wie Bandscheibenleiden
Typische Symptome sind Schmerzen und Steifheit der Gelenke. Diese Schmerzen werden durch kalte und feuchte Witterung und durch stoßartige Belastung wie z. B. Treppensteigen ver-
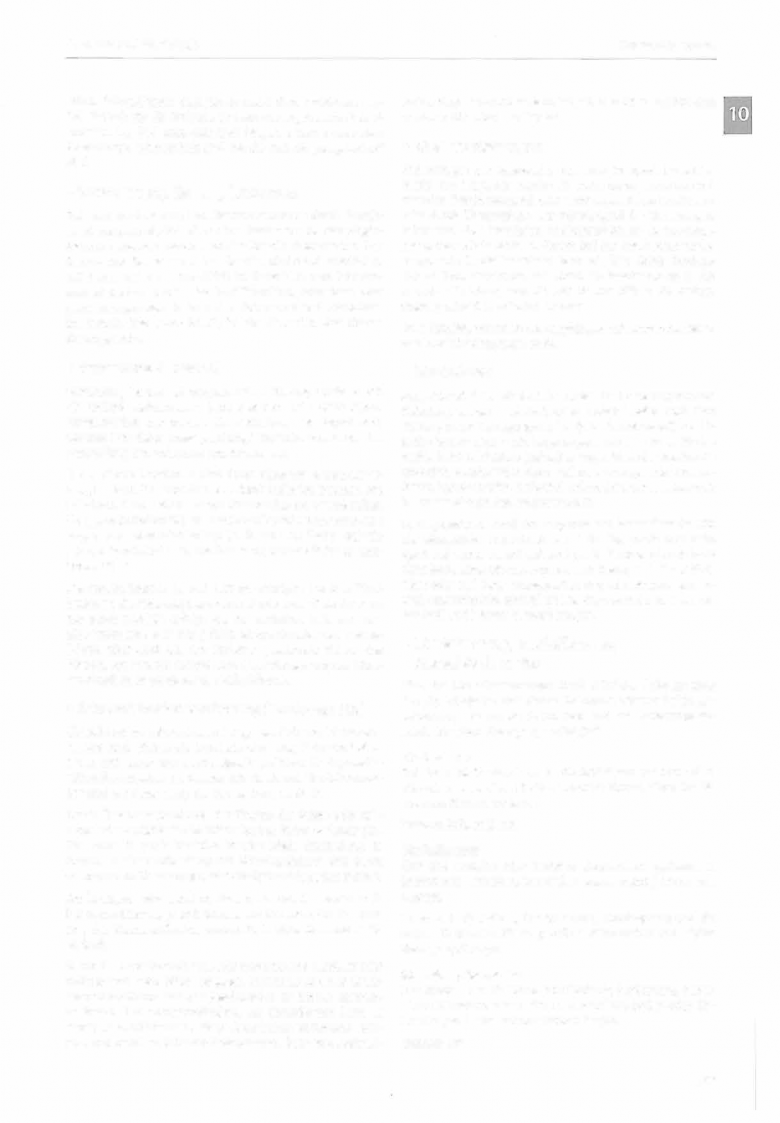
Anatomie und Physiologie
stärkt. Fahrradfahren dagegen ist meist ohne Probleme mög lich. Typisch für die Arthrose ist auch der sogenannte Anlauf schmerz. Das bedeutet, dass nach längerem Ruhen die ersten Bewegungen schmerzhaft sind, bis die Gelenke „eingelaufen" sind.
• Verstauchung, Zerrung (Distorsion)
Bei einer Verstauchung bzw. Zerrung kommt es durch Gewalt einwirkung auf ein Gelenk zu einer Bewegung, die den physio logischen Bewegungsspielraum des Gelenks überschreitet. Der Kapsel- und Bandapparat des Gelenks wird dabei geschädigt, mit daraus folgender Instabilität im Gelenk. Je nach Schwere grad ist die Kapsel oder das Band überdehnt, angerissen oder ganz durchgerissen. Es kommt zu Schmerzen und Schwellung im Gelenk. Besonders häufig ist die Distorsion des oberen Sprunggelenks.
• Verrenkung (Luxation)
Verrenkung ist die pathologische Verschiebung zweier durch ein Gelenk verbundener Knochenenden mit vollständigem Kontaktverlust der beiden Gelenkflächen. Der Kapselband apparat wird dabei meist geschädigt. Typische Anzeichen sind Fehlstellung, Schonhaltung und Schmerzen.
Traumatische Luxationen sind durch abnorme Gewalteinwir kung bedingt. Sie entstehen v. a. durch indirekte Traumen wie bei einem Sturz, seltener durch direkten Zug am Gelenk selbst. Von „gewohnheitsmäßigen Luxationen" spricht man, wenn eine angeborene Gelenkfehlanlage (z. B. eine zu flache Gelenk pfanne) bereits bei normaler Belastung immer wieder zu Luxa tionen führt.
Die Schulterluxation ist mit 50% die häufigste Luxation über haupt. Da die Fixierung des Oberarmkopfs in der Gelenkpfanne nur durch Muskeln erfolgt, die Gelenkflächen klein sind und eine knöcherne Hemmung fehlt, ist die Schulter das beweg lichste, aber auch das am stärksten gefährdete Gelenk des Körpers. Am meisten kommt es zu einer Verlagerung des Ober armskopfs nach vorne vor die Gelenkfläche.
• Sehnenschei denentzündung (Tendovaginitis)
überall dort, wo Sehnen besonders großen Reibungskräften aus gesetzt sind, gleiten sie innerhalb einer sog. Sehnenscheide. Diese mit einer Schmierflüssigkeit gefüllten Bindegewebs schläuche umgeben die Sehnen wie ein Tunnel. Die Sehnen sel ber sind von einer Haut, der Sehnenhaut, umhüllt.
Durch Überbeanspruchung oder Trauma der Sehne oder Seh nenscheide entwickeln sich mikroskopisch kleine Verletzungen. Die darauf folgende Reaktion ist eine lokale Entzündung. Es kommt zu einer Schwellung mit Wandverdickung und damit verbunden zu Einengungen, was wiederum Schmerzen auslöst.
Am häufigsten sind dabei die Sehnen der Hand betroffen (z. B. bei Sekretärinnen), jedoch können die Beschwerden durchaus an jeder Sehne auftreten, sofern sie in einer Sehnenscheide verläuft.
Wenn das betroffene Gelenk nicht entsprechend geschont oder ruhig gestellt wird (Gips, Schiene), kommt es zu einer deutli chen Verschlimmerung der Beschwerden bis hin zur schmerz bedingten Bewegungsunfähigkeit. Als Komplikation kann es durch Narbenbildung zu einer dauerhaften Verengung kom men und damit zu Schnapp-Phänomenen. Beim sog. ,,Schnell-
Bewegungsapparat
enden Finger" kommt es dann bei jedem Beugen und Strecken zu einem Einrasten des Fingers.
• Muskelverletzungen
Verletzungen der Muskulatur kommen im Sport besonders häufig vor. Ausgelöst werden sie meist durch einen unzurei chenden Trainingszustand, eine nicht angewärmte Muskulatur oder durch Übermüdung. Der Schweregrad der Verletzungen reicht vom eher harmlosen Muskelkater bis hin zu Zerreißun gen ganzer Muskelstränge. Gerade bei den schwereren Verlet zungen wie Muskelfaserrissen kann mit Hilfe richtig durchge führter Erstmaßnahmen und durch die Beachtung einer ver ordneten Trainingspause die Zeit bis zur völligen Wiederher stellung erheblich reduziert werden.
Grundsätzlich minimiert ein sorgfältiges Aufwärmen das Risiko von Muskelverletzungen stark.
• Muskelkater
Ausgelöst wird der Muskelkater meist durch eine ungewohnte Belastung einzelner Muskelpartien, beispielsweise nach dem Training neuer Bewegungsmuster (z. B. Sonnengebet). Als Ur sache kommt nicht - wie lange angenommen - die im Muskel verbliebene Milchsäure (Laktat) in Frage. Vielmehr werden die typischen Beschwerden durch Mikroverletzungen der Muskel fasern hervorgerufen, aufgrund unkoordinierter Muskelarbeit bei ungewohnten Bewegungsmustern.
Im Gegensatz zur Muskelzerrung oder zum Muskelfaserriss tritt der Muskelkater niemals direkt bei der Yogapraxis oder beim Sport auf, sondern setzt erst nach ca. 24 Stunden ein und kann dann bis zu einer Woche andauern. Die Beweglichkeit und Kraft einer oder mehrerer Muskelpartien sind schmerzbedingt dras tisch eingeschränkt. Sinnvoll ist hier Wärmezufuhr (z. B ein hei ßes Bad) und leichtes Weiterbewegen.
• Muskelzerrung, Muskelfaserriss, Muskel-/Sehnenriss
Dies sind Muskelverletzungen durch plötzliche Dehnung über das physiologische Maß hinaus. Es kommt sofort zu heftig ein setzenden, stechenden Schmerzen und zur Bewegungsein schränkung bzw. Bewegungsunfähigkeit.
Muskelzerrung
Bei dieser leichtesten Form ist die Schädigung nur unter dem Mikroskop erkennbar. Die Beschwerden können einen Tag bis mehrere Wochen andauern.
THERAPIE: Ruhigstellung
Muskelfaserriss
Hier sind einzelne oder mehrere Muskelfasern gerissen. Es kommt zum Hämatom. Die Heilungsdauer beträgt bis zu drei Monate.
THERAPIE: Ruhigstellung, Druckverband, Hochlagerung und die ersten 48 Stunden Kühlung; später Wärmezufuhr und leichte Bewegungsübungen.
Muskelriss/ Sehnenriss
Der Muskel oder die Sehne ist vollständig durchtrennt. Neben einem Hämatom zeigen sich u. U. deutliche Dellen oder Ein buchtungen in der entsprechenden Region.
THERAPIE: OP
137
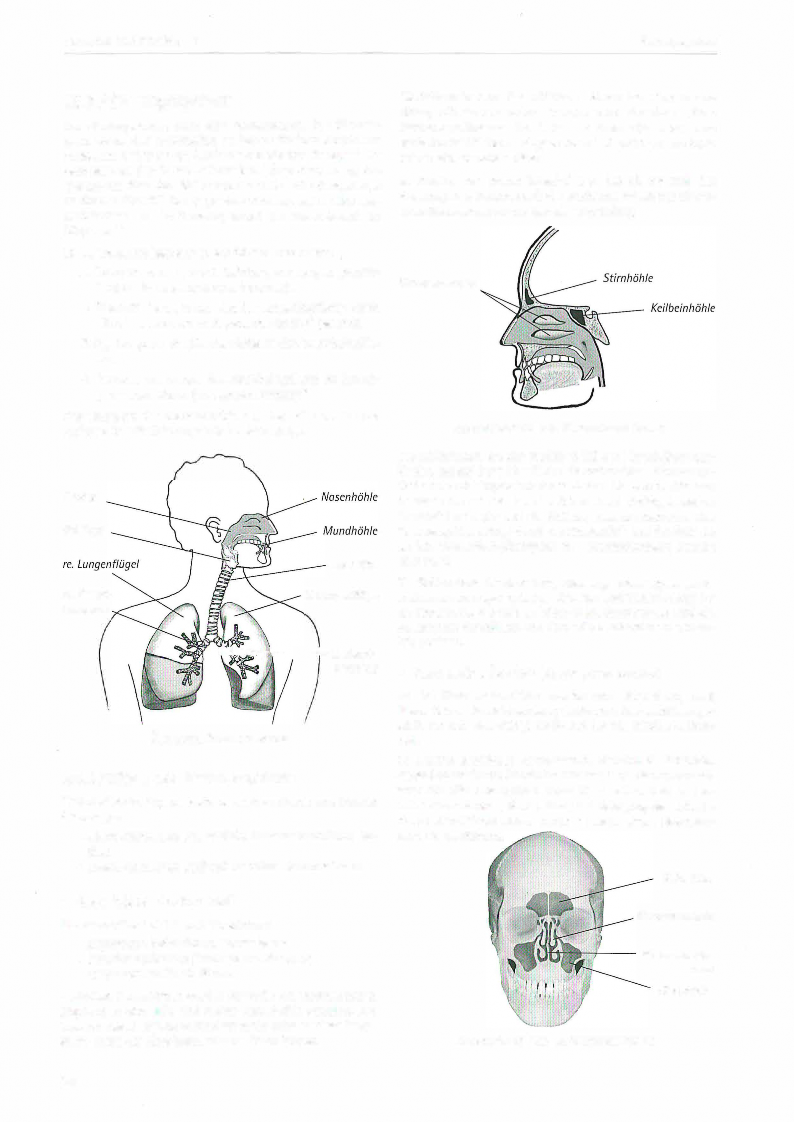
Anatomie und Physiologie
-
-
-
Atmungssystem
Das Atmungssystem dient dem Gasaustausch. Der überwie gende Anteil der Körperzellen hat keinen direkten Kontakt zur Außenluft. Daher ist ein Mechanismus für den Transport der Atemgase zu den Zellen erforderlich. Unter Ausnutzung des Transportes über den Blutkreislauf und des Diffusionsprinzips an dünnen Grenzflächen(= passiver Gasaustausch in den Lun genbläschen und im Gewebe) findet der Gasaustausch im Körper statt.
Dieser Transport lässt sich in vier Schritte unterteilen:
-
Transport von 02 durch Belüftung der Lungen (Ventila tion) in die Lungenbläschen(Alveolen).
-
Übertritt des o2 in das Blut der Lungenkapillaren durch Diffusion. Dies wird auch „äußere Atmung" genannt.
-
DrTransport mit Hilfe des Blutes zu den Gewebekapilla ren.
-
Diffusion von 02 aus den Gewebekapillaren zu den an grenzenden Zellen(sog. ,, innere Atmung")
Der Transport des Kohlendioxids von den Körperzellen zur Außenwelt verläuft in umgekehrter Reihenfolge.
Rachen Kehlkopf
Atmungssystem
Die Seitenwände der Nasenhöhlen erfahren durch jeweils eine obere, mittlere und untere Nasenmuschel eine starke Ober flächenvergrößerung. Damit hat die Nasenschleimhaut eine große Kontaktfläche zur eingeatmeten Luft und kann ihre Funk tionen wirkungsvoll erfüllen.
Im Bereich der oberen Muschel und des oberen Teils des Nasenseptums befindet sich die Riechschleimhaut mit zahlrei chen Riechnerven für die Geruchsempfindung.
Nasenmuscheln
NASENMUSCHELN UND NASENNEBENHÖHLEN
Die Schleimhaut, die den restlichen Teil der Nasenhöhlen aus kleidet, hat auf ihrer Oberfläche ein mehrreihiges Flimmerepi thel sowie schleimproduzierende Zellen. Die Flimmerhärchen bewegen die auf der feuchten Schleimhaut niedergelassenen Staubteilchen rhythmisch in Richtung Nasenrachenraum. Das Flimmerepithel reinigt damit die Einatemluft und feuchtet sie an (die Wasserdampfsättigung im Nasenrachenraum beträgt
re. Haupt bronchus
Luftröhre über 90%).
Ein dichtes Geflecht feiner Blutgefäße, sog. Anastomosen (Kurz-
li. Lungenflügel schlussverbindungen zwischen Arterien und Venen), sorgt für die Erwärmung der Luft. Je kälter es ist, desto stärker wird die Schleimhaut durchblutet und damit die durchströmende Atem-
luft erwärmt.
��;,--....,.\----1- li. Haupt
bronchus
ÜBERSICHT ÄTMUNGSSYSTEM
-
Aufbau des Atmungssystems
Die luftleitenden Organe bestehen aus den oberen und unteren Atemwegen:
-
obere Atemwege: Nasenhöhle, Nasennebenhöhlen, Ra chen
-
untere Atemwege: Kehlkopf, Luftröhre, Bronchialbaum
-
Nasenhöhle (Cavitas nasi)
Die Nasenhöhle hat folgende Funktionen:
-
Erwärmung, Befeuchtung, Vorreinigung
-
Geruchsempfindung(Kontrolle der Atemluft)
-
Resonanzraum für die Stimme
-
Die beiden Nasenhöhlen werden durch die Nasenscheidewand (Septum) in eine linke und rechte Nasenhöhle getrennt. Am äußeren Naseneingang verhindern mehr oder weniger lange, starre Haare das Eindringen größerer Fremdkörper.
138
-
Nasennebenhöhlen (Sinus paranasales)
Zu den Nasennebenhöhlen werden zwei Stirnhöhlen, zwei Kieferhöhlen, die Siebbeinzellen sowie zwei Keilbeinhöhlen ge zählt. Sie sind über Gänge direkt mit der Nasenhöhle verbun den.
Die Nasennebenhöhlen vermindern das Gewicht des Schädels. Sie sind ebenfalls mit Schleimhaut bedeckt und dienen der wei teren Oberflächenvergrößerung der Nasenschleimhaut und so mit der Vorwärmung, Befeuchtung und Reinigung der Luft. Die Nasennebenhöhlen bilden darüber hinaus einen Resonanz raum für die Stimme.
Stirnhöhle
Nasenmuscheln
Nasenscheide
wand Kieferhöhle
NASENHÖHLEN UND NASENNEBENHÖHLEN
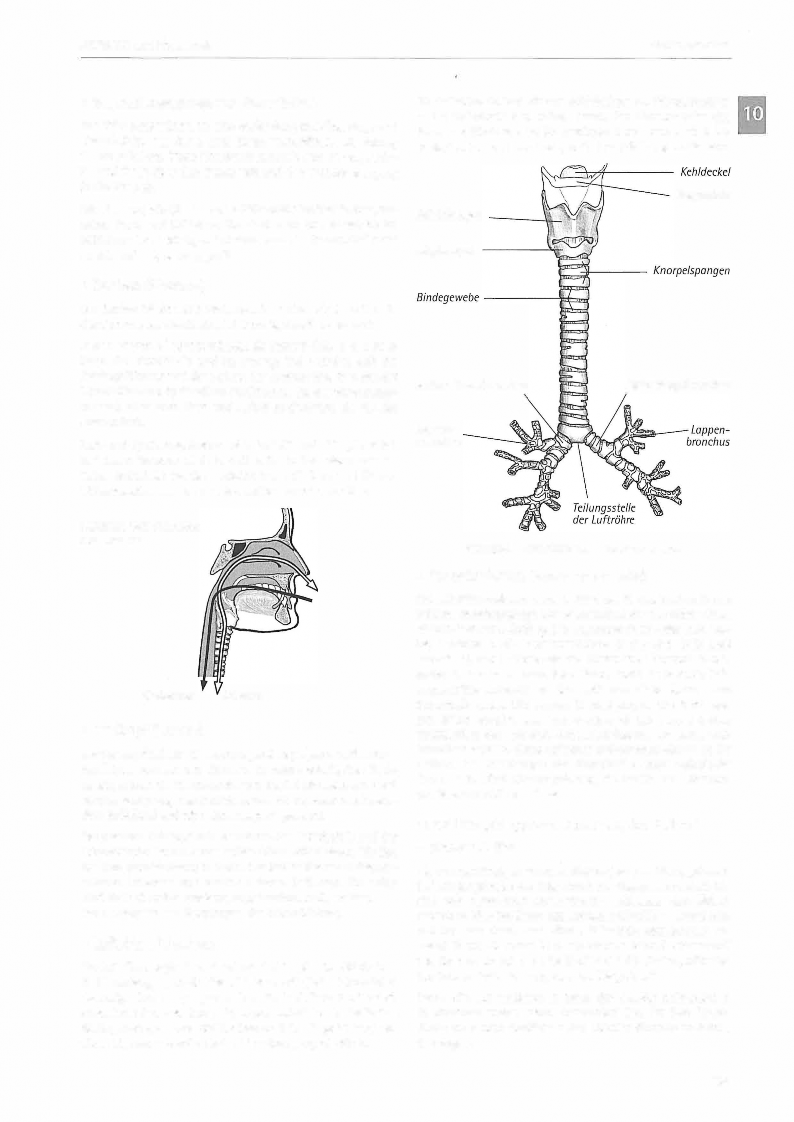
Anatomie und Physiologie
-
Verbindungsgänge zur Nasenhöhle
Der Tränennasenkanal ist eine Verbindung zwischen Auge und Nasenhöhle. Das Auge wird durch Tränenflüssigkeit ständig feucht gehalten. Diese Flüssigkeit sammelt sich im Augenwin kel und fließt über den Tränensack und den Tränennasengang in die Nase ab.
Die Ohrtrompete {Eustachische Röhre) ist eine Verbindung zwi schen Nase und Mittelohr. Sie dient dem Druckausgleich im Mittelohr. Damit wird gewährleistet, dass das Trommelfell nicht zu sehr unter Spannung gerät.
-
Rachen (Pharynx)
Der Rachen ist ein mit Schleimhaut bedeckter Muskelschlauch, der sich von der Schädelbasis bis zur Speiseröhre erstreckt.
In den oberen Abschnitt mündet die Nasenhöhle, in den mitt leren die Mundhöhle und im unteren Teil befinden sich die Kehlkopföffnung und der Anfang der Speiseröhre. Er verbindet Mundhöhle und Speiseröhre (Funktion als Teil des Verdauungs traktes), aber auch Nase und Luftröhre (Funktion als Teil des Atemtrakts).
Luft- und Speiseweg kreuzen sich im Mittelteil. Die „Umschal ter" dieser Kreuzung sind der Kehldeckel und das Gaumensegel. Beim Schluckakt werden reflektorisch Luftröhre und Nasen höhle verschlossen, um so ein Verschlucken zu vermeiden.
Atmungssystem
Die Luftröhre ist bedeckt von Schleimhaut mit Flimmerepithel und schleimbildenden Zellen. Durch den Flimmerschlag des Flimmerepithels werden Fremdkörper zurück zum Rachen be fördert, d. h. nach oben transportiert, um die Lunge zu säubern.
Zungenbein
Schildknorpel Ringknorpel
rechter Hauptbronchus linker Hauptbronchus
Lappen bronchus
KREUZUNG VON SPEISEWEG UND LUFTWEG
Speiseweg
-
Kehlkopf (Larynx)
Luftweg
KEHLKOPF, LUFTRÖHRE UND HAUPTBRONCHIEN
-
Bronchialbaum (Arbor bronchialis)
Die Luftröhre teilt sich etwa in Höhe des S. Brustwirbels in die beiden Hauptbronchien. Der Wandaufbau der Hauptbronchien gleicht dem der Luftröhre. Die Hauptbronchien teilen sich wei ter, zunächst in die Lappenbronchien (rechts drei, links zwei Hauptäste) und danach wie das Geäst eines Baumes immer weiter in immer kleinere Äste. Durch mehr als zwanzig Teil ungsschritte entsteht so das weit verzweigte System des Bronchialbaumes. Die letzten Verzweigungen, die Bronchioli mit einem Durchmesser von weniger als 0,5 mm, münden schließlich in den Alveolen, den Lungenbläschen. Je kleiner die
Der Kehlkopf hat ein röhrenförmiges Knorpelgerüst mit mehre ren feinen Muskeln und Bändern. Zu seinen wichtigsten Struk turen gehören die Stimmbänder und der Kehldeckel. Der scharf kantige Vorsprung des Schildknorpels ist bei Männern beson ders auffallend und wird „Adamsapfel" genannt.
Der gesamte Kehlkopf, mit Ausnahme des Kehldeckels und der Stimmbänder, ist von einer gefäßreichen Schleimhaut (ähnlich der Nasenschleimhaut) bedeckt. Der Kehldeckel verschließt die unteren Luftwege und regelt so deren Belüftung. Zusätzlich wird die Luft weiter erwärmt, angefeuchtet und gereinigt.
Der Kehlkopf ist das Hauptorgan der Stimmbildung.
-
Luftröhre (Trachea)
-
Die Luftröhre beginnt unterhalb des Kehlkopfs und bildet einen 10-12 cm langen, muskulösen Schlauch mit glatter Muskulatur. (-förmige Knorpelspangen halten die Luftröhre mechanisch offen. Zwischen den Knorpelspangen befindet sich elastisches Bindegewebe, so dass die Trachea auch in Längsrichtung ela stisch ist, was besonders beim Schluckvorgang wichtig ist.
Bronchien werden, desto einfacher und dünnwandiger wird ihr Aufbau. Die Wandungen der Bronchioli werden vollständig durch glatte Muskelfasern gebildet, die den Zu- und Abstrom der Atemluft aktiv regulieren.
-
-
-
Lungen (griech. Pneumas; /at. Pulmo)
-
Innerer Aufbau
Die traubenförmigen Alveolen stellen das eigentliche, ,,atmen de" Lungengewebe dar. Hier findet der Gasaustausch statt. Sie sind von netzförmig angeordneten, kleinsten Blutgefäßen umwoben (den Kapillaren des Lungenkreislaufs). Hier sind Blut und Luft nur durch eine dünne Zellschicht voneinander ge trennt. Durch diese sog. Blut-Luft-Schranke kann der Sauerstoff von der Alveolarluft rasch ins Kapillarblut übertreten, während das Kohlendioxid den umgekehrten Weg nimmt.
Damit die Lungenbläschen trotz der ständig auftretenden Druckschwankungen nicht zusammenfallen, ist ihre Innen fläche von einem stabilisierenden Lipidfilm (Surfactant-Factor) überzogen.
139
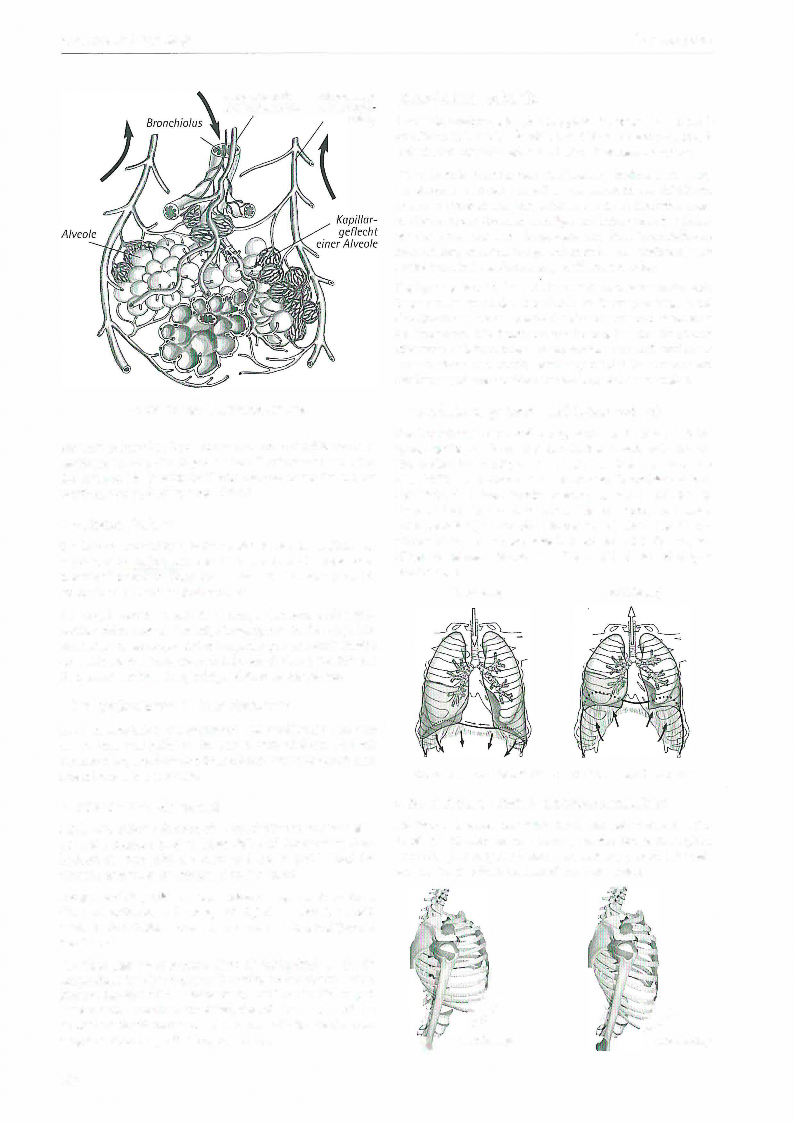
Anatomie und Physiologie Atmungssystem
Lungenarterie (sauerstoffarm)
ALVEOLEN UND LUNGENGEFÄSSBAUM
Lungenvene (sauerstoff
reich)
-
-
-
Atemmechanik
Durch die Einatmung (Inspiration) gelangt frische, sauerstoffrei che Atemluft in die Lungenbläschen. Mit der Ausatmung (Exspi ration) wird kohlendioxidreiche Luft nach außen abgegeben.
Die treibende Kraft für den Gasaustausch zwischen den Lun genbläschen und der Umwelt ist die Differenz des Luftdrucks zwischen Umwelt und Lungenbläschen. Beim Einatmen muss der Druck in den Alveolen niedriger und beim Ausatmen höher als der Druck der Umgebung sein. Um diese Druckdifferenz herzustellen, muss das Lungenvolumen bei der Einatmung ver größert und bei der Ausatmung verkleinert werden.
Die Lunge selbst ist elastisch, kann sich aber selbst nicht aktiv bewegen. Aufgrund des Unterdrucks im Pleuraspalt folgt sie bei den Atembewegungen passiv der Erweiterung und Verengung im Brustraum. Die Brustraumerweiterung bei der Einatmung führt zur Ausdehnung des Lungengewebes und Luft wird in die Lungen eingesaugt. Durch Verengung bei der Ausatmung wird das Lungenvolumen verkleinert und Luft wird ausgestoßen.
-
-
-
-
Bauchatmung: Zwerchfell (Diaphragma)
Das Zwerchfell ist eine breite, kuppelartig nach oben gewölbte
Zusammen bestehen beide Lungen aus ca. 300 Millionen Lun genbläschen, von denen jedes einen Durchmesser von etwa 0,2 mm hat. Die Gesamtoberfläche, die zum Gasaustausch zur Verfügung steht, beträgt etwa 100 m'.
-
Äußerer Aufbau
Die beiden Lungenflügel befinden sich in der Brusthöhle und werden nach außen von den Rippen und nach unten vom Zwerchfell begrenzt. Nach oben ragen die Lungenspitzen bis etwas über die Schlüsselbeine hinaus.
Die Hauptbronchien sowie die versorgenden Blut- und Lymph gefäße treten über die jeweilige Lungenpforte in die Lunge hin ein. Jeder Lungenflügel wird in Lungenlappen unterteilt (rechts drei, links zwei). Durch die nach links verschobene Position des Herzens ist der linke Lungenflügel kleiner als der rechte.
-
Lungenkreislauf (Kleiner Kreislauf)
Die Lungenarterien transportieren sauerstoffarmes Blut von der rechten Herzhälfte in die Lunge. Dort wird das Blut mit Sauerstoff angereichert und über die Lungenvenen zurück zum linken Herzen transportiert.
-
Lungen- und Rippenfell
Beide Lungenflügel sind von einer hauchdünnen und sehr glat ten Hülle überzogen, dem Lungenfell. Auf der anderen Seite bedeckt das Rippenfell die Brustwand, das Zwerchfell und das mittlere Gebiet des Brustraums (Mediastinum).
Lungen- und Rippenfell grenzen aneinander, getrennt nur durch einen ultradünnen, mit wenig Flüssigkeit ausgefüllten Spalt raum. Beide Fellblätter zusammen werden als Brustfell (Pleura) bezeichnet.
Die Flüssigkeit im Spaltraum dient als Gleitmittel, damit die Lungenflügel bei der Atmung reibungsfrei im Brustraum gleiten können. Die dünne Flüssigkeitsschicht sowie der im Pleuraspalt herrschende Unterdruck bewirken, dass die Lungenoberfläche an der Brustkorbinnenwand anhaftet und alle Brustkorbbewe gungen auf die Lunge übertragen werden.
140
Muskelplatte, die Brust- und Bauchhöhle voneinander trennt. Die beiden Lungenflügel ruhen auf dem Zwerchfell und das Herz ist über den Herzbeutel fest mit dem Zwerchfell verbun den. Zieht sich dieser Muskel zusammen, dann senkt sich die Kuppel hinab in den Bauchraum. Die Bauchorgane werden dabei verdrängt, so dass sich die Bauchdecke hebt. Die Pleura höhlen hingegen werden erweitert, so dass sich die Lungen flügel ausdehnen können. Das Zwerchfell ist der wichtigste Atemmuskel.
Einatmung Ausatmung
BEWEGUNG DES ZWERCHFELLS BEIM EIN- UND AUSATMEN
-
-
-
-
-
Brustatmung: Zwischenrippenmuskulatur
Die Rippen besitzen zur Wirbelsäule hin kleine Gelenke. Der Brustkorb ist also bis zu einem gewissen Grade beweglich. Durch Anspannung der äußeren Zwischenrippenmuskeln wei tet sich der Brustkorb und damit auch die Lunge.
·v
_..,
)}
-.·...:1..t
-�
d) · Einatmung Ausatmung
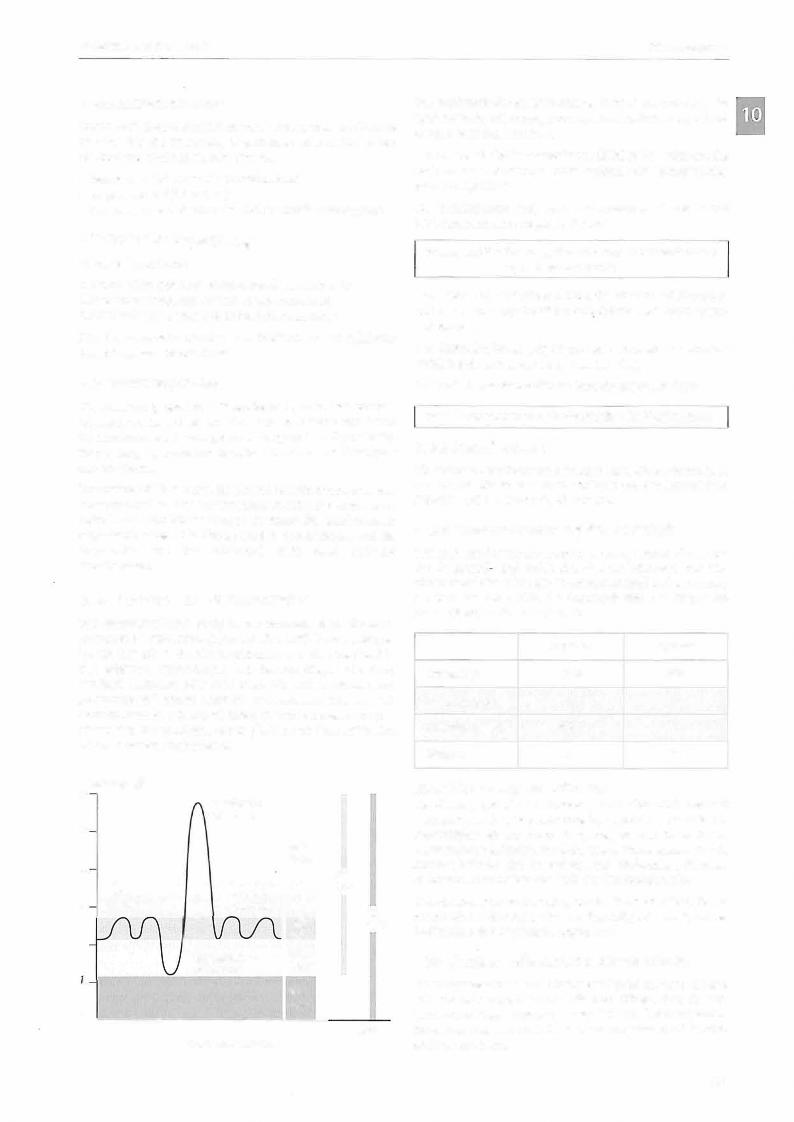
Anatomie und Physiologie
-
Atemhilfsmuskulatur
Es gibt noch andere Muskeln, die zwar nicht primär der Atmung dienen, aber die Einatmung unterstützen können. Besonders bei Atemnot kommen sie zum Einsatz.
-
Halswender (M. sternocleidomastoideus)
-
Treppenmuskel (M. scaleni)
-
kleiner u. großer Brustmuskel (M. pectoralis major/minor)
-
Vollständige Yogaatmung
Ab der 8. Yogastunde:
-
Bauch wölbt sich nach vorne (Zwerchfell senkt sich)
-
Brustkorb weitet sich (Zwischenrippenmuskeln)
-
Schlüsselbeine heben sich (Atemhilfsmuskulatur)
Alle Lungenareale werden gut belüftet. In umgekehrter Reihenfolge wieder ausatmen.
-
-
Ausatmungsprozess
Die Ausatmung geschieht überwiegend passiv. Das vormals angespannte Zwerchfell erschlafft und wird durch den Druck im Bauchraum nach oben gepresst. Aufgrund der Eigenelastizi tät von Lungengewebe und Brustkorb kommt es zur Verengung des Brustkorbs.
Unterstützend können sich die inneren Zwischenrippenmuskeln zusammenziehen. Bei angestrengter Ausatmung sowie auch beim Husten und Niesen können zusätzlich die Bauchmuskeln eingesetzt werden. Die Rippen werden herabgezogen und die Eingeweide und das Zwerchfell nach oben gepresst (Bauchpresse).
-
-
-
Lungen- und Atemvolumina
-
-
Das Atemzugvolumen (AZV) ist das Volumen eines einzelnen Atemzugs bei Ruheatmung (ca. 0,5 Liter Luft). Davon gelangen jedoch nur 2/3 in die Lungenbläschen. Der Rest verbleibt in den größeren, dickwandigen luftleitenden Wegen wie Nase, Kehlkopf, Luftröhre oder Bronchien. Die Luft in diesem sog.
,,Atemtotraum" nimmt nicht am Gasaustausch teil. Das Tot raumvolumen ist mit 150 ml konstant. Wird schneller und we niger tief geatmet {,,flache Atmung"), dann wird die Luft in den Alveolen weniger aufgefrischt.
Volumen(/)
6 maximales
Einatmen
5
IRV
Atmungssystem
Das inspiratorische Reservevolumen (IRV) ist das Volumen, das nach normaler Einatmung noch maximal zusätzlich eingeatmet werden kann (ca. 2-3 Liter).
Das expiratorische Reservevolumen (ERV) ist das Volumen, das nach normaler Ausatmung noch maximal ausgeatmet werden kann (ca. 1,0 Liter) .
Die Vitalkapazität (VK) bzw. das maximale Atemvolumen berechnet sich nach folgender Formel:
Vitalkapazität= Atemzugvolumen+ insp. Reservevolumen+ expir. Reservevolumen
Dieser Wert ist abhängig von Alter, Geschlecht und Körperbau und kann durch regelmäßigen pränäyäma oder Sport gestei gert werden.
Das Residualvolumen (RV) ist die nach maximaler Ausatmung verbleibende Luft in der Lunge (ca. 1,2 Liter).
Die totale Lungenkapazität (TK) berechnet sich wie folgt:
Max. Lungenvolumen= Vitalkapazität+ Residualvolumen
10.3.S Atemfrequenz
Die normale Atemfrequenz beträgt in Ruhe 12-16 Atemzüge in der Minute. Sie ist aber stark abhängig von der körperlichen Aktivität und damit vom OrVerbrauch.
-
-
-
Zusammensetzung der Atemluft
Wie man aus der Tabelle entnehmen kann, verändert sich nur der Sauerstoff und Kohlendioxidgehalt. Während der Ein atmung wird aber nicht der gesamte Sauerstoff aufgenommen, sondern nur etwa 21%. Im Austausch gibt der Körper 5% Kohlendioxid an die Außenluft ab.
Inspiration
Expiration
Stickstoff (N2l
780/o
780/o
Sauerstoff (02)
210/o
160/o
Kohlendioxid (C02)
0,030/o
50/o
Edelgase
10/o
10/o
-
Steuerung der Atmung
Die Atmung geschieht unbewusst, kann aber auch bewusst gesteuert werden. Die unbewusste, rhythmisch verlaufende Atemtätigkeit ist nur durch Taktgeber, die sich im zentralen
Nervensystem befinden, möglich. Dieses Steuersystem für die
4
normale
3 Atmung
2
normale Atmung
maximales Ausatmen
2-3 I
AZV
0,5/
ERV
1,0/
RV
1,21
VK
4,5/
TK
5,7 I
Atmung befindet sich im verlängerten Rückenmark (Medulla oblongata) unmittelbar oberhalb des Halsrückenmarks.
Das Atemzentrum steuert die gesamte Atemmuskulatur. Durch verschiedene Atemreize wird die Atemtätigkeit ständig an die Bedürfnisse des Organismus angepasst:
-
Mechanisch-reflektorische Atemkontrolle
Dehnungsrezeptoren in der Lunge senden bei starker Dehnung oder Verkleinerung Reize aus, die dazu führen, dass die ent
0-------------�--�
LUNGENVOLUMINA
Zeit
sprechende Gegenbewegung ausgelöst wird. Dehnungsrezep toren befinden sich auch in allen Atemmuskeln (und in allen anderen Muskeln).
141
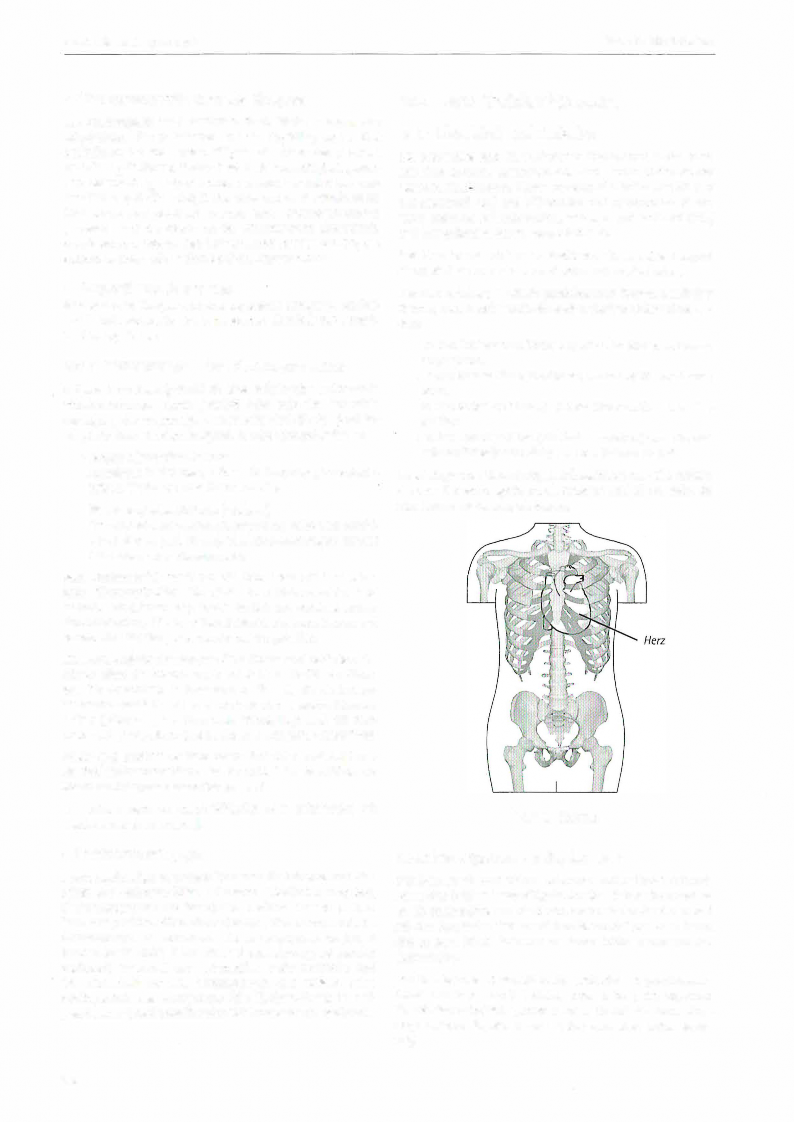
Anatomie und Physiologie
• Atmungskontrolle über die Blutgase
Die Atemtätigkeit wird zusätzlich durch Veränderungen des COrGehalts, des pH-Wertes und der OrSättigung im Blut beeinflusst: Bei steigendem COrGehalt sinken der pH-Wert und die OrSättigung. Dadurch wird die Atemtätigkeit gestei
gert, vermehrt 02 aufgenommen und auch vermehrt C02 aus
geschieden (pH-Wert steigt). Der COr und OrPartialdruck im Blut sowie der pH-Wert werden über Chemorezeptoren gemessen und die Werte an das Atemzentrum übermittelt.
Von diesen drei Werten hat der vermehrte Anstieg von C02 die stärkste aktivierende Wirkung auf das Atemzentrum.
• Unspezifische Atemreize
Schmerz- oder Temperaturreize, psychische Erregung, Muskel arbeit und bestimmte Hormone können ebenfalls zu verstärk ter Atmung führen.
-
-
Erkrankungen des Atmungssystems
Asthma bronchiale (griech.) ist eine anfallsweise auftretende Atembeklemmung durch gänzlich oder teilweise reversible Verengung der Atemwege. Mittlerweile sind 4% der Bevölke rung betroffen, Tendenz steigend. Es wird unterschieden in:
-
Exogen-allergisches Asthma
-
-
-
Allergische Reaktionen, z. B. auf Blütenpollen, Hausstaub milben, Tierhaare oder Nahrungsmittel.
-
Nicht-allergisches Asthma (häufiger)
Durch Infekte, körperliche Anstrengung, kalte Luft, psychi sche Faktoren (z. B. Stress), Inhalation atemwegsreizender Substanzen oder Medikamente.
Beim Asthmaanfall reagieren die Bronchien auf besondere Reize überempfindlich. Die glatte Bronchialmuskulatur ver krampft sich (,,Spasmus"). Durch die Reizung entsteht zudem eine Entzündung. Die Bronchialschleimhäute schwellen an und es wird viel zähflüssiger Bronchialschleim gebildet.
Diese drei Reaktionen verengen die Luftwege und behindern da mit vor allem die Ausatmung. Es entsteht ein Gefühl der Atem not. Die Ausatmung ist insgesamt verlängert, die Strömungs geräusche verstärkt und so kommt es zum charakteristischen Pfeifen (,,Giemen") und Brummen. Häufig liegt auch ein Reiz husten mit glasig-zähem (bei Infektionen eitrigem) Auswurf vor.
Kinder sind häufiger als Erwachsene betroffen, weil bei ihnen die Schleimhautoberfläche der Bronchioli im Verhältnis zur Weite der Atemwege besonders groß ist.
Das Asthma kann chronisch verlaufen oder anfallsweise mit beschwerdefreiem Interva II.
• Prophylaxe mit yoga
Durch regelmäßige Yogapraxis kann man die Schwere und Häu figkeit von Asthmaanfällen reduzieren. Meditation (dhyäna), Tiefenentspannung (saväsana) und positives Denken (z. B. in Form von positive Affirmationen) helfen, Stress und seelische Anspannungen zu reduzieren. Durch prär:iäyäma (täglich 3 Runden kapälabhäti, 10-20 Min. Wechselatmung, 10 Runden bhrämar0 bekommt der Asthmatiker mehr Kontrolle und Selbstsicherheit für sein Atmungsorgan und steigert seine Vitalkapazität. Das Matsyäsana (die Fischestellung) ist auf grund seiner brustkorböffnenden Wirkung sehr gut geeignet.
142
Herz-Kreislauf-System
-
-
Herz-Kreislauf-System
-
Überblick und Aufgaben
Die Blutgefäße sind die wichtigsten Transportwege des men schlichen Körpers. Zusammen mit dem Herzen bilden sie das Herz-Kreislauf System. Dieses versorgt alle Zellen des Körpers
mit Sauerstoff (02) und Nährstoffen und transportiert gleich zeitig Stoffwechselendprodukte, wie z. B. Kohlendioxid (C02) und harnpflichtige Substanzen, wieder ab.
Das Herz ist der Motor des Kreislaufs. Durch seine Pumplei stung wird ein fortdauernder Blutfluss aufrechterhalten.
Das Blut zirkuliert in einem geschlossenen System elastischer Röhren, dem Gefäßsystem, das sich in folgende Abschnitte glie dert:
-
In den Schlagadern (Arterien) wird das Blut vom Herzen weggeleitet.
-
In den Haargefäßen (Kapillaren) findet der Stoffaustausch statt.
-
In den Blutadern (Venen) wird das Blut zum Herzen zurück geführt.
-
In den Lymphgefäßen (ein Drainagesystem) wird die Zwi- schenzellflüssigkeit reinigt und von Keimen befreit.
Unabhängig vom Sauerstoffgehalt bezeichnet man alle Gefäße, die vom Herzen wegführen, als Arterien und alle Gefäße, die zum Herzen hinführen, als Venen.
LAGE DES HERZE NS
-
-
Herz (griech. l<ardia; Jot. Cor)
Das Herz ist ein muskuläres Hohlorgan und befindet sich zwi schen den beiden Lungenflügeln. An der Hinterseite grenzt es an die Speiseröhre und die Aorta, vorne an das Brustbein und mit der Unterseite sitzt es auf dem Zwerchfell auf. Es befindet sich zu zwei Drittel links und zu einem Drittel rechts von der Körpermitte.
Das Herz ist etwa eineinhalb mal so groß wie eine geschlossene Faust und kann durch Training oder unter pathologischen Umständen erheblich größer werden. Es hat die Form eines abgerundeten Kegels, dessen Spitze nach links unten vorne zeigt.
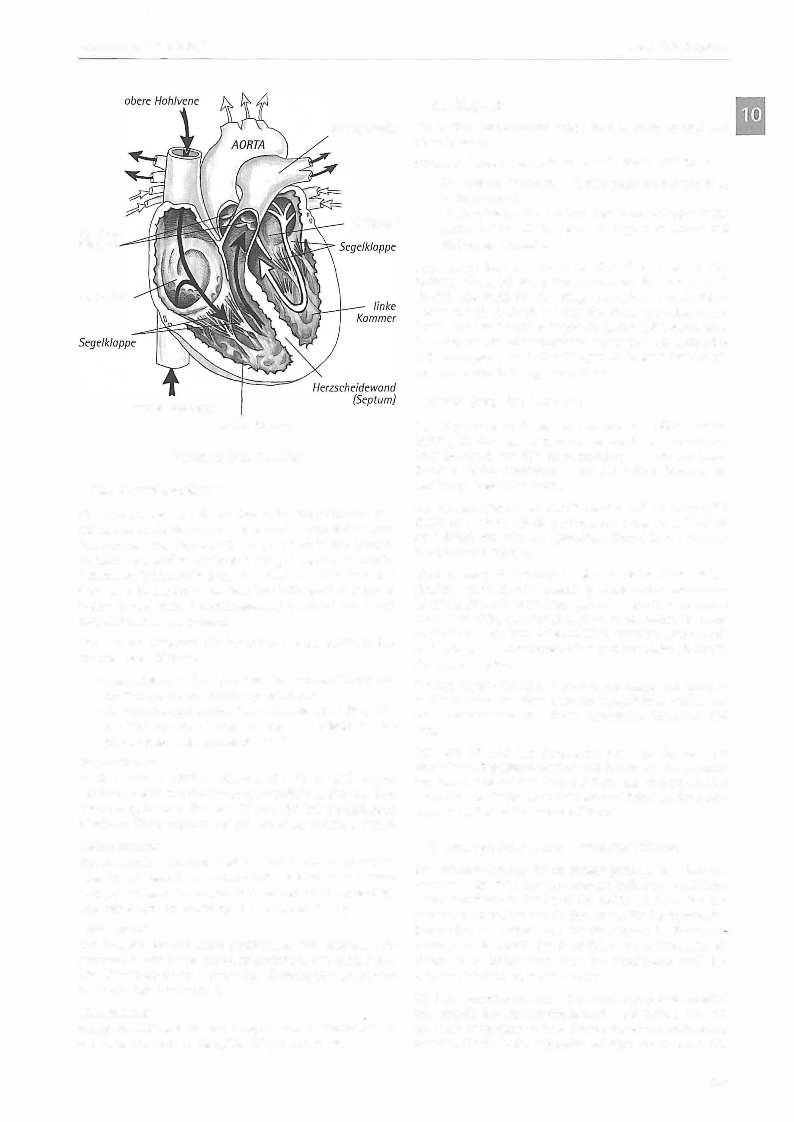
Anatomie und Physiologie Herz-Kreislauf-System
-
Herzklappen
Lungenarterie Die beiden Herzkammern haben jeweils einen Eingang und einen Ausgang.
An diesen Übergängen befinden sich die vier Herzklappen:
-
die Eingänge führen über Segelklappen von den Vorhöfen in die Kammern
-
Taschen klappen
re. Vorhof
untere Hohlvene
rechte Kammer
li. Vorhof
-
die Ausgänge leiten das Blut über Taschenklappen in die beiden größten Schlagadern des Körpers, die Aorta und die Lungenschlagader
Jede Klappe lässt sich durch die Blutströmung nur in eine Richtung öffnen. Fließt das Blut in die andere Richtung, schließt sie sich und versperrt den Weg. Das Öffnen und Schließen erfolgt rein passiv durch das Blut, das immer von Orten hohen Drucks zu Orten niedrigen Drucks fließt. So wie das Ventil eines Fahrradschlauches die unter Druck hineingepresste Luft zurück hält, so sorgen gesunde Herzklappen dafür, dass das Blut im mer nur in eine Richtung gepumpt wird.
• Musku_latur des Herzens
Der Körperkreislauf fordert vom Herzen eine höhere Pump leistung als der Lungenkreislauf. Deshalb ist die Herzmusku
ÜBERBLICK ÜBER DAS HERZ
• Die Herzinnenräume
Die Herzscheidewand teilt das Herz auf in eine rechte und linke Hälfte. Das rechte Herz nimmt das sauerstoffarme Blut aus dem Venensystem des Körpers auf und pumpt es in den Lungen
kreislauf. Dort wird es mit Sauerstoff (02) angereichert und gibt gleichzeitig Kohlendioxid (C02) ab. Nachdem es die Lunge pas siert hat, wird das Blut in die linke Herzhälfte geführt, von dort
weiter in die Aorta (Hauptschlagader) gepumpt und damit zurück in den Körperkreislauf.
Das Herz hat insgesamt vier Innenräume. Jede Herzhälfte be steht aus zwei Räumen:
► einem kleinen und muskelschwachen Vorhof (Atrium), der das Blut aus Körper oder Lunge aufnimmt
► einer großen und muskelstarken Kammer (Ventrikel), die das Blut aus dem Vorhof ansaugt und wieder in den Körper- bzw. Lungenkreislauf presst
Rechter Vorhof
In den rechten Vorhof münden die obere und untere Hohlvene. Beide transportieren sauerstoffarmes Blut aus dem Körper zurn Herzen. Eine Segelklappe (die Trikuspidalklappe) bildet den Übergang vom rechten Vorhof zur rechten Kammer.
Rechte Kammer
Von der rechten Kammer fließt das Blut in die Lungenschlag ader, die sich dann in eine rechte und eine linke Lungenarterie teilt. Den Ausgang der rechten Herzkammer zur Lungenschlag ader bildet eine Taschenklappe (die Pulmonalklappe).
Linker Vorhof
Das Blut, das von der Lunge zurückfließt, wird über vier Lun genvenen in den linken Vorhof transportiert. Eine Segelklappe (die Mitralklappe) bildet wieder den Übergang vom linken Vor hof in die linke Herzkammer.
Linke Kammer
pumpt das Blut über die Aortenklappe, eine Taschenklappe, in die Aorta. Die Aorta ist die größte Körperschlagader.
latur (Myokard) für den Körperkreislauf, also die der linken Kammer, stärker entwickelt als die der rechten Kammer, die den Lungenkreislauf versorgt.
Die Muskelschichten der Vorhöfe sind schwächer ausgeprägt (Dicke ca. 0,7 mm), als die der Kammern (Dicke ca. 1,4 cm), da sie lediglich das Blut vom jeweiligen Vorhof in die Kammer transportieren müssen.
Die Muskulatur des Herzens ist eine Sonderform der querge streiften Muskulatur. Sie besitzt spontane, autonome Kontra ktionsaktivität. Zur Kontraktion sind also keine Nervenimpulse von außen nötig, der Antrieb liegt im Herzen selbst. Die Herz muskulatur ist zur Dauerleistung fähig, trotzdem kann sie sich auch sehr schnell zusammenziehen und kurzzeitige Höchstlei stungen vollbringen.
Die zum Herzen leitenden Nerven (Sympathikus und Parasym pathikus) haben nur einen begrenzt regulierenden Einfluss auf die Herzmuskulatur und deren Kontraktion (Blutdruck und Puls).
Das Herz ist sehr gut durchblutet mit einer Kapillare pro Muskelfaser. Der Eigenbedarf an Blut beträgt 5% des gepump ten Blutes, obwohl das Herz nur 0,5% des Körpergewichtes ausmacht. Also ist der Blutbedarf zehnmal höher als der durch schnittliche Bedarf der anderen Organe.
• Erregungsbildung und Erregungsleitung
Die wichtigste Struktur für die Erregungsbildung innerhalb des Herzens ist der Sinusk noten. Dies ist ein Geflecht spezialisierter Herzmuskelfasern in der Wand des rechten Vorhofs. Von die sem gehen normalerweise die Erregungen für die rhythmische Kontraktion des Herzens aus. Der Sinusknoten bestimmt nor malerweise die Anzahl der Herzschläge pro Minute, also die Herzfrequenz. Daher nennt man den Sinusknoten auch den primären Schrittmacher des Herzens.
Über die Vorhofmuskulatur wird die Erregung weitergeleitet und erreicht den Atrioventrikularknoten (AV-Knoten), der sich am Boden des rechten Vorhofs, dicht an der Vorhofscheidewand, befindet. Dieser ist das sekundäre Schrittmacherzentrum, das
143
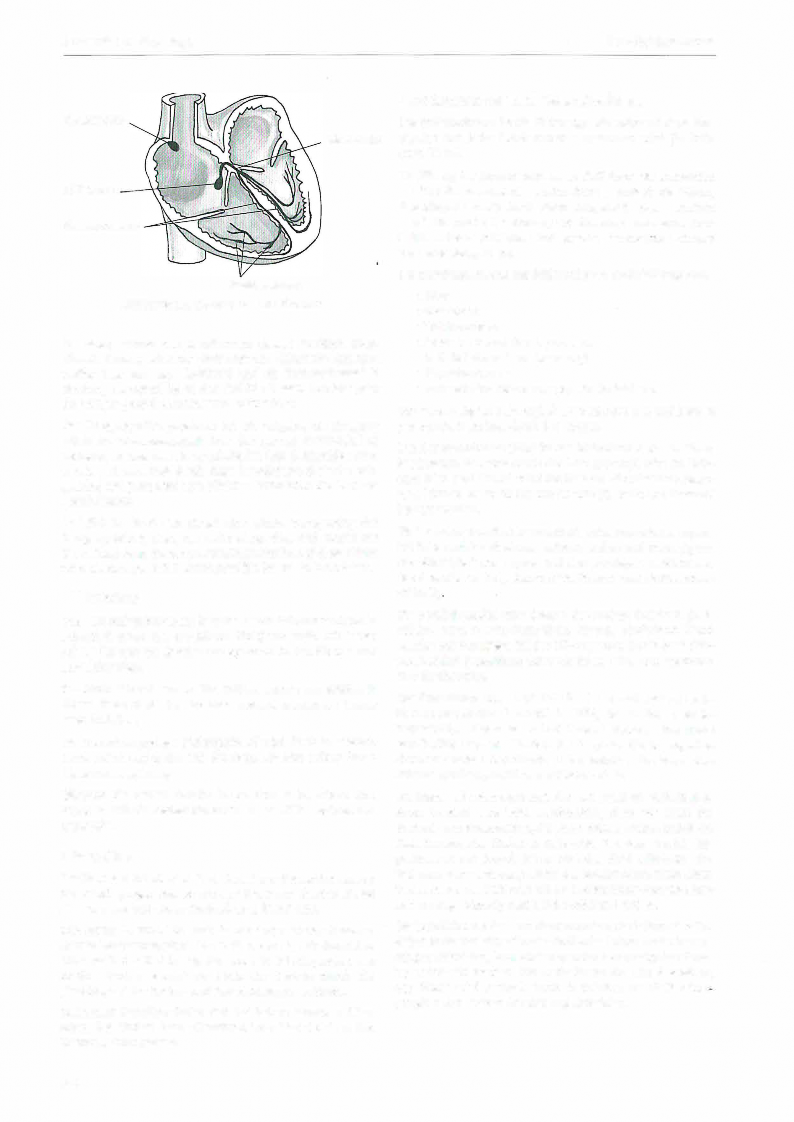
Anatomie und Physiologie Herz-Kreislauf-System
-
Schlagvolumen und Herzzeitvolumen
Sinusknoten Das Schlagvolumen ist die Blutmenge, die während einer Kon-
His-Bünde/ traktion aus jeder Herzkammer ausgeworfen wird (in Ruhe etwa 70 ml).
Die Füllung der Kammer wird nur zu 20% durch die Kontraktion
AVKnoten Tawaraschenkel
Purkinje-Fasern
der Vorhöfe verursacht. Hauptsächlich geschieht die Füllung überwiegend passiv durch einen Saugeffekt. Dieser entsteht durch die rasche Erweiterung der Kammern nach einer Kon traktion. Das Herz ist also nicht nur eine Druckpumpe sondern auch eine Saugpumpe.
Die Herzfrequenz und das Schlagvolumen sind abhängig von:
-
Alter
ERREGUNGSLEITUNGSSYSTEM DES HERZENS
bei einem Ausfall des Sinusknotens dessen Funktion über nimmt. Danach leitet der AV-Knoten die elektrische Erregung weiter über das sog. His-Bündel und die Tawaraschenkel in Richtung Herzspitze bis zu den Purkinje-Fasern. Von hier geht die Erregung auf die Kammermuskulatur über.
Das Erregungsleitungssystems hat die Aufgabe, die Erregung mit hoher Geschwindigkeit über den ganzen Herzmuskel zu verteilen, so dass alle Herzmuskelzellen fast gleichzeitig erregt werden können. Erst durch diese koordinierte(beinahe zeit gleiche) Erregung wird eine effektive Kontraktion des Herzens gewährleistet.
Lediglich im AV-Knoten findet eine leichte Verzögerung der Erregungsleitung statt, die dafür sorgt, dass sich zuerst der Vorhof und dann die Kammer zusammenzieht. Auf diese Weise wird die Kammer mit mehr Blut gefüllt, bevor sie kontrahiert.
• Herzzyklus
Das Herz schlägt bei einem Erwachsenen in Ruhezustand durch schnittlich 60-80 mal pro Minute(Puls) und treibt mit jedem Schlag das Blut schubweise und synchron in den Körper- und Lungenkreislauf.
Die Kontraktionsphase der Herzhöhlen nennt man Systole. In dieser Phase zieht sich das Herz maximal zusammen(Dauer etwa 0,15 Sek.).
Die Erschlaffungsphase(Füllungsphase) wird Diastole genannt. Dabei öffnet und dehnt sich das Herz, um Blut aufzunehmen (Dauer etwa 0,7 Sek.).
Während die beiden Vorhöfe in der Kontraktionsphase sind, befinden sich die beiden Kammern in der Füllungsphase und umgekehrt.
• Herztöne
Das Herz arbeitet nicht lautlos. Die bei der Herzaktion erzeug ten Schwingungen werden auf den Brustkorb übertragen, wo sie von außen mit einem Stethoskop zu hören sind.
Den ersten Herzton hört man in der Anspannungsphase der Systole(Anspannungston). Durch die ruckartige Muskelkontra ktion gerät das Blut in den Kammern in Schwingungen. Der zweite Herzton kommt am Ende der Systole durch das
,,Zuschlagen" der Aorten- und Pulmonalklappe zustande.
Diese zwei Herztöne finden sich bei jedem gesunden Men schen. Bei Kindern kann oft während der Diastole ein dritter Herzton gehört werden.
144
-
Geschlecht
-
Trainingszustand
-
Sauerstoffbedarf des Organismus (z. B. bei körperlicher Belastung)
-
Körpertemperatur
-
Bewusstseinszustand und psychische Faktoren
Das Herz schlägt in Ruhe täglich etwa 100 000 Mal und bewegt pro Minute 5 Ltr. Blut durch den Körper.
Das Herzzeitvolumen(HZV) ist das Blutvolumen, das in einem bestimmten Zeitraum durch das Herz gepumpt wird(in Ruhe etwa 5 Ltr. pro Minute). Wird das Herz zur Höchstleistung ange regt, können bis zu 25 Ltr. pro Minute(!) durch den Kreislauf bewegt werden.
Die Verteilung des Blutstroms auf die unterschiedlichen Organe bei Ruhe und Arbeit ist sehr unterschiedlich und abhängig von der Wichtigkeit der Organe und den jeweiligen Bedürfnissen des Organismus (allg. Sauerstoffverbrauch und Stoffwechsel aktivität)
Die parallel geschalteten Organe des großen Kreislaufs(z. B. Gehirn, Herz, Magen-Darm-Trakt, Nieren, Muskulatur, Haut) werden nur mit einem Teil des HZVs versorgt. Der in Serie(hin tereinander) geschaltete Lungenkreislauf wird vom gesamten HZV durchströmt.
Der Organismus sorgt zunächst für eine ausreichende Durch blutung des Gehirns(ca. 14% des HZV), da das Gehirn ein le benswichtiges Organ ist und auf Sauerstoffmangel besonders empfindlich reagiert. Die Durchblutung der Herzkranzgefäße (Koronararterien) darf ebenfalls nicht abfallen, da daraus eine Störung der Pumpfunktion resultieren würde.
Die Nieren erhalten etwa 20% des HZV. Diese im Verhältnis zu ihrem Gewicht sehr hohe Durchblutung dient vor allem der Kontroll- und Ausscheidungsfunktion dieses Organs. Durch die Skelettmuskulatur fließen in Ruhe etwa 20% des HZV, bei kör perlicher Arbeit jedoch bis zu 75% des dann erhöhten HZV. Während der Verdauung erhält der Magen-Darm-Trakt einen hohen Anteil des HZV. Muskulatur und Verdauungsorgane kön nen nicht gleichzeitig maximal durchblutet werden!
Die Durchblutung der Haut dient vor allem der Wärmeabgabe, daher ist sie bei körperlicher Arbeit oder hohen Außentempe raturen gesteigert, kann aber zugunsten lebenswichtiger Orga ne gedrosselt werden. Die bedarfsgerechte (Um-)Verteilung des Blutes wird geregelt durch Regulation des Gefäßwider stands in den kleinen Arterien und Arteriolen.
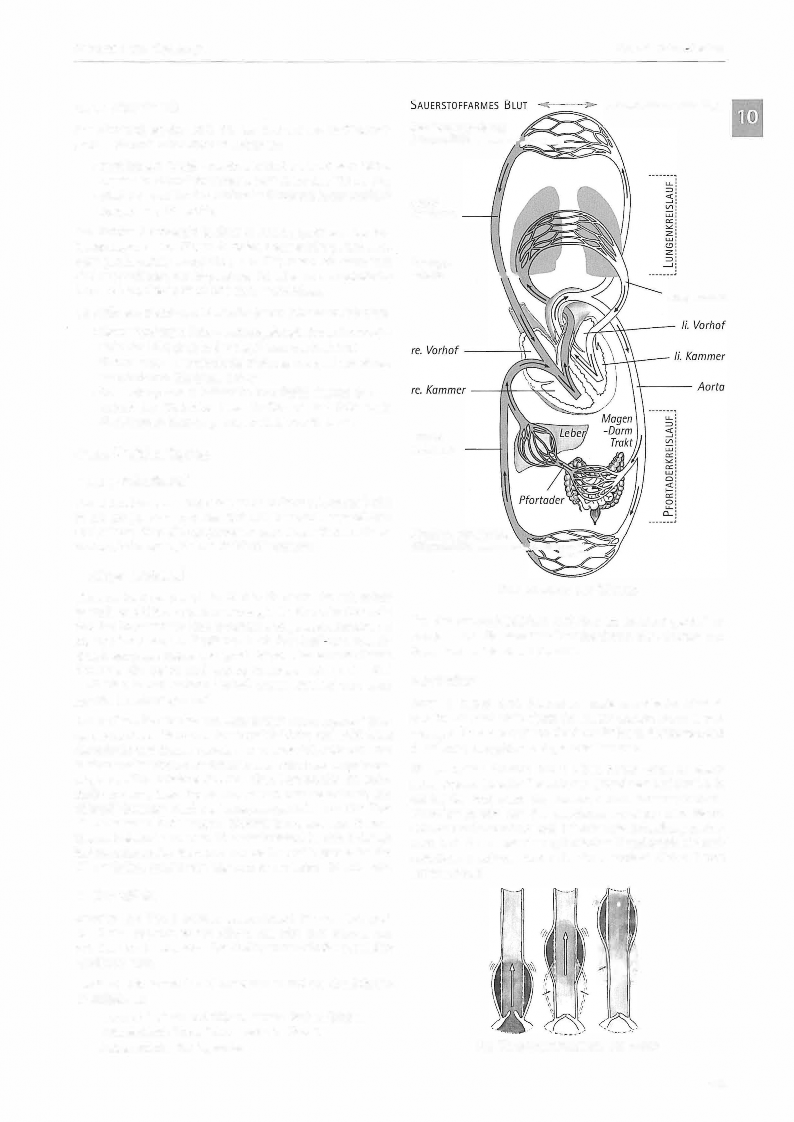
Anatomie und Physiologie Herz-KreisIauf System
-
-
-
Blutdruck
Der Blutdruck ist die Kraft, die das Blut auf die Gefäßwände ausübt. Es wird unterschieden zwischen:
-
systolischem Druck= maximaler Blutdruck auf dem Höhe punkt der Kontraktionsphase, normalerweise 120 mmHg
-
diastolischem Druck= minimaler Blutdruck in der Erschlaf- fungsphase, 80 mmHg
Der Blutdruck schwankt laufend in Abhängigkeit von den An forderungen an den Körper. Er steigt, wenn wir körperlich aktiv oder gefühlsmäßig erregt sind, und fällt, wenn wir entspannt sind oder schlafen. Bei körperlicher Arbeit kann der systolische Blutdruck kurzfristig bis zu 200 mmHg erreichen.
Die Höhe des Blutdrucks ist abhängig von folgenden Faktoren:
-
Herzzeitvolumen (HZV = Leistungsfähigkeit des Herzens) sinkt das HZV, sinkt in der Regel auch der Blutdruck
-
Blutvolumen - vermindertes Blutvolumen geht mit einem verminderten Blutdruck einher
-
Gefäßwiderstand (Gefäßweite bzw. Gefäßelastizität) - nimmt der Widerstand der Gefäße zu und HZV sowie Blutvolumen bleiben gleich, so steigt der Blutdruck
-
-
Kreislaufsystem
-
Lungenkreislauf
Die rechte Kammer pumpt das sauerstoffarme (,,venöse" ) Blut in die Lunge. Dort wird das Blut mit Sauerstoff angereichert und gelangt über die Lungenvenen zum linken Vorhof. Dieser
Kapillare der oberen Körperhälfte ---,1;.,.,..��
obere Hohlvene
Lungen
arterie ---....\-\,-"+-
untere Hohlvene
Kapillare der unteren
SAUERSTOFFREICHES BLUT
Lungenvene
Kreislauf wird auch „kleiner Kreislauf" genannt.
-
Körperkreislauf
Die linke Kammer pumpt das Blut in die Aorta, die sich später in große und kleine Arterien verzweigt. Das Blut wird durch die Arterien im gesamten Körper verteilt und gelangt schließlich in die Endstrombahn der Kapillaren. Nach demStoff und Gasaus tausch sammeln kleine und große Venen das sauerstoffarme Blut und die obere und untere Hohlvene führen das Blut schließlich in den rechten Vorhof. Dieser Kreislauf wird auch
,,großer Kreislauf" genannt.
Das venöse Blut aus den sog. ,,unpaarigen Bauchorganen" (Ma gen, Dünndarm, Dickdarm, Bauchspeicheldrüse und Milz) fließt nicht direkt zum Herzen zurück, sondern vereinigt sich zunächst in einer großen Vene, der Pfortader. Diese führt das sauerstoffar me, aber nährstoffreiche Blut zur Leber. Dort werden die Nähr stoffe in verwertbare Formen umgebaut oder gespeichert und Giftstoffe beseitigt. Nach der Leberpassage strömt das Blut über die Lebervenen in die untere Hohlvene und weiter zum Herzen. Diesen Kreislauf nennt man Pfortaderkreislauf. Da sich in der Le ber ausnahmsweise die Venen ein zweites mal in ganz feine Ge fäße aufteilen, spricht man hier auch vom venösen Wundernetz.
-
Blutgefäße
Arterien und Venen werden ausschließlich für den Transport des Blutes genutzt. Venen führen das Blut zum Herzen hin, Arterien vom Herzen weg. Der Stoffaustausch findet nur in den
Körperhälfte ---�-�;;::::::�-
BLUTK REISLAUF DES KÖRPERS
Um den unterschiedlichen Aufgaben im Kreislauf gerecht zu werden, sind die einzelnen Wandschichten der Arterien und Venen unterschiedlich aufgebaut.
• Arterien
Arterien haben eine besonders stark entwickelte Muskel schicht, die auch viele elastische Fasern enthält. Durch Erwei terung und Verengung kann die durchfließende Blutmenge und der Blutdruck reguliert und gesteuert werden.
1
Die herznahen Arterien haben einen hohen Anteil an elasti schen Fasern. Diese besitzen die sog. ,,Windkesselfunktion", d. h. das bei der Kontraktion des Herzens schubweise ausgeworfene Blutvolumen wird von den elastischen Arterien unter Wand dehnung aufgenommen und bei der Herzerschlaffung weiter befördert. Der wegen der rhythmischen Herztätigkeit diskonti nuierliche Blutstrom wird so in einen kontinuierlichen Strom umgewandelt.
'.:;: �-
,;· ,,
11 1'
Kapillaren statt.
Die Gefäßwände von Arterien und Venen sind aus dreiSchicht en aufgebaut:
-
Innenschicht: einschichtiges, extrem flaches Epithel
-
Mittelschicht: Muskulatur, elastische Fasern
•I "'-1!
\
\\ ,/'
-
Außenschicht: Bindegewebe
DIE WINDKESSELFUNKTION DER ÄORTA
145
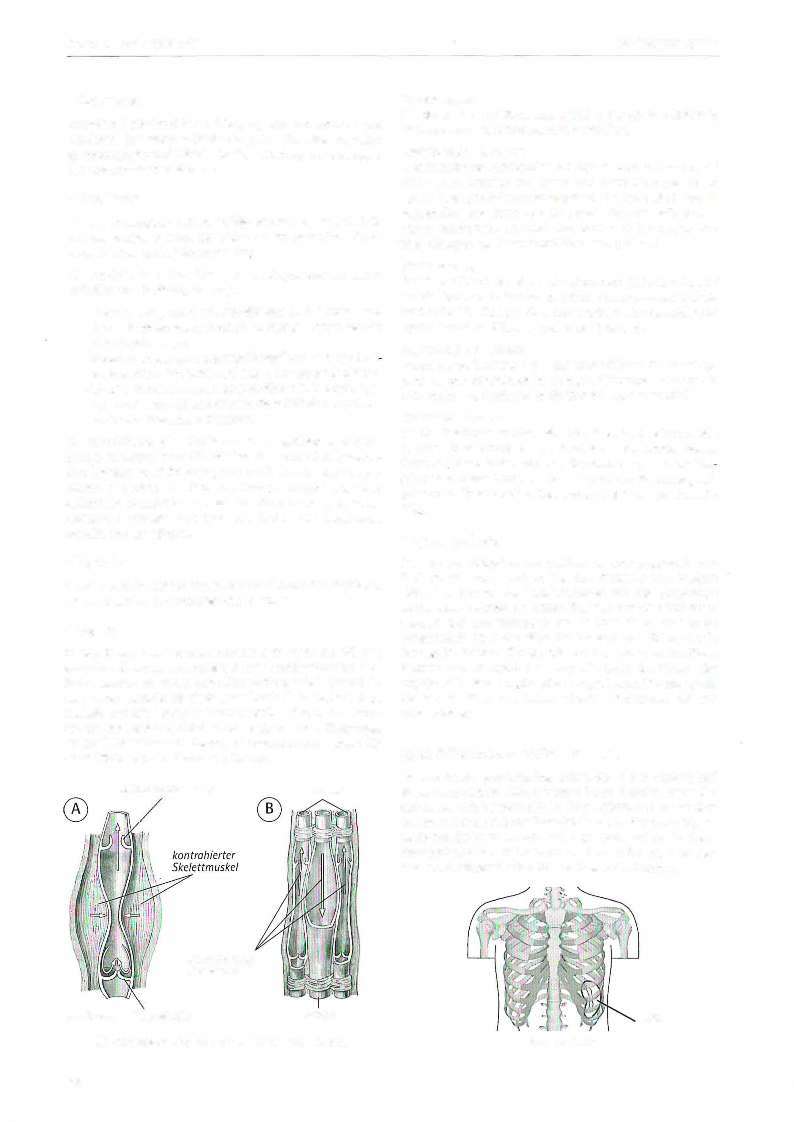
Anatomie und Physiologie
-
Arteriolen
Arteriolen befinden sich am Übergang zwischen Arterien und Kapillaren. Ihre Wand enthält viele glatte Muskelfasern, deren Spannungszustand die Stärke der Durchblutung im nachfolgen den Kapillargebiet beeinflusst.
-
Kapillaren
Diese mikroskopisch feinen Gefäße verbinden das arterielle und das venöse System. Sie bilden ein im gesamten Körper ausgedehntes, dicht geknüpftes Netz.
Die verschiedenen Gewebeformen im Körper werden unter schiedlich von Kapillaren versorgt:
-
Gewebe mit großem Sauerstoffbedarf (z. B. Muskel) und hoher Stoffwechselaktivität (z. B. Nieren, Leber) weisen viele Kapillaren auf.
-
Gewebe mit geringem Sauerstoffbedarf und niedriger Stoff wechselaktivität (z.B. Sehnen) haben nur wenige Kapillaren.
-
Manche Gewebe besitzen keine Kapillaren (z. B. Augenlinse, Hornhaut, Knorpel) und werden über Diffusion durch be nachbartes Gewebe mitversorgt.
Die Kontaktfläche aller Kapillaren zum umgebenden Gewebe beträgt insgesamt etwa 300 m'. Der Blutstrom ist hier beson ders langsam (ca. 0,05 cm/s), um den Stoffaustausch zu opti mieren. Die Wand der Kapillaren besteht lediglich aus einer siebartigen Zellschicht, so dass der Stoffaustausch in beide Richtungen erfolgen kann (aus dem Blut in das umgebende Gewebe und umgekehrt).
-
-
Venolen
Venolen sind die kleinen Venen, die das Blut aus den Kapillaren sammeln und zu den größeren Venen leiten.
-
Venen
In den Venen und Venolen befindet sich mehr als 2/3 des gesamten Blutvolumens. Aufgrund ihrer Speicherfunktion des Blutes werden die Venen auch „Kapazitätsgefäße" genannt. In den Venen herrscht ein niedrigerer Druck als in den Arterien. Deshalb sind ihre einzelnen Wandschichten dünner und locke rer. Die Innenschicht bildet in den kleinen und mittelgroßen Venen Taschenklappen. Folgenden Mechanismen sorgen für einen Rückstrom des Blutes zum Herzen:
Herz-Kreislauf-System
Venenklappen
Sie bilden eine Art Ventil und erlauben nur einen Blutfluss in Richtung Herz. Ein Rückfluss wird verhindert.
Arteriovenöse Kopplung
In unmittelbarer Nähe großer und kleiner Arterien liegen meist zwei Venen. Arterien und Venen sind durch Bindegewebe zu einem Gefäßbündel zusammengefasst. Die durch die Pulswelle regelmäßig erweiterte Arterie presst die eng anliegenden Venen zusammen, wodurch das venöse Blut aufgrund der Venenklappen nur herzwärts fließen kann (siehe B).
Muskelpumpe
Durch den Druck der sich kontrahierenden Skelettmuskulatur auf die Venen wird die Venenwand zusammengepresst und das venöse Blut in Richtung Herz transportiert. Die Venenklappen verhindern einen Rückfluss des Blutes (siehe A).
Sogwirkung des Herzens
Durch die Verlagerung der Ventilebene (Ebene der Herzklap pen) bei der Kontraktion in Richtung Herzspitze entsteht ein Unterdruck, wodurch Blut in die Vorhöfe angesaugt wird.
Einfluss der Atmung
Bei der Einatmung entsteht ein Unterdruck im Brustraum, was zu einer Erweiterung der im Brustraum verlaufender Venen führt. Auf diese Weise wird der Bluteinstrom vergrößert. Ver stärkt wird dieser Einstrom durch den bei der Einatmung ent stehenden Überdruck im Bauchraum (Senkung des Zwerch fells).
• Lymphgefäße
Das Lymphgefäßsystem als zusätzliches Drainagesystem ver läuft parallel zum venösen Teil des Kreislaufs und beginnt
,,blind" im Bereich des Kapillargebietes mit den Lymphkapi llaren. Diese nehmen die Lymphflüssigkeit aus dem Zwischen zellraum auf und transportieren sie über kleine und große. Lymphgefäße bis in die Nähe des Herzens und dort zurück in das venöse System. Ähnlich wie bei den Venen unterstützen Klappen den Transport der Lymphflüssigkeit. Im Verlauf der Lymphgefäße sind Lymphknoten eingeschaltet. Sie dienen als biologische Filter und haben wichtige Funktionen bei der Immunabwehr.
-
-
Milz (griech. Splen; lat. Lien)
offene Venenklappe
1
Flussrichtung des Blutes
geschlossene Venenkloppe
Venen
Arterie
Die Milz ist ein lymphatisches Organ, das in den Blutkreislauf eingeschaltet ist. Sie dient als Kontroll- und Filtrationsorgan des Blutes. Die Milz befindet sich im linken Oberbauch hinter dem Magen und unterhalb des Zwerchfells und ist durch die Rippen geschützt. Sie ist ca. 11 cm lang, 5 cm breit und hat die Form einer Kaffeebohne. Im Verhältnis zu ihrer Größe wird die Milz sehr gut durchblutet mit 3-5% der Gesamtdurchblutung.
Milz
MECHANISMEN DES ßLUTRÜCKFLUSSES ZUM HERZEN LAGE DER MILZ
146
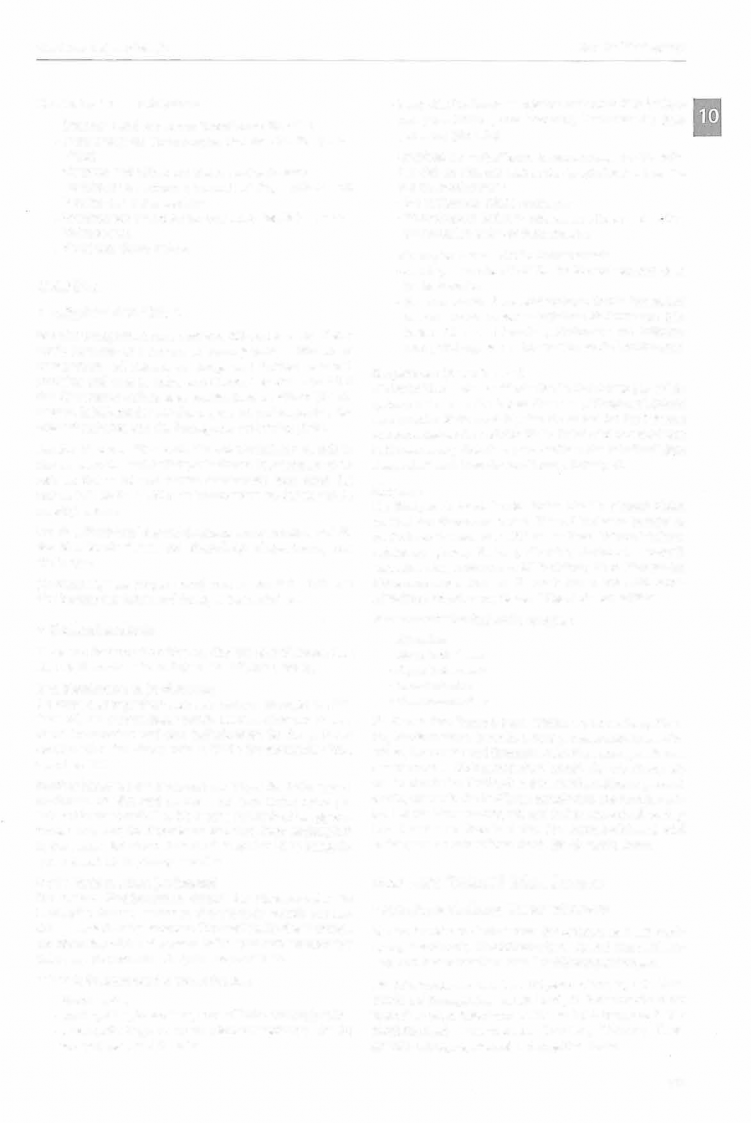
Anatomie und Physiologie
Die Milz hat folgende Aufgaben:
-
Erkennung und Abbau von überalterten Blutzellen
-
Speicherung von Thrombozyten (bei der Blutstillung be nötigt)
-
Abfangen und Abbau von kleinen Blutgerinnseln
-
Produktion von Lymphozyten und Antikörpern (Zellen und Proteine der Immunabwehr)
-
Zerstören von Fremdstoffen und infizierten Zellen durch Makrophagen
-
Blutbildung beim Embryo
-
-
Blut
-
Aufgaben des Blutes
Das Blut transportiert Sauerstoff und Nährstoffe zu den Zellen sowie Hormone und Enzyme zu ihrem jeweiligen Wirkort. Es transportiert Kohlendioxid zur Lunge und Stoffwechselabfall produkte und Gifte zu Leber und Nieren. Das Blut unterstützt den Körper beim Aufbau eines stabilen inneren Milieus (Homö ostase). Es hilft bei der Regulierung der Körpertemperatur, des Wasserhaushaltes und des bluteigenen pH-Wertes (7,41).
Darüber hinaus erfüllt es auch eine Abwehrfunktion, da sich im Blut Immunzellen und Antikörper befinden. Diese wirken einer seits im Blut selbst und werden andererseits auch durch das Blut an jede Stelle des Körpers transportiert, an der sie gerade benötigt werden.
Um die „Dichtigkeit" des Gefäßsystems sicherzustellen, enthält das Blut Mechanismen zur Blutstillung, Blutgerinnung und Fibrinolyse.
Die Blutmenge des Körpers beträgt durchschnittlich 4-5 Ltr. Das Blut besteht aus festen und flüssigen Bestandteilen.
-
Blutbestandteile
Die festen Bestandteile bilden ca. 42% des Blutvolumens. Dies sind die Blutzellen, die im Folgenden erläutert werden.
Rote Blutkörperchen (Erythrozyten)
Die roten Blutkörperchen enthalten fast nur Hämoglobin (Blut farbstoff), ein eisenhaltiges Protein, das Sauerstoff und Kohlen dioxid transportiert und eine Pufferfunktion für den pH-Wert des Blutes hat. Das Hämoglobin ist für die Rotfärbung des Blutes verantwortlich.
Darüber hinaus ist der Erythrozyt der Träger der Blutgruppen merkmale. Im Blut sind ca. 4,5 - 5,5 Mio. Erythrozyten pro Kubikmilimeter (mm') Blut. Die Menge schwankt abhängig vom Sauerstoffbedarf des Organismus und vom Sauerstoffangebot in der Lunge. Bei einem Aufenthalt in großer Höhe beispiels weise nimmt die Erythrozytenzahl zu.
Weiße Blutkörperchen (Leukozyten)
Die weißen Blutkörperchen dienen der Körperabwehr. Sie bekämpfen Erreger, entfernen körperfremde Partikel und zer stören infizierte oder entartete Körperzellen. Zu dieser Gruppe der Blutzellen zählen eine ganze Reihe spezifisch ausgeprägter Zelltypen, die besondere Aufgaben wahrnehmen.
Folgende Gruppen werden unterschieden:
-
Granulozyten
-
-
neutrophile: ,,Fresszellen", unspezifische Immunabwehr
-
eosinophile: Begrenzung allergischer Reaktionen, Abwehr von Würmern und Parasiten
Herz-Kreislauf-System
- basophile: Auslösung allergischer und entzündlich Reaktio nen (Ausschüttung von Histamin), Hemmung der Blut gerinnung (Heparin)
-
Lymphozyten - spezifische Immunabwehr, nur 4% befin den sich im Blut, der Rest in den lymphatischen Organen und im Knochenmark
-
B-Lymphozyten bilden Antikörper
-
T-Lymphozyten bilden T-Helferzellen, T-Killerzellen, T Sup- pressorzellen und T-Gedächtniszellen
-
-
Monozyten - unspezifische Immunabwehr
-
verbringen nur etwa 20-30 Std. im Blut und wandern dann in das Gewebe
-
dort wandeln sie sich zu Makrophagen (große Fresszellen) um und haben folgende Aufgaben: Abtötung von Bak terien, Pilzen und Parasiten, Abräumung von Zelltrüm mern, Weitergabe von Information an die Lymphozyten
Blutplättchen (Thrombozyten)
Die Blutplättchen sind zuständig für die Abdichtung des Gefäß systems und sorgen für ein geschlossenes „Rohrsystem". Sobald eine undichte Stelle entsteht, eilen sie an den Ort des Defektes und verschließen die undichte Stelle. Dabei wird unterschieden in Blutgerinnung, Blutstillung und Auflösen der behelfsmäßigen
,,Reparatur" nach Gewebeneubildung (Fibrinolyse).
Blutplasma
Die flüssigen Bestandteile des Blutes (das Blutplasma) bilden ca. 58% des Gesamtvolumens. Dieses Blutplasma besteht zu ca. 90% aus Wasser, zu ca. 2% aus gelösten kleinmolekularen Substanzen (Ionen, Glukose, Vitamine, Hormone, Harnstoff, Harnsäure etc.) sowie aus ca. 8% Proteinen, die ca. 70 g pro Ltr. Blutplasma ausmachen. Im Plasma kommen etwa 100 unter schiedliche Proteine vor, die vielfältige Aufgaben erfüllen.
Man unterscheidet fünf große Gruppen:
-
-
Albumine
-
Alpha 1-Globuline
-
Alpha 2-Globuline
-
Beta-Globuline
-
Gamma-Globuline
Sie dienen dem Transport von Fettsäuren, Cholesterin, Biliru bin, Medikamenten, Ionen (z. B. Eisen), wasserunlöslichen Vita minen, Hormonen und Enzymen. Außerdem erzeugen sie den sogenannten „kolloidosmotischen Druck", der die Flüssigkeit, welche durch den Blutdruck in den Zwischenzellraum gepresst wurde, wieder in die Kapillaren zurückführt. Die Proteine wir ken bei der Blutgerinnung mit und stellen eine schnell verfüg bare Reserve an Proteinen dar. Die Gamma-Globuline sind Antikörper und unterstützen damit die Abwehrfunktion.
-
-
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
-
-
• Arterienverkalkung (Atherosklerose)
ist eine krankhafte Veränderung der Arterienwand mit Verdi ckung, Verhärtung, Elastizitätsverlust, Querschnittsverkleine rung und daraus resultierenden Durchblutungsstörungen.
Die Arteriosklerose und ihre Folgeerkrankungen, wie Herz infarkt und Schlaganfall, sind die häufigste Todesursache in der westlichen Welt. Risikofaktoren für die Entstehung sind hoher Blutfettspiegel, Bluthochdruck, Rauchen, Diabetes, Über gewicht, Bewegungsmangel und negativer Stress.
147
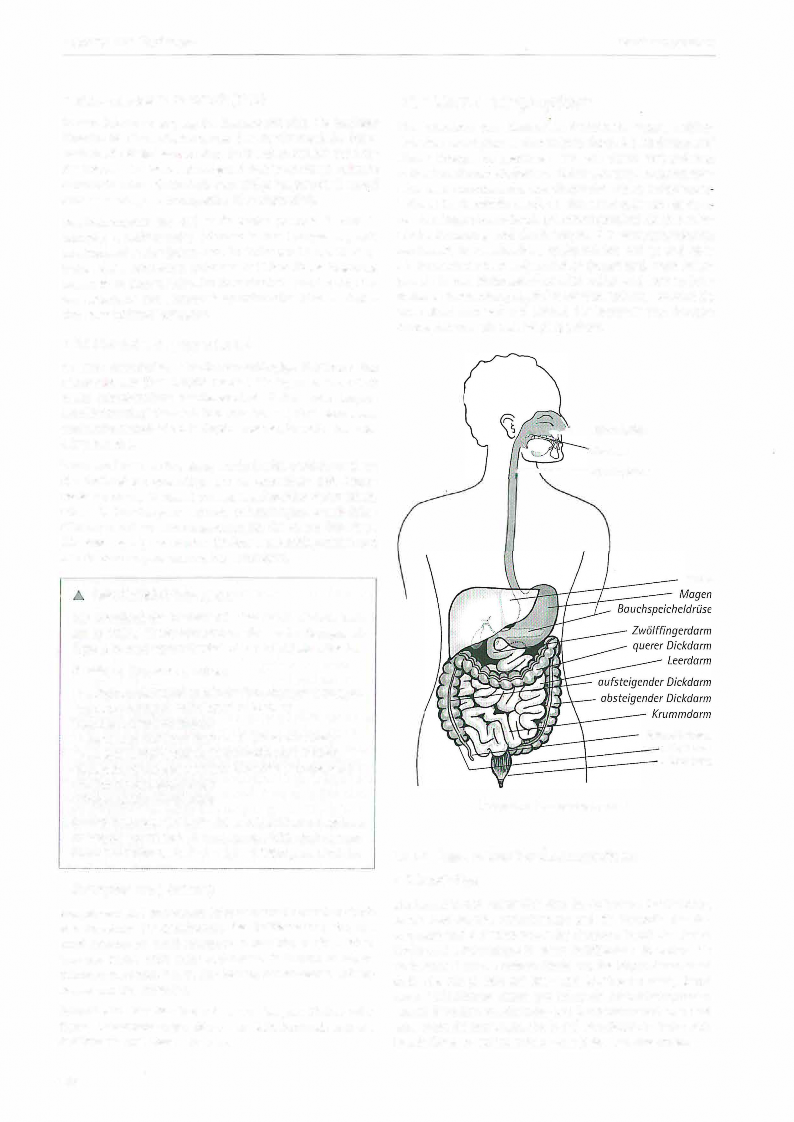
Anatomie und Physiologie
• Koronare Herzkrankheit (KHK)
ist eine Minderversorgung des Herzens mit Blut. Die häufigste Ursache ist eine Arteriosklerose der Herzkranzgefäße (Koro narien). Die Risikofaktoren sind die Gleichen wie bei der Arte riosklerose. Das Herz hat aufgrund seiner enormen Leistung einen sehr hohen Blutbedarf. Demzufolge reagiert das Herz auf eine Verengung der Kranzgefäße sehr empfindlich.
Das Leitsymptom der KHK ist die Angina pectoris. Das ist ein dumpfer, einschnürender Schmerz in der Herzgegend, evtl. ausstrahlend in den linken Arm. Im fortgeschrittenen Stadium treten diese Schmerzen nicht nur bei körperlicher Belastung auf, sondern auch in Ruhe. Am Ende steht der Herzinfarkt, d. h. der Untergang von Herzmuskelgewebe oder lebensbedrohli che Herzrhythmusstörungen.
• Bluthochdruck (Hypertonie)
ist eine dauerhafte, situationsunabhängige Erhöhung des Blutdrucks auf über 140/80 mmHg. Die Hypertonie verläuft meist jahrzehntelang beschwerdefrei. Treten nach langem Krankheitsverlauf dennoch Beschwerden auf, sind diese meist uncharakteristisch wie z. B. Kopfschmerzen, Nasenbluten oder Ohrgeräusche.
Wenn der Blutdruck jahrelang erhöht bleibt, werden vor allem die Gefäßwände geschädigt und es entwickeln sich Organ veränderungen, die dann ihrerseits Beschwerden verursachen, wie z. B. Kurzatmigkeit, Luftnot, Sehstörungen, Sensibilitäts störungen und Durchblutungsstörungen der Nieren (bis hin zu Nierenversagen), des Gehirns (Gefahr eines Schlaganfalls) und des Herzens (Angina pectoris bis Herzinfarkt).
Das Ornish-Programm
Der amerikanische Mediziner Dr. Dean Ornish entwickelte ein spezielles Therapieprogramm für bereits Herzgeschä digte (z. B. nach einem Herzinfarkt) und für Risikopatienten.
Zu seinem Programm gehören:
-
Verzicht auf das Rauchen (als absolute Vorraussetzung, um an dem Programm teilnehmen zu können)
-
nahezu fettfreie Ernährung
-
keine konzentrierten Fette (z. B. Nüsse oder Saat)
-
keine isolierten Fette (z. B. Speiseöle oder Butter)
, pulsgesteuertes Bewegungstraining (tägl. Spaziergang)
-
-
täglich 60 Min. hatha-yoga
-
Gruppengesprächstherapie
Sensationell war, als Dr. Ornish in einer Studie beweisen konnte, dass durch sein Programm eine KHK nicht nur zum Stillstand kommen, sondern sogar rückläufig sein konnte.
• Krampfadern (Varizen)
Kranpfadern sind eine venöse Erkrankung und entstehen durch eine Schwäche der Gefäßwände. Die Gefäße weiten sich und somit können die Taschenklappen in den Venen einen Rück fluss des Blutes nicht mehr verhindern. Es kommt zu einem Rückstau des Blutes v. a. in den Beinen, mit schweren, müden Beinen und Ödembildung.
Sinnvoll sind hier das Vermeiden von langem Stehen oder Sitzen, Umkehrstellungen (Kopf- und Schulterstand) und ein Gefäßtraining mit Wechseldusche.
148
Verdauungssystem
-
-
Verdauungssystem
Die Aufnahme von Nährstoffen (Proteinen, Fetten, Kohlen hydraten) ermöglicht es dem Körper, durch die „Verbrennung" dieser Energie zu gewinnen, um die damit verbundenen Lebensfunktionen Wachstum, Zellerneuerung, Körpertempe ratur sowie mechanische und chemische Arbeit aufrechtzuer halten. Die Nährstoffe werden in den verschiedenen Abschnit ten des Magen-Darm-Kanals (Verdauungstrakts) durch mecha nische Verdauung und durch Enzyme der Verdauungsdrüsen zerkleinert, in resorbierbare Spaltprodukte zerlegt und über die Darmschleimhaut aufgenommen (resorbiert). Dann gelan gen sie in den Blutkreislauf zu allen Zellen und können ihrer weiteren Verwendung zugeführt werden. Teilweise werden sie auch direkt zum Auf- und Umbau der körpereigenen Gewebe verwendet oder als Reserve gespeichert.
-==-ff'"-- Mundhöhle
Rachen
----- Speiseröhre
Leber
Wurmfortsatz Blinddarm Mastdarm
ÜBERBLICK VERDAUUNGSTRAKT
-
Organe des Verdauungstrakts
• Mundhöhle
Die Aufgaben der Mundhöhle sind die Aufnahme der Nahrung, deren mechanische Zerkleinerung und die Kontrolle des Ge schmacks und der Temperatur der Nahrung. Durch das Kauen findet eine Umwandlung in einen halbflüssigen Speisebrei als Vorbereitung für die weitere Verdauung im Magen-Darm-Trakt statt. Die Zunge hilft bei Kau- und Saugbewegungen, formt einen schluckbaren Bissen und leitet die Schluckbewegungen ein. Sie dient dem Geschmacks- und Temperaturempfinden und unterstützt die Immunabwehr. In der Mundhöhle befinden sich Speicheldrüsen; auf jeder Seite viele kleine und drei große:

Anatomie und Physiologie
-
die Ohrspeicheldrüse (Glandula parotis)
-
die Unterkieferspeicheldrüse (Glandula submandibularis)
-
die Unterzungendrüse (Glandula sublingualis)
Diese bilden ununterbrochen Speichel, täglich etwa 2 Ltr. Der Speichel besteht zu 99,5% aus Wasser, darüber hinaus aus Enzymen (Amylase) und antibakteriellen Stoffen. Der Speichel film hält die Schleimhäute der Mundhöhle feucht, was beson ders wichtig für klares Sprechen ist, und er unterstützt die Reinigung der Mundhöhle und der Zähne von Speiseresten. Außerdem ermöglicht er das Geschmacksempfinden. Die Gleit fähigkeit der Nahrung wird erhöht und das Schlucken erleich tert. Die Amylase spaltet Kohlenhydrate auf d. h. die Verdauung der Nahrung beginnt bereits im Mund.
Die Speichelproduktion vor der Nahrungsaufnahme wird von psychischen und physischen Faktoren angeregt.
-
Rachen (Pharynx)
Der Rachen bildet den gemeinsamen Teil der Luft- und Speise wege. Berührt Nahrung aus der Mundhöhle die Rachenhinter wand, so wird der Schluckreflex ausgelöst, d.h. Gaumensegel und Kehldeckel verschließen Nasenhöhle und Luftröhre und die Speiseröhre weitet sich.
Im Dienste der Immunabwehr stehen die in der Rachenwand liegenden Gaumenmandeln, die zum lymphatischen Rachen ring gehören.
-
Speiseröhre (Ösophagus)
Die Speiseröhre ist ein Muskelschlauch, der Rachen und Magen verbindet. Er dient dem Nahrungstransport, hat eine eigene Peristaltik und kann die Nahrung aktiv in den Magen schieben.
-
Magen (Gaster)
Der Magen ist eine sackartige Erweiterung des Verdauungs kanals mit einem Fassungsvermögen von etwa 1,5 Ltr. Seine Form und Lage sind variabel.
Der Magen hat folgende Aufgaben:
, Nahrungsspeicherung. Die Verweildauer der Nahrung vari iert je nach Zusammensetzung:
-
Wasser ➔ 20 Min.
-
Kohlenhydrate ➔ 1-2 Std.
-
Eiweiß ➔ 3-4 Std.
-
Fett ➔ 5-7 Std.
-
Nahrungszerkleinerung und Durchmischung (durch mecha nische Bewegungen beginnt die Verflüssigung von Fetten sowie die Eiweißverdauung)
-
Bildung von Magensaft (etwa 2 Ltr. pro Tag). Bestandteile des Magensafts:
-
Salzsäure (HCI; greift alle Eiweißmoleküle an und zerstört deren Oberflächenstruktur, wirkt auch „desinfizierend",
d. h. tötet viele Keime ab)
-
Pepsin (eiweißspaltendes Enzym)
-
Magenschleim (schützt den Magen vor Selbstverdauung)
-
,,lntrinsic factor" (erforderlich, damit der Dünndarm Vita- min B12 aufnehmen kann)
-
-
-
-
Dünndarm (Intestinum tenue)
Im Dünndarm findet die eigentliche Verdauung und die Auf nahme der meisten Nahrungsbestandteile (Resorption) statt.
Verdauungssystem
LAGE DES MAGENS
Zu diesem Zweck ist die innere Oberfläche durch Auffaltungen der Schleimhaut und der Zellen sehr stark vergrößert - auf etwa 200 m'. Die Zellen der Dünndarmschleimhaut werden täglich erneuert. Die Gesamtlänge des Dünndarms beträgt 3-5 m und setzt sich aus folgenden Abschnitten zusammen:
-
Zwölffingerdarm (Duodenum; in ihn münden die Ausfüh rungsgänge der Bauchspeicheldrüse und der Leber)
-
Leerdarm (Jejunum)
-
Krummdarm (Ileum)
-
Dickdarm (Intestinum crassum)
Der Dickdarm resorbiert Wasser und Salze (Natrium, Kalium) aus dem restlichen Speisebrei und spaltet nicht verdaute Ei weiße und Kohlenhydrate mit Hilfe der reichlich vorhandenen Bakterien über Gärung und Fäulnisvorgängen weiter auf.
Der Dickdarm besteht aus folgenden Bereichen:
-
Blinddarm (Caecum)
-
Wurmfortsatz (Appendix; dient der lnfektabwehr)
-
Grimmdarm (Colon)
-
-
Mastdarm (Rectum) inkl. After (Anus)
Die Darmflora besiedelt den Dickdarm mit 100 bis 400 Bakte rienarten. Die physiologischen Bakterien leben in Symbiose mit ihrem Wirt, dem Menschen. Einerseits leben sie von seinem Darminhalt, andererseits nützen sie ihm auf vielfältige Weise:
LAGE DES DICKDARMS
149
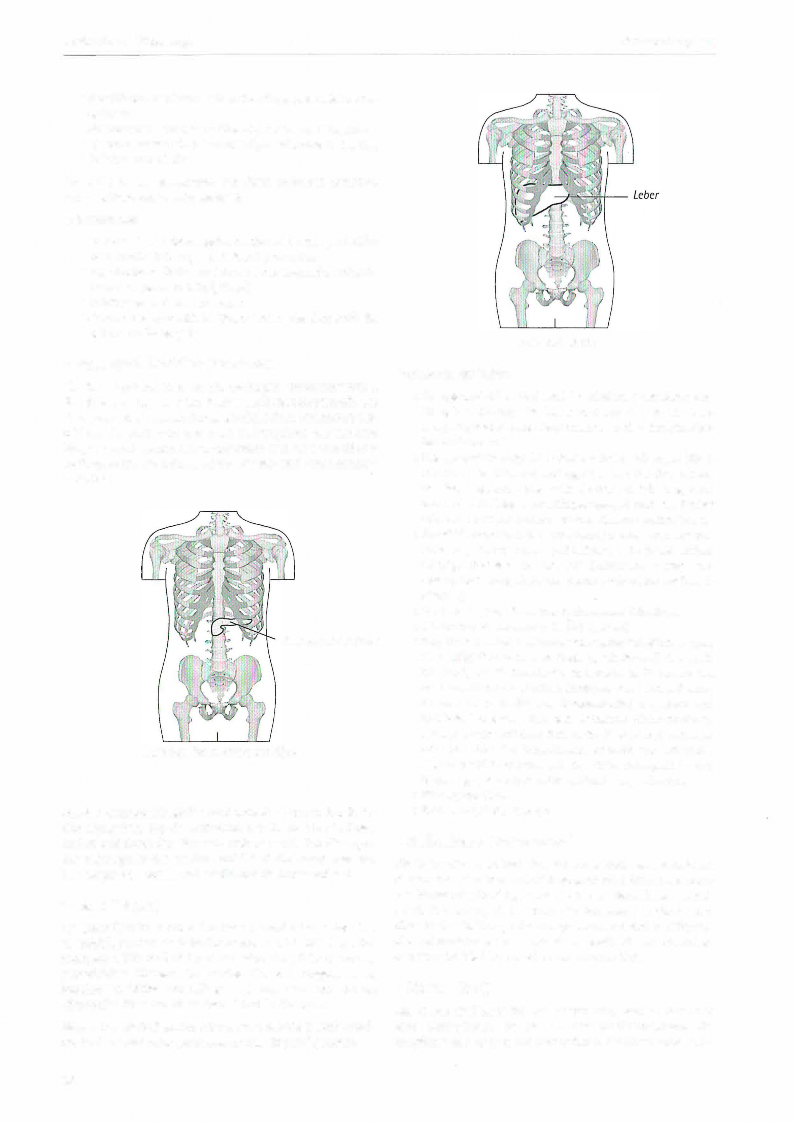
Anatomie und Physiologie Verdauungssystem
-
sie schützen den Darm, indem sie pathologische Keime ver drängen
-
sie zersetzen unverdaute Eiweiße, Zucker und Cellulose
-
sie produzieren die lebenswichtigen Vitamine K, B2, B12, Folsäure und Biotin
Der Stuhl ist der eingedickte und durch Bakterien zersetzte, unverdauliche Rest des Speisebreis.
Er besteht aus:
-
unverdaulichen Nahrungsbestandteilen (vorwiegend Zellu- lose), sowie Gährungs- und Fäulnisprodukten
-
abgestoßenen Zellen und Schleim der Darmschleimhaut
-
Bakterien (etwa 10 Mio/g Stuhl)
-
Entgiftungsprodukte der Leber
-
einem Abbauprodukt des Hämoglobins, das dem Stuhl die bräunliche Farbe gibt
-
Bauchspeicheldrüse (Pankreas)
Die Bauchspeicheldrüse ist die wichtigste Verdauungsdrüse. Sie bildet pro Tag ca. 2 Ltr. Pankreassaft (Bauchspeichel), der sich durch seinen hohen Gehalt an alkalischem Bikarbonat aus zeichnet. Dadurch wird der saure Nahrungsbrei, der aus dem Magen kommt, neutralisiert. Außerdem sind viele verschiede ne Enzyme für die Kohlenhydrat-, Eiweiß- und Fettverdauung enthalten.
Bauchspeicheldrüse
LAGE DER BAUCHSPEICHELDRÜSE
Von der Bauchspeicheldrüse wird auch das Hormon Insulin ins Blut abgegeben, das die Aufnahme von Glukose in die Zellen fördert und damit den Blutzuckerspiegel senkt. Das Glukagon, der Gegenspieler des Insulins, mobilisiert die Energiereserven bei Hunger oder Stress und erhöht den Blutzuckerspiegel.
-
Leber (Hepar)
Die Leber liegt im rechten Oberbauch unmittelbar unter dem Zwerchfell, mit dem sie teilweise verwachsen ist. Mit einem Ge wicht von 1 500 bis 2 000 g ist die Leber die größte Drüse des menschlichen Körpers. Das venöse Blut von Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse und Milz gelangt samt den absorbierten Nährstoffen über den Pfortaderkreislauf in die Leber.
Wegen ihrer vielfältigen Funktionen wird die Leber auch „Stoff wechselzentrale" oder „Zentrallabor des Körpers" genannt.
150
LAGE DER LEBER
Funktionen der Leber:
-
Energieproduktion: Glukose ist der Rohstoff der Zellen zur Energiegewinnung. Die Leber baut aus den mit der Nah rung aufgenommenen Aminosäuren und Fettbestandtei len Glukose auf.
-
Energiespeicherung: die Leber produziert Glykogen (Spei cherform der Glukose) und lagert es ein. Darüber hinaus werden aufgenommene Kohlenhydrate in Fett umgebaut und in den Fettdepots des Körpers gespeichert. Bei Bedarf wird aus der Speicherform wieder Glukose synthetisiert.
-
Eiweißstoffwechsel: die Leber kann Aminosäuren sowohl abbauen, als auch neu synthetisieren. Sie bildet zudem wichtige Proteine für das Blut (Albumine, Transportei weiße, Gerinnungsfaktoren, Gamma-Globuline zur Infekt abwehr)
-
Speicherung von Eisen und fettlöslichen Vitaminen
-
Abbau von Hormonen (z. B. Östrogenen)
-
Entgiftung: die Leber ist unser wichtigstes Entgiftungsorgan. Sie verfügt über zahlreiche Enzyme, mit deren Hilfe sowohl körpereigene Stoffwechselendprodukte (z. B. Ammoniak aus dem Abbau von Aminosäuren) als auch körperfremde Substanzen (z. B. Alkohol, Medikamente) umgebaut und inaktiviert werden. Gut wasserlösliche Abbauprodukte gelangen dann mit dem Blut zu den Nieren und verlassen mit dem Urin den Organismus. Schlecht wasserlösliche Abbauprodukte werden mit der Gallenflüssigkeit in den Darm abgegeben und mit dem Stuhl ausgeschieden.
-
Bildung der Galle
-
-
-
Blutbildung beim Embryo
-
-
Gallenblase (Vesica fellea)
Die Gallenblase speichert die gelbbraune Galle, eine Flüssigkeit die von der Leber kontinuierlich gebildet wird. Wird keine Galle zur Verdauung benötigt, wird sie in der Gallenblase gespei chert. Bei Bedarf, d. h. sobald die Verdauung beginnt, wird diese in den Zwölffingerdarm abgegeben. Sie wird benötigt für die Fettverdauung und -resorption, sowie für die Ausschei dung von fettlöslichen Substanzen aus dem Blut.
-
Nieren (Ren)
Die Nieren sind zwar Teil des Harntraktes, werden hier aber kurz beschrieben, da sie als Ausscheidungsorgane die Entgiftung des Körpers mit unterstützen. Sie filtern wasserlös-
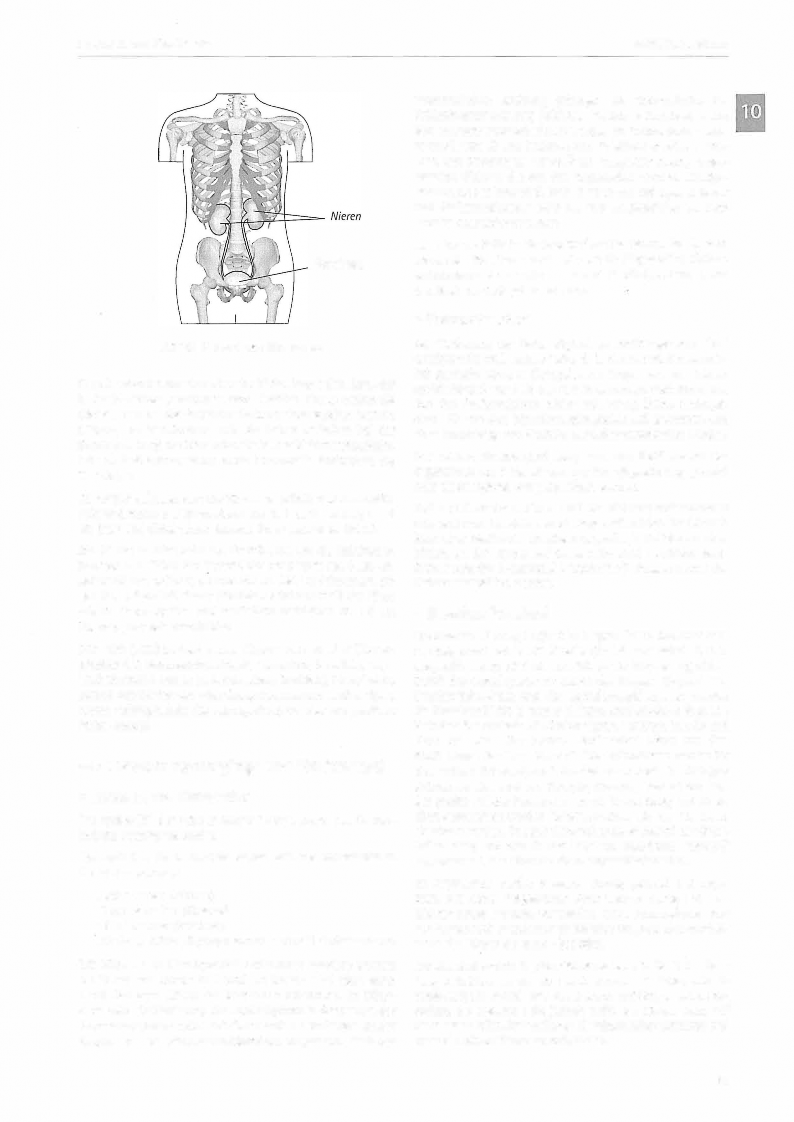
Anatomie und Physiologie
Harnblase
LAGE DER NIEREN UND HARNBLASE
liehe Substanzen aus dem Blut und bildet daraus den Harn, der in der Harnblase gesammelt wird. Darüber hinaus wirken die Nieren auch bei der Aufrechterhaltung eines stabilen inneren Milieus, der Homöostase, mit. Sie haben Aufgaben bei der Konstanthaltung des Wasserhaushalts, des Elektrolythaushalts, bei der Kreislaufregulation sowie hormonelle Funktionen zur Blutbildung.
Im Körper befinden sich die Nieren unterhalb des Zwerchfells links und rechts der Wirbelsäule. Sie sind ca. 11 cm lang und 6 cm breit und ähneln ihrer äußeren Form nach einer Bohne.
Die Nieren werden sehr gut durchblutet, um die Reinigungs funktion zu erfüllen. Pro Tag wird das Blutplasma (ca. 3 Ltr.) un gefähr 60 mal gefiltert, woraus sich ca. 180 Ltr. Primärharn bil det. Der größte Teil dieser Flüssigkeit wird innerhalb der Niere wieder rückresorbiert und schließlich verbleiben ca. 1,5 Ltr. Endharn, den wir ausscheiden.
Der Harn (Urin) besteht neben Wasser aus Harnstoff (Abbau produkt des Eiweißstoffwechsels), Harnsäure, Kreatinin, orga nischen Säuren, Salzen (z. B. Kalksalzen, Kochsalz), Phosphaten, Spuren von Hormonen, Vitaminen, Enzymen und Urobilinogen, einem Abbauprodukt des Hämoglobins, welcher die gelbliche Farbe erzeugt.
-
-
Verdauungsvorgänge und Stoffwechsel
-
-
-
Kohlenhydratstoffwechsel
Der größte Teil der mit der Nahrung aufgenommenen Kohlen hydrate besteht aus Stärke.
Die restlichen Kohlenhydrate setzen sich aus verschiedenen Zuckern zusammen:
-
Milchzucker (Laktose)
-
-
Traubenzucker (Glukose)
-
Fruchtzucker (Fruktose)
-
tierische Stärke (Glykogen kommt nur bei Fleischessern vor)
Mit Hilfe der im Mundspeichel enthaltenen Amylase beginnt die Verdauung bereits im Mund. Im Magen wird diese dann durch das saure Milieu des Magens unterbrochen. Im Dünn darm wird die Verdauung der Kohlenhydrate in Gegenwart der Pankreasamylase sowie zahlreicher anderer zuckerspaltender Enzyme aus der Dünndarmschleimhaut fortgesetzt. Nach der
Verdauungssystem
enzymatischen Spaltung gelangen die Endprodukte der Kohlenhydratverdauung (Glukose, Galaktose, Fruktose) in das Blut und weiter zur Leber. Dort werden die Endprodukte weiter verstoffwechselt und Fruktose und Galaktose werden in Glu kose, den bevorzugten Rohstoff zur Energiegewinnung, umge wandelt. Glukose, die von den Körperzellen nicht zur Energie gewinnung benötigt wird, kann in Form von Glykogen in Leber und Skelettmuskulatur oder als Fett umgewandelt im Fett gewebe gespeichert werden.
Eine zentrale Rolle im Glukosestoffwechsel nimmt das Hormon Insulin ein. Nur durch Insulin können die Körperzellen Glukose aufnehmen und verwerten. Insulin ist das einzige Hormon, das den Blutzuckerspiegel senken kann.
-
Fettstoffwechsel
Die Verdauung der Fette beginnt im Zwölffingerdarm. Dort emulgiert die Gallensäure Fette, d. h. das Fett wird wasserlös lich gemacht. Lipasen (fettspaltende Enzyme aus der Bauch speicheldrüse) wandeln das Fett in einfachere Fettsäuren um. Aus den Spaltprodukten bilden sich winzig kleine Fettkügel chen, die von den Dünndarmepithelzellen aufgenommen und über Lymphwege und Blutbahn zur Leber transportiert werden.
Der weitere Stoffwechsel hängt von den Bedürfnissen des Organismus ab: Fette können zur Energiegewinnung genutzt oder als Energiereserve gespeichert werden.
Fett und Cholesterin können mit der Nahrung aufgenommen oder auch von den Zellen selbst hergestellt werden. Der Mensch kann aber bestimmte mehrfach ungesättigte Fettsäuren nicht bilden. Da der Körper auf diese Fette nicht verzichten kann (man nennt diese „essentielle Fettsäuren"), müssen sie mit der Nahrung zugeführt werden.
-
Eiweißstoffwechsel
Die Eiweißverdauung beginnt im Magen. Durch den stark sau ren Magensaft werden die Eiweiße (Proteine) denaturiert, d. h. ausgefällt. Damit wird die Oberfläche für Enzyme angreifbar. Durch das eiweißspaltende Enzym des Magens (Pepsin), der Bauchspeicheldrüse und der Dünndarmepithelzellen werden die Eiweißmoleküle in immer kleinere Bruchstücke zerlegt. Die kleinsten Bestandteile, die Aminosäuren, gelangen ins Blut und dann zur Leber. Der weitere Stoffwechsel hängt von den Bedürfnissen des Organismus ab. Die Aminosäuren werden für den Aufbau körpereigener Eiweiße verwendet, in Notlagen können sie aber auch zur Energiegewinnung benutzt werden. Der größte Teil der Eiweiße ist jedoch überschüssig und da sie nicht gespeichert werden können, müssen sie von der Leber abgebaut werden. Das dabei entstehende Ammoniak ist für die Zellen giftig und wird in der Leber zu ungiftigem Harnstoff umgewandelt, der über die Niere ausgeschieden wird.
Im Organismus werden Proteine ständig gebildet und abge baut. Die dabei freigesetzten Aminosäuren werden für die Bildung neuer Proteine verwendet. Einige Aminosäuren kön nen hierzu auch in andere Aminosäuren umgewandelt werden, wenn der Körper sie gerade benötigt.
Eiweiße sind sowohl in pflanzlicher als auch in tierischer Nah rung enthalten. 12 der 20 Aminosäuren, aus denen alle Ei weiße aufgebaut sind, kann der menschliche Körper selbst her stellen, die anderen acht jedoch nicht. Der Körper kann auf diese essentiellen Aminosäuren allerdings nicht verzichten und muss sie mit der Nahrung aufnehmen.
151
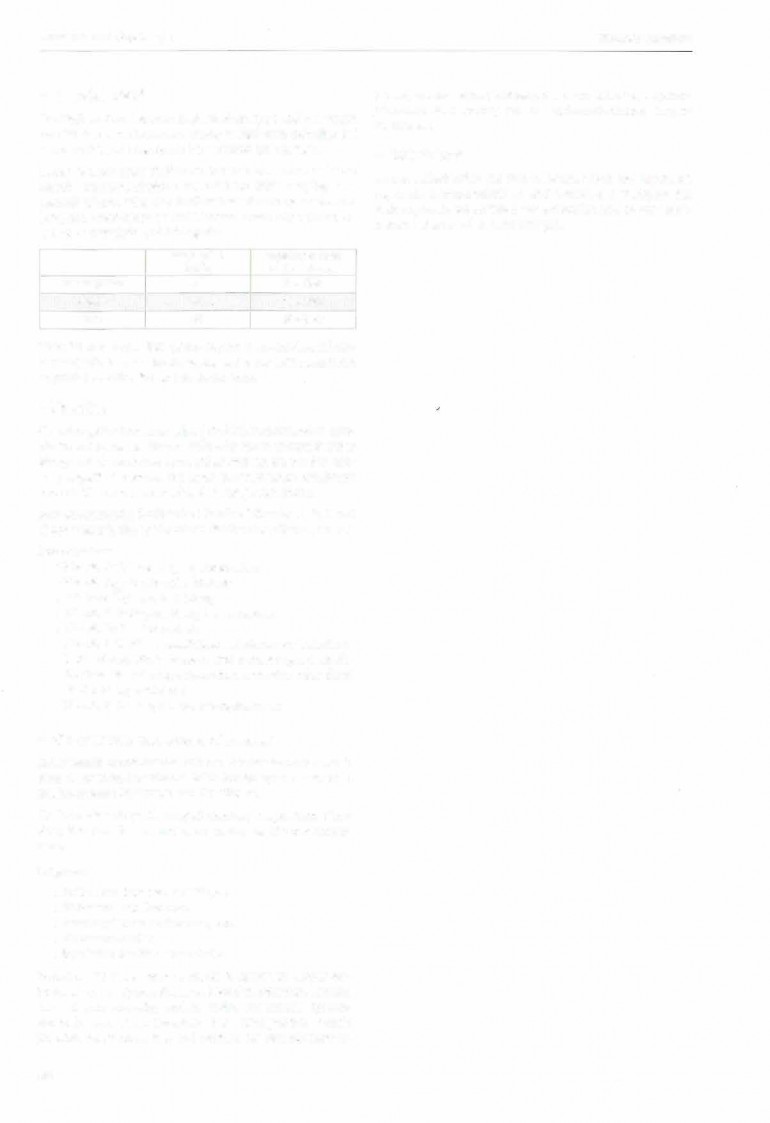
Anatomie und Physiologie
• Energiebedarf
Der tägliche Energiebedarf liegt zwischen 2100 kcal bei Frauen und 2500 kcal bei Männern. Dieser Bedarf kann sich aber bei schwerer körperlicher Arbeit bis auf 3500 kcal steigern.
In den meisten Industrieländern Europas und Amerikas ist die tägliche Kalorienaufnahme mit 3200 bis 3800 kcal/Tag aber deutlich erhöht. Folge sind Stoffwechselerkrankungen wie Fett leibigkeit, Arteriosklerose und Diabetes, sowie Folgeerkrankun gen wie Herzinfarkt und Schlaganfall.
Kohlenhydrate
Energiegehalt kcal/g
4,1
empfohlener Anteil an der Nahrung
55 - 650/o
Eiweiße
Fette
4,1
9,3
10 - 150/o
25 - 300/o'
*Gemäß der Ornish-Diät (siehe Kapitel Herz-Kreislauf-Erkran kungen) würde man den Fettanteil auf unter 10% reduzieren zugunsten der Eiweiße und Kohlenhydrate.
• Vitamine
Vitamine (,,Vita" bedeutet Leben) sind lebensnotwendige orga nische Stoffe, die der Körper nicht oder nur in unzureichender Menge selbst herstellen kann. Daher müssen sie mit der Nah rung zugeführt werden. Bei einer ausgewogenen Ernährung sind alle Vitamine in ausreichender Menge vorhanden.
Man unterscheidet fettlösliche Vitamine (Vitamine A, D, E und
-
von wasserlöslichen Vitaminen (B-Vitamine, Vitamin C u. a.).
Ihre Aufgaben:
-
Vitamin A: Sehvorgang, Hautwachstum
-
Vitamin B12: Erythrozytenbildung
-
Folsäure: Erythrozytenbildung
-
Vitamin C: Kollagenbildung, Immunsystem
-
Vitamin D: Knochenaufbau
-
Vitamin E: Schützt ungesättigte Fettsäuren vor Oxidation, Radikalfänger (Freie Radikale sind krebserregende Stoffe, die über die Nahrung aufgenommen werden oder durch UV-Strahlung entstehen)
-
Vitamin K: Bildung von Gerinnungsfaktoren
-
• Mineralstoffe und Spurenelemente
Mineralstoffe unterscheiden sich von Spurenelementen nur in ihren Mengen im Organismus. Beide Stoffgruppen haben wich tige biologische Wirkungen und Funktionen.
Die Mineralstoffe (= Elektrolyte) Calcium, Magnesium, Phos phor, Natrium, Kalium und Chlor bilden ca. 3% der Körper masse.
Aufgaben:
-
Aufbau von Knochen und Zähnen
-
Aktivierung von Enzymen
-
Erregungsleitung im Nervensystem
-
Muskelkontraktion
-
Regulation des Wasserhaushalts
Es sind ca. 40 Elemente bekannt, die in Spuren im Körper vor kommen und als Spurenelemente bezeichnet werden. Manche sind lebensnotwendig, andere nicht. Essentielle Spuren elemente sind Eisen (Baustein des Hämoglobins), Kobalt (Baustein von Vitamin Bii), Jod (Aufbau der Schilddrüsenhor-
152
Verdauungssystem
mone), Chrom, Kupfer, Mangan, Selen und Zink. Viele Spuren elemente sind wichtig für die unterschiedlichen Enzym funktionen.
• Ballaststoffe
Zu den Ballaststoffen gehören Zellulose, Pektin und Lignin. Sie regen die Darmperistaltik an und fördern den Transport des Nahrungsbreis. Sie schützen vor Giftstoffen und so vor Krank heiten, indem sie den Darm reinigen.
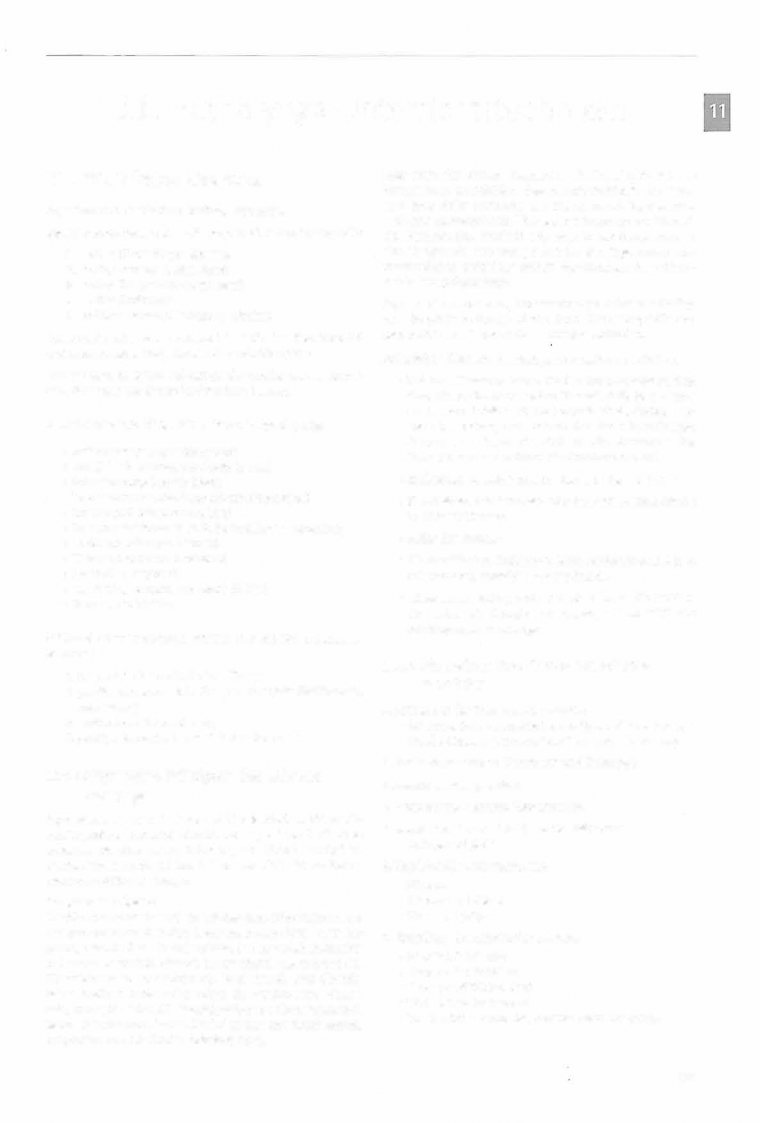
11. Hatha-yoga-U nterrichtstechniken
-
-
Grundlagen des yoga
Yoga bedeutet Verbindung, Einheit, Harmonie.
Swami Vishnu-devananda hatte yoga in fünf Punkte eingeteilt:
-
richtige Körperübung (äsanas)
-
richtige Atmung (präQäyäma)
-
richtige Entspannung (saväsana)
-
richtige Ernährung
-
positives Denken/Meditation (dhyäna)
Diese fünf Punkte sind charakteristisch für den YOGA VIDYA-Stil und machen seine tiefgreifende Gesamtwirkung aus.
Immer wenn du lehrst, solltest du die Schüler darauf hinwei sen, dass yoga aus diesen fünf Punkten besteht.
-
Klassischer Aufbau einer YoGA VIDYA-Stunde:
-
Anfangsentspannung (saväsana)
-
om (3 Mal), mantra, OfTI säntih (3 Mal)
-
Schnellatmung (kapäla-bhäti)
-
Wechselatmung (anuloma-viloma-präQäyäma)
-
Sonnengruß (sürya-namaskära)
-
Bauchmuskelübungen (z. B. Bootstellung - naväsana)
-
12 Grundstellungen (äsanas)
-
Tiefenentspannung (saväsana)
-
Meditation (dhyäna)
-
om (3 Mal), mantra, OfTI säntih (3 Mal)
-
Gruß an die Meister
Während einer Yogastunde müssen vier Aspekte zusammen kommen:
-
körperliche Korrektheit einer Übung
-
geistige und körperliche Entspannung (kein Wettbewerb, kein Zwang)
-
rhythmische Bauchatmung
-
geistige Konzentration und Aufmerksamkeit
-
Allgemeine Prinzipien des Lehrens von yoga
Yoga ist kein Beruf und ist auch nicht wie Mathematik zu leh ren. Yogalehren bedeutet, eine Einstellung bei den Schülern zu schaffen, die eine innere Erfahrung von Einheit ermöglicht. Der/die Yogalehrer/in ist bescheiden und fühlt sich als Instru ment der göttlichen Energie.
Das guru-kula-System
Der/die Yogalehrer/in wird ein Teil der guru-ku/a-Tradition und der guru-paramparä. In dem Moment, in dem du zu lehren be ginnst, wirst du diese Energie spüren. Die körperlichen Aspekte zu kennen, ist wichtig, aber die innere Einstellung während des Unterrichtens ist am wichtigsten. Yogalehrende sind Übende, keine Prediger. Er/sie sollte selbst die Verkörperung dessen sein, was er/sie lehrt. Alle Yogalehrer/innen sollten vegetarisch leben, nicht rauchen, keinen Alkohol trinken und täglich äsanas, präl)äyäma und Meditation (dhyäna) üben.
Yoga steht für Einheit, Harmonie. Die Yogastunde soll die Voraussetzungen schaffen, dass der/die Schüler/in die Erfah rung einer tiefen Harmonie und Einheit macht. Yoga ist zwar auch eine ausgezeichnete Übung zur Entwicklung von Flexibili tät, Muskelstärke, Kreislauf etc., aber in der Hauptsache ist eine Yogastunde eine Gelegenheit für den Yogaschüler, zum ursprünglichen Gefühl der Einheit, der Ganzheit, der Vollkom menheit zurückzukehren.
Yoga zu lehren bedeutet, Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die göttliche Energie fließen kann. Notwendig dafür sind Sensibilität und die Kenntnis bestimmter Methoden.
Äußerliche Hilfen, um die richtige Atmosphäre zu schaffen:
-
-
-
Kleidung. Klassische Farben für den Yogaunterricht im YOGA VIDYA-Stil: weiße Hose, gelbes Oberteil. Gelb ist die Farbe des Lernens. Weiß ist die Farbe der Reinheit. Schüler wer den dies spüren, weil Farben den Geist beeinflussen. Außerdem bringen sie dich in die Stimmung des Unterrichtens und nehmen die Schwingungen auf.
-
Sauberkeit.Du selbst und der Raum, in dem du lehrst.
-
Klare Reihen. Kein Durcheinander der Matten, keine Schuhe im Unterrichtsraum.
-
Bilder der Meister
-
Räucherstäbchen, Duftlampe, Kerze. Meditative Musik (z.B. mit mantras), Yogavideo vor der Stunde.
-
Mantras am Anfang und am Schluss singen. Sie werden dir helfen, die Energien zu empfangen und spirituelle Schwingungen zu erzeugen.
-
Die sieben YoGA V1DYA-Unterrichts
-
-
prinzipien
-
Aufbau auf der YOGA VtDYA-Grundreihe
-
für körperliche, energetische, geistig-emotionale und spi- rituelle Wirkung (korrekte Ausführung der Stellungen)
-
-
Starke Anpassung an Zielsetzung und Zielgruppe
-
Äsanas werden gehalten
-
Entspannung, Atmung, Konzentration
-
Respekt vor innerer Intelligenz der Teilnehmer
-
(Spürgenauigkeit)
-
-
Yogalehrer/in unterrichtet mit:
-
Stimme
-
Händen und Füßen
-
Liebe und prä,:w
-
-
Einstellung des Lehrers/der Lehrerin:
-
ist selbst Schüler/in
-
Liebe zu den Schülern
-
Liebe zur göttlichen Kraft
-
fühlt sich als Instrument
-
-
Teach what you practise, practise what you teach!
153
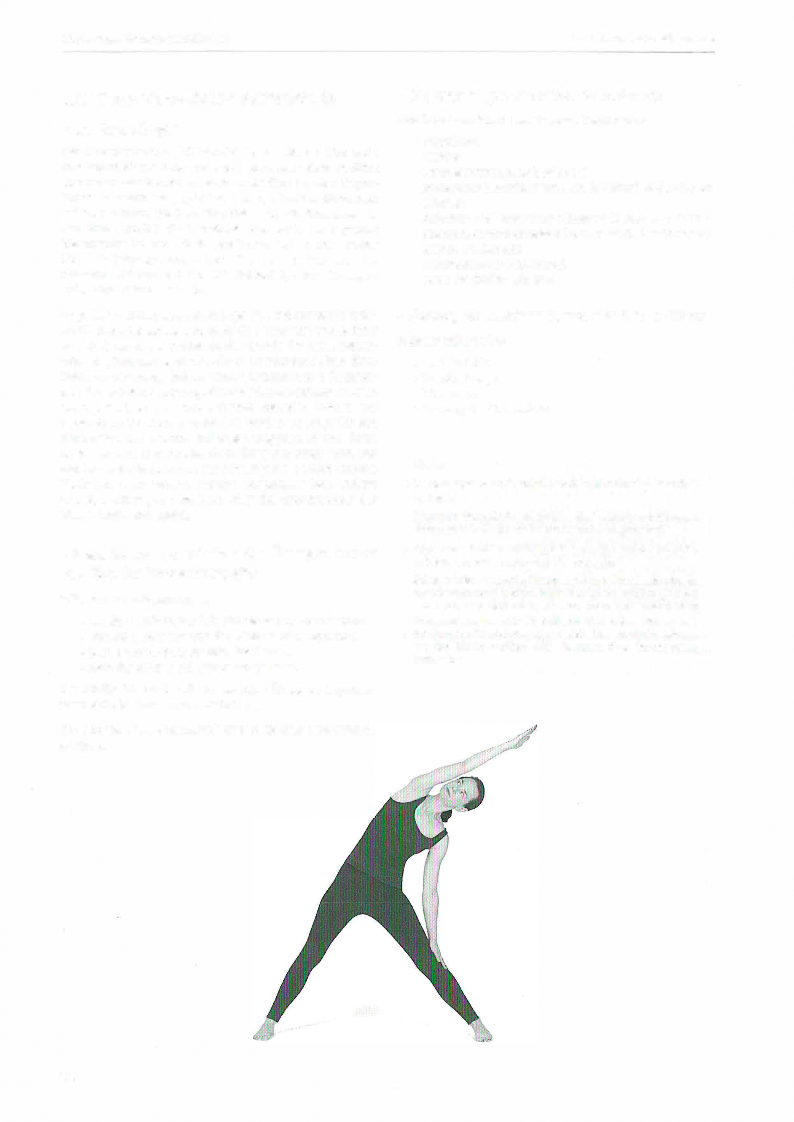
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
-
-
YOGA V1ovA-Reihe Mittelstufe
-
Grundlagen
Die Unterrichtsreihe „Mittelstufe" ist von Swami Sivananda und Swami Vishnu-devananda nach einer sehr alten Tradition zusammengestellt worden, damit die Schüler die vollen körper lichen, energetischen, geistigen und spirituellen Wirkungen erfahren können. Die YOGA V1ovA-Reihe, die die Grundlage für den YOGA V1ovA-Stil bildet, welchen Sukadev in einer großen Variationsbreite und -tiefe geschaffen hat, wurde früher Rishikesh-Reihe genannt - nach dem Ort, an dem sich der Sivananda Ashram befindet. Die Reihenfolge der Stellungen sollte nicht geändert werden.
Es gibt körperliche, energetische, geistige und spirituelle Grün de für diese Reihenfolge. Je mehr du praktizierst und je öfter du lehrst, umso mehr wirst du die Gründe für diese Reihen folge erspüren und erfahren. Alle deine Stunden sollten diese Reihe zur Grundlage haben. Einige Variationen und Änderun gen sind möglich: Im Anfängerkurs werden die Schüler langsam herangeführt. In den Fortgeschrittenenstunden können aus dieser Reihe Variationen entwickelt werden. Im „Yoga für den Rücken" werden manche Stellungen weggelassen und durch andere ersetzt. Kinder halten die Stellungen weniger lange und machen mehr Variationen. Bei Schwangeren werden manche Stellungen mehr betont, manche weggelassen bzw. variiert und Spezialübungen eingebaut. Aber die Grundstruktur der Stunde bleibt stets gleich.
• Beachte, dass es zwischen den Übungen immer eine Zeit der Entspannung gibt
Während der Entspannung ...
-
hat die Herzfrequenz Zeit, sich wieder zu normalisieren.
-
wird die Milchsäure von den Muskeln abtransportiert.
-
kann prär:10 (Lebensenergie) frei fließen.
-
kann der Schüler sich geistig entspannen.
Der Schüler ist bereit, mit der nächsten Übung zu beginnen, wenn sich die Atmung normalisiert hat.
Die YOGA V1ovA-Reihe Mittelstufe ist z. B. als offene Yogastunde geeignet.
154
YOGA V1ovA-Reihe Mittelstufe
-
-
-
-
-
-
Die Grundlagen einer YOGA V1ovA-Stunde
Eine YOGA V1ovA-Stunde hat folgende Bestandteile:
-
Begrüßung
' mantra
-
Anfangsentspannung (saväsana)
-
prä(läyäma (Atemübungen), um Sauerstoff und prä(la zu erhöhen
-
Aufwärm- und Vorbereitungsübungen (Augen- und Nacken- übungen, sOrya-namaskära [Sonnengruß], Beinübungen)
-
äsanas (Stellungen)
-
Endentspannung (saväsana)
-
kurze Meditation (dhyäna)
-
Äsanas, die in keiner Yogastunde fehlen dürfen
In dieser Reihenfolge:
-
Umkehrstellung
-
Vorwärtsbeuge
-
Rückbeuge
-
Drehung der Wirbelsäule
Merke:
-
Die Mittelstufen-Stunde ist für Menschen mit normaler Gesundheit geeignet.
-
Wegen der Gesundheitsgesetze ist es nicht erlaubt, zu behaupten, dass yoga heilt: Heilen dürfen nur Ärzte und Heilpraktiker!
-
Schüler sollten unterschreiben, dass sie gesund sind, oder dass sie selbst für sich die Verantwortung übernehmen.
-
Sollten Schüler bestimmte Probleme haben, behaupte nie, dass du irgendwelche medizinischen Kenntnisse besitzt, sondern gib ihnen lieber ein äsana-Schaubild, das sie ihrem Arzt, Heilpraktiker, Krankengymnasten oder Physiotherapeuten zeigen können. Lass den Arzt oder Physiotherapeuten entscheiden, welche Yogastellun gen der Schüler ausüben darf. übernimm diese Verantwortung nicht selbst.
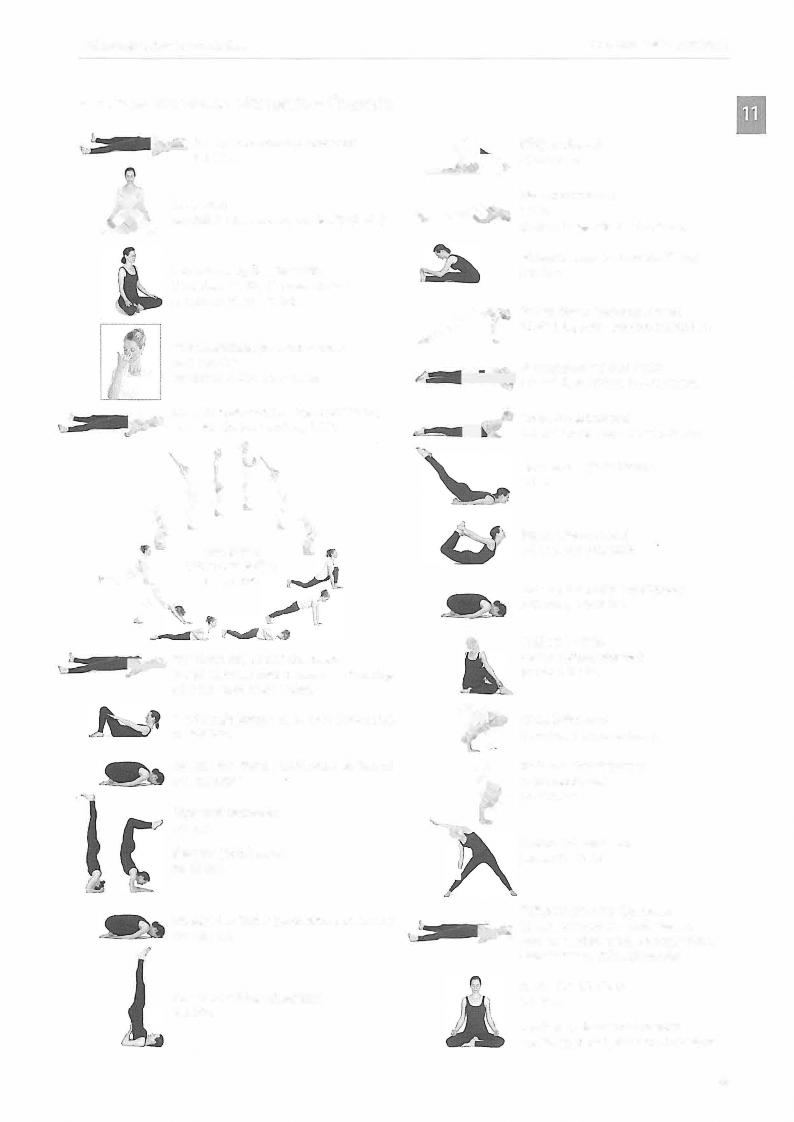
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken YOGA V1ovA-ReiheMittelstufe
-
-
-
YOGA V1DYA-Reihe Mittelstufe - Übersicht t
1-5Min.
1/
,i�-
Anfangsentspannung (savasana)
Pflug (ha/asana)
,;,,c; ".JI� 30-120 Sek.
JW\. om (3Mal)
ft. ein Gebet oder mantra, orr säntib (3Mal)
Schnellatmung (kapala-bhati)
3 Runden: 40, 60, 80 Ausatmungen
Anhalten: 45, 60, 75 Sek.
Fisch (matsyasana)
\,��
� \ l-2Min.
(halb so lange wie Schulterstand)
Vorwärtsbeuge (pascimottanasana)
2-5 Min.
�[� Schiefe Ebene (pürvottanasana)
Wechselatmung (anuloma-viloma)
5-10 Runden
...�.,r-- �--
-
-
Sek.; Bein- und Armvariationen.
Entspannung auf dem Bauch
Rhythmus 4:12:8 oder 4:16:8
p �• wie auf dem Rücken, 5-8 Atemzüge.
-
. Kurze Entspannung im liegen (.savasana)
-
-
� oderMeditation (dhyäna), 1Min.
,. 1ft,
f
t
,1 [ l '1
�
1
(sürya-namaskara)
,\ � Soooeogrnß �
S' -'J),,.
�
Kobra (bhujarigasana)
2-3Mal 30 Sek. oder 1Mal 1-2 Min.
Heuschrecke (sa/abhasana)
1-3Mal
Bogen (dhanurasana)
1-3Mal, mit Schaukeln
/\
......,,(_
6-8 Runden
Stellung des Kindes (garbhasana, balasana). 30-60 Sek.
� (Halber) Drehsitz
r<:. Zwischenentspannung (savasana)
L-;;:;.-,-,- immer zwischen zwei asanas; 5-� Atemzüge
oder bis Atem wieder ruhig.
Bauchmuskelübung, z. B. Boot (navasana),
ca. 2-5Min.
Stellung des Kindes (garbhasana, balasana)
5-8 Atemzüge
Kopfstand (si'r$üsana)
.-
�!-"tr-1
,
...,.
(ardha-matsyendrasana)
jeweils 1-2 Min.
Krähe (kakasana)
mehrmals versuchen lassen
Stehende Vorwärtsbeuge
(pada-hastasana)
30-120 Sek.
1-3Min.
Skorpion (vrscikasana)
Bis 60 Sek.
Stellung des Kindes (garbhasana, ba/asana)
5-8 Atemzüge
('
Schulterstand (sarvarigasana)
2-4Min.
CC Dreieck (tri-kof)äsana)
jeweils 30-45 Sek.
/
Tiefenentspannung (savasana)
.,..__
�- 10Min. Anspannen - lockerlassen,
t.f-:,..-,- Autosuggestion, geistige Entspannung,
Visualisierung, Stille, Affirmation
Meditation (dhyana)
1-3Min.
om (3Mal), Gebet oder mantra,
orr santib (3Mal), Gruß an die Meister
155
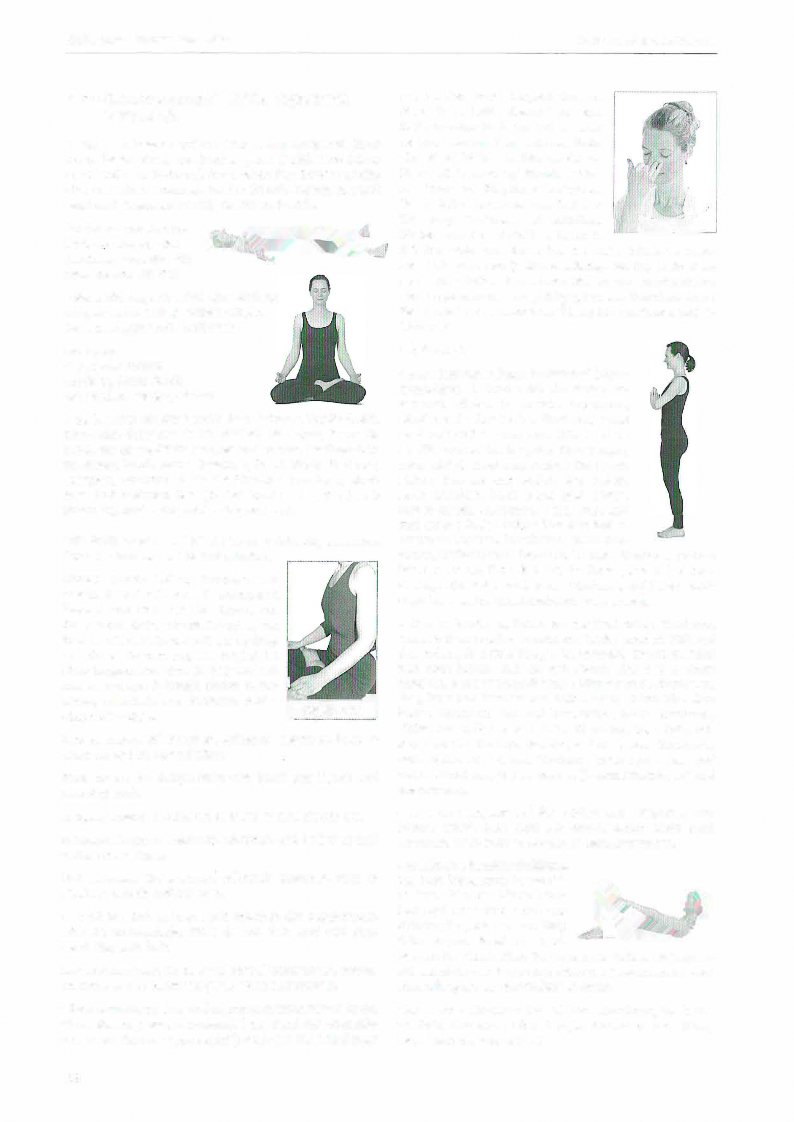
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
-
-
Standardansagen offene Yogastunde Mittelstufe
-
Lege dich langsam auf den Rücken und entspanne (savä sana). Fersen etwas auseinander geben (Fußabstand ausrei chend weit- ca. 50-60 cm). Arme neben dem Körper, Handflä chen nach oben. Einatmen, Bauch hebt sich! Ausatmen, Bauch
senkt sich! Einatmen, 3-4 Sek. Ausatmen, 3-4 Sek.
YOGA V1ovA-Reihe Mittelstufe
der rechten Hand Beugen) formen. Atme durch beide Nasenlöcher aus. Schließe das rechte Nasen-loch mit dem rechten Daumen. Atme links ein. Halte die Luft an, 16 Sek. Schließe die Nasen löcher mit Daumen und Ringfinger, klei ner Finger an Ring-finger anliegend.
Rechts 8 Sek. lang ausatmen. Rechts 4
Einatmen - orr eins, orn
zwei, om drei, orr vier.
.....
Sek. lang einatmen. Luft anhalten. Rücken gerade. Gesicht entspannt.
--- --
Ausatmen - orn eins, orn
zwei, am drei, orn vier.
,_;;'·,'-.....�._., "�
) Schultern entspannt. Beson-ders die rechte Schulter entspan nen. Links ausatmen (= eine vollständige Runde). Links einat
men. Luft anhalten. Konzentriere dich auf den Punkt zwischen
-
Setze dich langsam auf zu einer Stellung mit gekreuzten Beinen, Rücken gerade. Lasse die Augen noch geschlossen.
om om om
Gebet oder mantra
orn säntib säntib säntib
orr, Frieden, Frieden, Frieden
-
Du beginnst mit drei Runden Schnellatmung (kapä/a-bhäti). Setzte dich dabei gerade hin, schließe die Augen, forme die Hände zur cin-mudrä (Zeigefinger und Daumen berührensich). Ein-atmen, Bauch hinaus. Ausatmen, Bauch hinein. Einatmen, ausatmen, einatmen. 1. Runde: Einatmen, ausatmen, einat men. Und beginnen: Zwei (forciert Ausatmen) - eins (passiv Einatmen); zwei - eins; zwei - eins; zwei - eins ...
Vollständig ausatmen. Tief einatmen. Vollständig ausatmen. Bequem einatmen und die Luft anhalten.
[!::%::. _ _ .
Rücken gerade halten, Schultern ent spannt. Gesicht entspannt. Stirn entspannt. Konzentriere dich auf den Bauch, den Solar-plexus. Spüre, wie die Energie in den Bauch strömt. Halte die Luft nur so lange an, wie es für dich bequem möglich ist. Atme langsam aus. Atme ein paar Mal nor mal ein und aus. 2. Runde: Einatmen, aus- '
atmen, einatmen. Und beginnen: zwei - -=j
den Augenbrauen, das geistig-spirituelle Energiezentrum. Rechts ausatmen ... Beende die Übung links ausatmend nach 5- 10 Runden.
-
Spüre nach.
-
Stehe langsam auf zum Sonnengruß (sürya namaskära). l. Runde: Gib die Fersen zu sammen, Rücken ist gerade. Ausatmen, Hände vor der Brust falten. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, Hände neben die Füße auf den Boden geben (Knie beugen, wenn nötig). Einatmen, rechtes Bein nach hinten, Knie auf den Boden, Kinn heben. Atem anhalten, beide Beine nach hinten, Körper gerade. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn auf den Boden, Hüften über dem Boden. Einatmen, Kopf und Brust heben, Kobra. Aus-
atmen, Hüften heben, Fersen nach unten. Einatmen, rechtes Bein nach vorne, linkes Knie auf den Boden, Kinn heben. Aus atmen, beide Beine nach vorne. Einatmen, aufrichten, beide Arme hoch und zurück. Ausatmen, Arme senken.
-
Runde: Ausatmen, Hände vor der Brust falten. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, Hände neben die Füße auf den Boden geben (Knie beugen, wenn nötig). Einatmen, linkes Bein nach hinten, Knie auf den Boden, Kinn heben. Atem anhalten, beide Beine nach hinten, Körper gerade. Ausatmen,
Knie, Brust und Stirn auf den Boden legen, Hüften über dem
ei. ns,. zwei. - ei.ns ...
Kapala-bhat, 1
Boden. Einatmen, Kopf und Brust heben, Kobra. Ausatmen,
Und ausatmen. Tief einatmen, vollständig ausatmen. Bequem einatmen und die Luft anhalten.
Stelle dir vor, die Energie steigt vom Bauch zum Herzen und zum Kopf hoch.
langsam ausatmen. Atme ein paar Mal normal ein und aus.
-
Runde: Einatmen, ausatmen, einatmen. Und beginnen: zwei
- eins; zwei - eins ...
Und ausatmen. Tief einatmen; vollständig ausatmen. Bequem einatmen und die Luft anhalten.
Hüften heben, Fersen nach unten. Einatmen, linkes Bein nach vorne, rechtes Knie auf den Boden, Kinn heben. Ausatmen, beide Beine nach vorne. Einatmen, beide Arme hoch und zurück. Ausatmen, Arme senken ... (je nach Situation, 3-5 Mal wiederholen).
-
-
Lege dich langsam auf den Rücken und entspanne. Ein atmen, Bauch hebt sich! Ausatmen, Bauch senkt sich! Einatmen, neue Energie. Ausatmen, ganz entspannen.
-
Es folgt eine Bauchmuskelübung.
Das Boot (naväsana): Beuge dei-
ne Knie, falte die Hände hinter
�' ,'
Konzentriere dich auf den Punkt zwischen den Augenbrauen
oder die Schädeldecke. Stelle dir vor, dein Kopf wird ganz leicht, klar, weit, licht.
dem Kopf (oder strecke die Arme <"
Richtung Knie, wie auf dem Bild).
Hebe langsam Brustkorb, Schul- c.: -
·,'
langsam ausatmen. Ein paar Mal normal weiteratmen. Strecke die Beine aus. Du kannst sie gerne etwas ausschütteln.
-
Komme wieder zu einer Stellung mit gekreuzten Beinen für die Wechselatmung (anuloma-vi/oma), linke Hand zur cin-mudrä und rechte Hand zur vig,u-mudrä (Zeigefinger und Mittelfinger
156
tern und Kopf hoch. Atme tief ein und aus. Drücke die Lenden
wirbelsäule in den Boden und spüre die Bauchmuskeln. Aus atmen, langsam aus der Stellung kommen.
-
-
-
-
-
-
-
Entspannen.Einatmen, Bauch hinaus. Ausatmen, Bauch hin ein. Beim Einatmen strömt Energie hinunter zu den Füßen, beim Ausatmen wieder hoch.
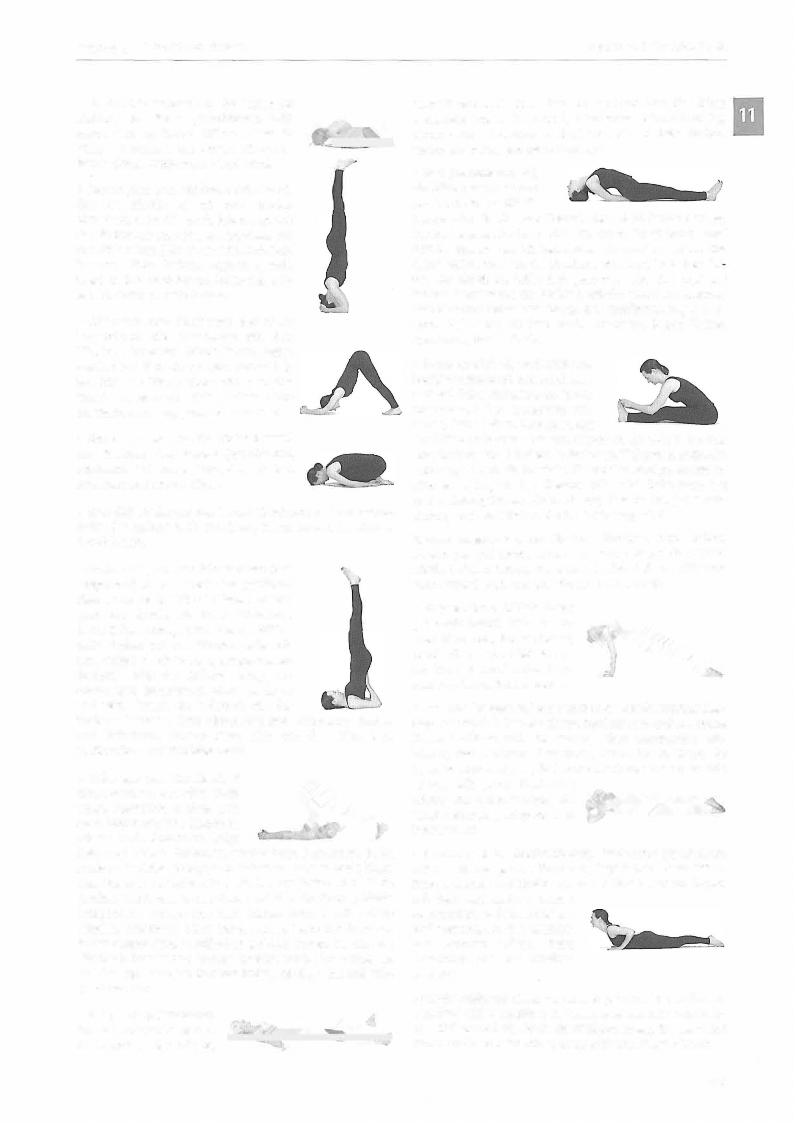
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
Stellung des Kindes (garbhäsana, bä/ä- �
-
Setzte dich langsam auf die Fersen zur
sana). Stirn am Boden, Hände neben die (_J ...,�
Füße, Handrücken am Boden. Einatmen,
Bauch hinaus. Ausatmen, Bauch hinein. (
-
Kommt jetzt zum Kopfstand (fr?äsana). Erst die Ellenbogen mit den Händen abmessen, dann die Hände falten. Kopf auf den Boden geben, Beine ausstre-cken. Mit den Füßen zum Körper hin wandern. Knie beugen, Füße heben. Rücken gerade machen, Knie nach hinten, Beine ausstrek ken. Tief atmen, ruhig halten.
-
Alternativ zum Kopfstand: der Ellen bogenstand. Die Ellenbogen mit den Händen abmessen. Hände falten. Beine ausstrecken. Kopf oben halten, Nacken lok ker. Mit den Füßen etwas näher zu den Ellenbogen wandern. Ruhig halten. Halte die Stellung so lange, wie es bequem ist.
-
Komme langsam aus der Stellung zurück zur Stellung des Kindes (garbhäsana, bäläsana). Entspanne besonders Nacken, Schultern und oberen Rücken.
-
Lege dich wieder auf den Rücken (saväsana) und entspanne. Spüre der Stellung nach. Einatmen, Bauch hinaus. Ausatmen, Bauch hinein.
-
Komme langsam zum Schulterstand (sar värigäsana). Achte darauf, dass genügend Platz hinter dir ist. Gib die Fersen zusam
YOGA VIDYA-Reihe Mittelstufe
Handflächen nach oben. Zum Lockern hebe kurz die Hüften hoch, fallen lassen. Brust hoch, fallen lassen. Schultern zu den Ohren ziehen, lockerlassen. Kopf von Seite zu Seite drehen. Zurück zur Mitte. Normal weiteratmen.
• Fisch (matsyäsana). Gib die Füße zusammen und strecke die Beine. Gib die
Hände unter Gesäß oder Oberschenkel. Handflächen sind am Boden, Daumen berühren sich. Einatmen, Brust heben, Kopf zurück. Spanne die Rückenmuskeln bewusst an. Atme tief durch. Spüre, wie sich der Brustkorb ausdehnt. Dein Herz öff net sich dabei. Du fühlst dich ganz frei. Hebe den Kopf und komme langsam aus der Stellung. Gib die Fersen auseinander, lege die Arme neben den Körper, die Handflächen zeigen nach oben. Spüre der Stellung nach. Einatmen, Bauch hinaus. Ausatmen, Bauch hinein ...
• Komme jetzt in die Vorwärtsbeuge (pascimottänäsano). Setze dich lang sam auf. Beine ausgestreckt, Fersen zusammen, Zehen angezogen. Ein atmen, Arme heben. Ausatmen, aus
der Hüfte nach vorne beugen. Hände an die Zehen, Knöchel oder Schienbeine. Schultern lockerlassen. Tief atmen. Spüre die Dehnung. Atme in die Muskeln, die gedehnt werden. Einatmen: Wirbelsäule lang machen. Ausatmen: lasse los. Gehe entspannt in die Stellung hinein. Stelle dir vor, dass du mit jeder Aus atmung noch ein Stück weiter in die Stellung gehst.
Komme langsam aus der Stellung. Einatmen, Arme heben, Oberkörper aufrichten. Ausatmen, Arme hinter dir senken. Hände auf dem Boden, Finger nach hinten. Spüre der Stellung nach. Atme tief ein und aus. Horche in dich hinein.
• Gegenstellung. Schiefe Ebene
men und strecke die Beine. Einatmen, beide Beine heben, Hüften heben. Hüften
(pürvottänäsana). Füße zusam- _ , men. Einatmen, Becken heben,
oder Rücken mit den Händen unterstüt
zen. Entspanne die Waden, entspanne das Gesicht. Halte die Stellung ruhig, ent spannt und konzentriert. Wenn es dir zu viel wird, kannst du jederzeit aus der
Stellung kommen. Bitte nichts forcieren. Entspanne Nacken und Schultern. Konzen-triere dich auf die Kehle bzw. Schilddrüse - auf visuddha-cakra.
• Gehe aus dem Schulterstand direkt weiter in den Pflug (halä-
sana). Ausatmen, rechtes Bein
Brust wölben, atme tief ein und �
_
aus. Einen Moment halten. lang- , sam ausatmen, Becken senken.
• Lege dich langsam auf den Bauch in die Bauchentspannungs lage. Die Hände bilden ein Kissen. Kopf zur Seite drehen. Große Zehen berühren sich, die Fersen gehen auseinander. Ein atmen, Bauch hinaus. Ausatmen, Bauch hinein. Wenn du irgendwo Spannungen spürst, atme dort bewusst neue Energie hinein. Mit jeder Einatmung
erhöht sich deine Energie. Mit �
nach hinten senken. Einatrrien,
wieder hoch. Ausatmen, linkes
ci,._.,.;,,;&
jeder Ausatmung entspannst du 1ö ,.,....._....
�
1/ immer mehr.
Bein nach hinten. Einatmen, wieder hoch. Ausatmen, beide Beine nach hinten. Knie gerade, Zehen angezogen. Arme hinter dem Rücken ausstrecken. Handflächen am Boden oder Hände gefaltet. Tief in den Bauch atmen, dabei in die Stellung hinein entspannen. Unterstütze den Rücken wieder mit beiden Händen. Einatmen, beide Beine heben. Dann die Arme am Boden ausstrecken, Handflächen auf dem Boden. Benutze die Hände als Bremse und komme langsam Wirbel für Wirbel aus der Stellung. Lasse den Kopf am Boden, bis die Beine und Füße am Boden sind.
• Komme zur Kobra (bhujarigäsana). Hände unter die Schultern auf den Boden geben. Einatmen, Kopf heben, Brust heben. Rückenmuskeln und Gesäß anspannen. Ellenbogen am Körper,
Schultern senken. Im Brustkorb weit werden. Mehrmals tief ein und ausatmen. Augen geschlos sen. Bewusst spüren. Beim Ausatmen aus der Stellung kommen.
• Hände wieder als Kissen nehmen. Kopf zur anderen Seite dre
• Entspannung (saväsana). Fersen auseinander geben. Arme neben den Körper,
..
-
-
�,...,
·, hen. Große Zehen zusammen. Fersen auseinander. Atme mehr mals tief aus und ein. Spüre die Rückenmuskeln, die gearbeitet haben und leite beim Atmen neue Kraft und Energie hinein.
157
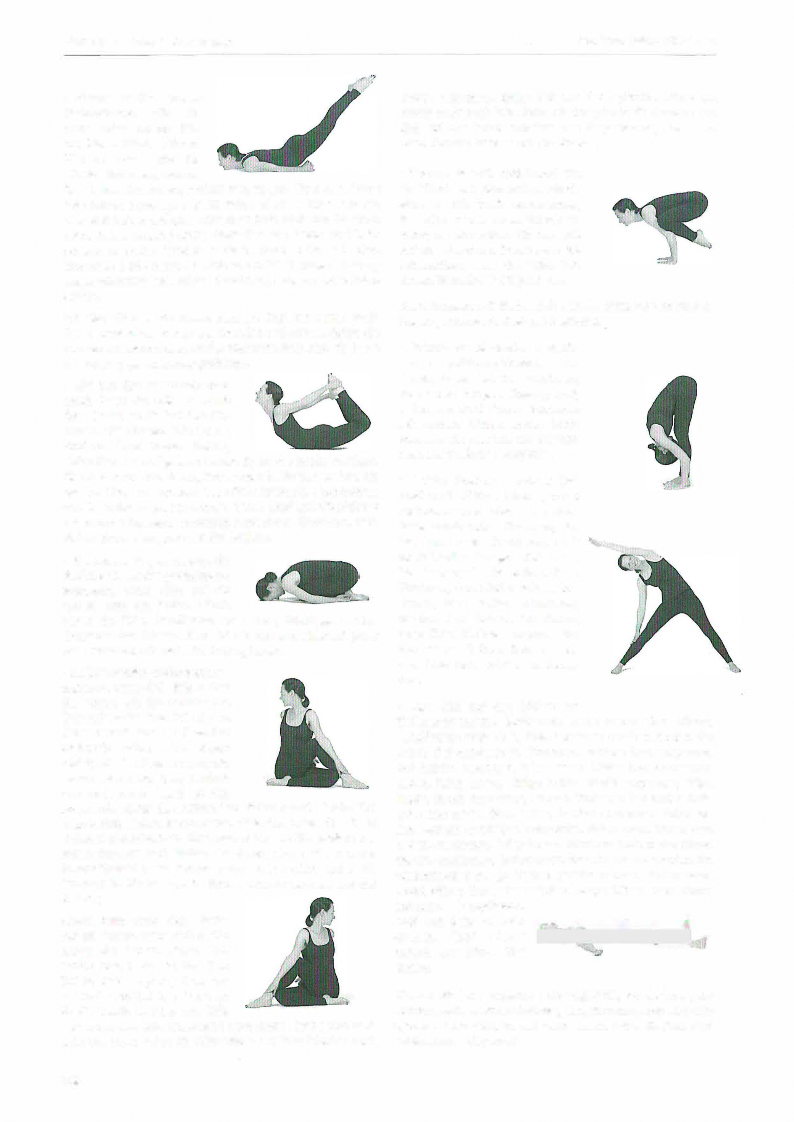
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
• Komme zur Heuschrecke (sa/abhäsana). Gib die Arme unter deinen Kör per. Mache Fäuste mit den Händen oder falte die Hände. Einatmen, rechtes
Bein heben. Ausatmen, rechtes Bein senken. Einatmen, linkes Bein heben. Ausatmen, linkes Bein senken ... Atme jetzt ein paar Mal tief ein und aus. Hebe dann beim nächsten Einatmen beide Beine. Stellung einige Atemzüge lang halten und beim Ausatmen Beine wieder senken. Dann beim nächsten Einatmen beide Beine so hoch wie möglich heben. Stellung einige Atemzüge lang halten. Ausatmen, langsam beide Beine senken.
Mit den Händen ein Kissen machen, Kopf zur Seite, große Zehen zusammen, Fersen auseinander. Tief atmen. Spüre die unteren Rückenmuskeln. Starke Rückenmuskeln sind die beste Vorbeugung gegen Rückenprobleme.
-
Übe nun den Bogen (dhanurä sana). Beuge die Knie. Fasse mit den Händen an die Knöchel. Ein atmen, Füße heben. Knie heben,
Kopf und Brust heben. Stellung
einige tiefe Atemzüge lang halten. Spüre die Rückenmuskeln, die du benutzt. Ausatmen, Beine und Oberkörper senken. Ein paar Mal tief durchatmen. Neue Kraft sammeln. Jetzt komme zum Schaukelbogen. Ein-atmen, Beine, Kopf und Oberkörper heben und Schaukeln. Ausatmen, nach vorne. Einatmen, nach hinten. Komme langsam aus der Stellung.
-
Komme zur Gegenstellung, der Stellung des Kindes (garbhäsana, bäläsana). Setze dich auf die Fersen, Stirn am Boden. Hände
neben die Füße, Handflächen nach oben, Ellenbogen locker. Entspanne den Rücken. Atme tief ein und aus. Sinke mit jeder Ausatmung noch tiefer in die Stellung hinein.
-
Halber Drehsitz (ardha-matsyen dräsana). Setze dich links neben die Fersen. Gib den rechten Fuß links neben das linke Knie (achte dabei darauf, dass der linke Fuß weiterhin neben dem Gesäß bleibt). Gib den linken Arm rechts neben das rechte Knie. Rechten Arm nach rechts, Hand auf den
Boden oder hinter den Rücken. Der Rücken gerade. Drehe dich nach rechts. Nacken ist entspannt. Füße sind locker. Gesicht ist locker. Tief durchatmen. Einatmen, richte die Wirbelsäule auf, rechte Schulter nach hinten. Ausatmen, drehe dich von der Brustwirbelsäule aus immer mehr nach rechts. Spüre die Drehung im Rücken und im Bauch. Komme langsam aus der Stellung.
ANDERE SEITE: Setze dich wieder auf die Fersen. Setze dich rechts neben die Fersen. Linken Fuß rechts neben das rechte Knie (achte dabei darauf, dass der rechte Fuß weiterhin neben dem Gesäß bleibt). Rechten Arm links
neben das linke Knie. Linke Hand nach hinten. Drehe dich nach links. Einatmen, richte die Wirbelsäule auf, linke Schulter nach
158
YoGA V1DYA-Reihe Mittelstufe
hinten. Ausatmen, drehe dich von der Brustwirbelsäule aus immer mehr nach links. Spüre die Energien in dir. Konzentriere dich auf den Punkt zwischen den Augenbrauen, das dritte Auge. Komme langsam aus der Stellung.
-
Übe nun die Krähe (käkäsana). Gib die Hände auf den Boden. Hände etwa schulterbreit auseinander, Finger leicht nach innen. Gib die Ell enbogen nach außen. Gib die Knie auf die Oberarme. Komme auf die Zehenspitzen. Löse die Füße. Tief atmen. Versuche es ein paar Mal.
Stehe langsam auf. Wirbelsäule gerade. Entspanne im Stehen. Augen geschlossen. Tiefe Bauchatmung.
-
-
Komme zur Stehenden Vorwärts- beuge (päda-hastäsana). Ein- atmen, Arme heben. Ausatmen, nach vorne beugen. Stellung ruhig halten. Tief durchatmen. Einatmen, mit rundem Rücken wieder hoch kommen. Ein paar Mal tief durchat men. Der Stellung nachspüren.
-
Letzte Stellung. Dreieck (tri koQäsana). Füße stehen parallel zueinander und etwa eine Bein- länge auseinander. Einatmen, lin- ken Arm heben. Ausatmen, nach ' rechts hinüber beugen. Tief atmen. Die Dehnung in der Seite spüren. Einatmen, Arm wieder heben. Aus
atmen, Arm senken. Einatmen, rechten Arm heben. Ausatmen, nach links hinüber beugen. Tief durchatmen. Spüren. Bewusst deh nen. Einatmen, wieder hochkom men.
-
Lege dich auf den Rücken zur
-
i";•.��
Tiefenentspannung (saväsana). Arme neben dem Körper, Handflächen nach oben. Füße auseinander geben. Kopf in der Mitte. Tief durchatmen. Einatmen, rechtes Bein anspannen und heben, ausatmen, fallen lassen. Linkes Bein anspannen, heben, fallen lassen. Hüften heben, Gesäß anspannen, fallen lassen. Bauch anspannen, unteren Rücken in den Boden drük ken, entspannen. Brust heben, Rücken anspannen, fallen las sen. Rechten Arm heben, anspannen. Fallen lassen. Linken Arm heben, anspannen. Fallen lassen. Schultern hoch zu den Ohren ziehen, anspannen, lockerlassen. Gesicht zur Nasenspitze hin zusammenziehen, ein kleines Gesicht machen, lockerlassen. Mund öffnen, Zunge rausstrecken, Augen öffnen, nach hinten schauen, lockerlassen.
Kopf von Seite zu _Seite
""""-
drehen. Kopf wieder · "� �
zurück zur Mitte. Tief atmen.
Wiederhole jetzt folgende Autosuggestion, wiederhole jede Autosuggestionsformel dreimal geistig für dich selbst: ,,Ich ent spanne meine Füße. Ich entspanne meine Füße. Die Füße sind vollkommen entspannt."
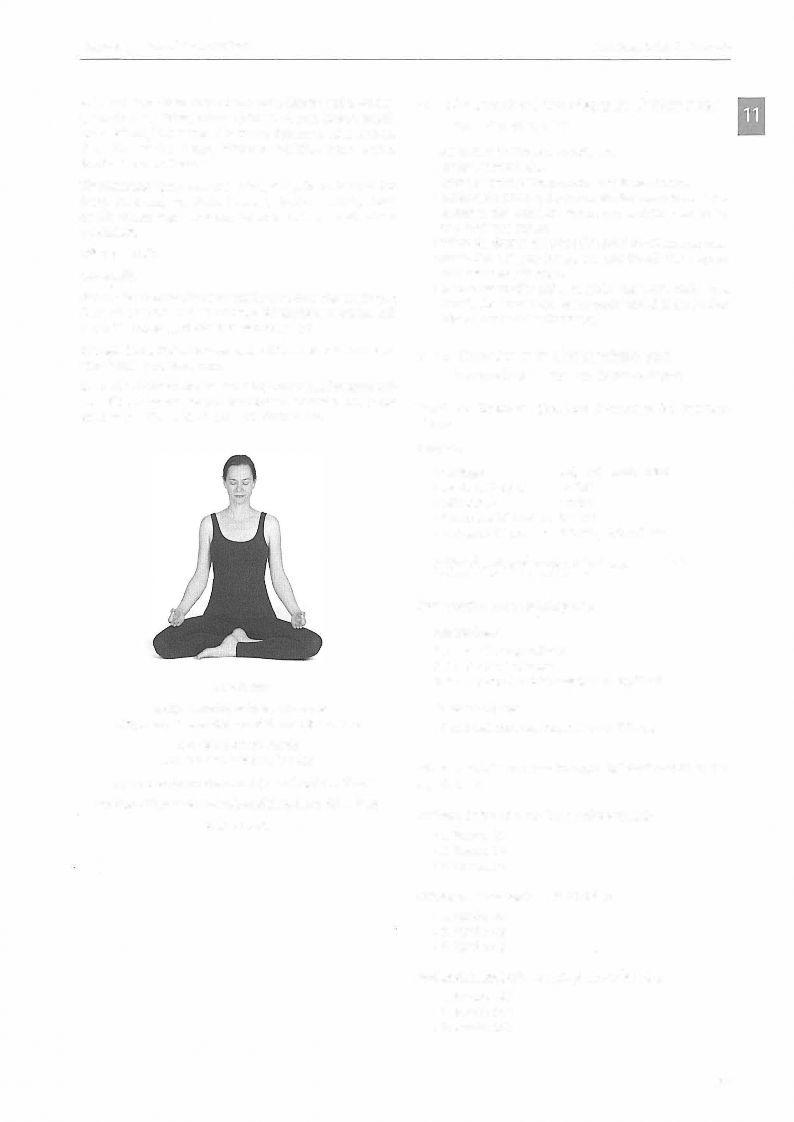
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
Gehe auf diese Weise durch den ganzen Körper: Füße, Waden, Oberschenkel, Hüften, unteren Rücken, oberen Rücken, Bauch, Brust, Hände, Unterarme, Oberarme, Schultern, Hals, Nacken, Kinn, Unterkiefer, Zunge, Wangen, Schläfen, Stirn, Ohren, Kopfhaut, innere Organe.
Visualisierung: Entspanne dich jetzt geistig. Stelle dir einen See (Berg, Wald etc.) vor. Blauer Himmel, die Sonne scheint. Male dir alle Einzelheiten selbst aus. Versenke dich in das Bild dieser Landschaft.
Stille: ca. 3 Min. Of!I (sanft).
Affirmation : Komme langsam wieder zurück zu deinem Körper. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Wiederhole im Geiste, ,,Ich bin in Harmonie", ,,Ich bin ganz geborgen" etc.
Bewege deine Füße. Bewege deine Hände. Strecke die Arme nach hinten aus. Räkle dich.
Setze dich langsam auf zu einer Stellung mit gekreuzten Bei nen. Rücken gerade, Augen geschlossen. Verweile kurz in der Stille. Wir schließen die Stunde mit dreimal am.
YOGA V1ovA-Reihe Mittelstufe
-
-
-
Allgemeine Hinweise zum Unterrichten von Yogastunden
-
Sei immer positiv und ermutigend.
-
Erkläre, vereinfache.
-
Betone Atmung, Entspannung und Konzentration.
-
Bleibe nicht sitzen, während du d·ie Stellungen lehrst. laufe zwischen den Schülern herum und korrigiere sie. Suche und korrigiere Fehler.
-
-
Führe die äsanas nicht mit den Schülern zusammen aus.
-
Stelle dich auf jede Stunde ein. Lass die Schüler entspan nen, wenn es sein muss.
-
Mache die Schüler auf „Das große Yoga Vidya Hatha Yoga Buch", ,,Das Yoga Vidya Asana-Buch" und „Das große illus trierte Yogabuch" aufmerksam.
-
-
-
Hinweise zum Unterrichten von kapäla-bhäti und anuloma-viloma
Verhältnis Einatmen : (Anhalten :) Ausatmen bei anuloma viloma
Beispiele:
-
Anfänger
-
sanfte Mittelstufe
-
Mittelstufe
4:4, 4:8, 4:4:8, 4:8:8
4:12:8
4:16:8
-
fordernde Mittelstufe 5:20:10
-
-
Fortgeschrittene 6:24:12, 7:28:14 etc.
-
-
-
Merke: Ab Mittelstufe ist das Verhältnis 1:4:2.
om om om
/okäf} samastäf} sukhino bhavantu
Mögen alle Wesen Glück und Harmonie erfahren
0f!I säntif} säntif} säntif}
0f!I, Frieden, Frieden, Frieden
0f!I bo/o sad-guru sivänand(a) mahä-räj(a) ... ki"jay
0f!I bolo sr"i-guru vi$(1U-devänand(a) mahä-räj(a) ... ki"jay
Vielen Dank!
Konzentration in der Anhaltephase:
Kapäla-bhäti
-
Runde: Sonnengeflecht
-
Runde: Beckenboden
-
Runde: von der Wirbelsäule zum Kopf hoch
Anuloma-viloma
-
Punkt zwischen den Augenbrauen (tri-kutD
Mögliche Anzahl von Ausatmungen bei kapä/a-bhäti in den Yogastunden:
Anfänger (keine oder nur kurze Anhaltephase):
-
1. Runde: 15
-
2. Runde: 20
-
3. Runde: 25
Mittelstufe (Anhaltephase 40-70 Sek.):
-
1. Runde: 40
-
-
2. Runde: 60
-
3. Runde: 80
Fordernde Mittelstufe (Anhaltephase 40-90 Sek.):
-
1. Runde: 80
-
2. Runde: 100
-
3. Runde: 120
159
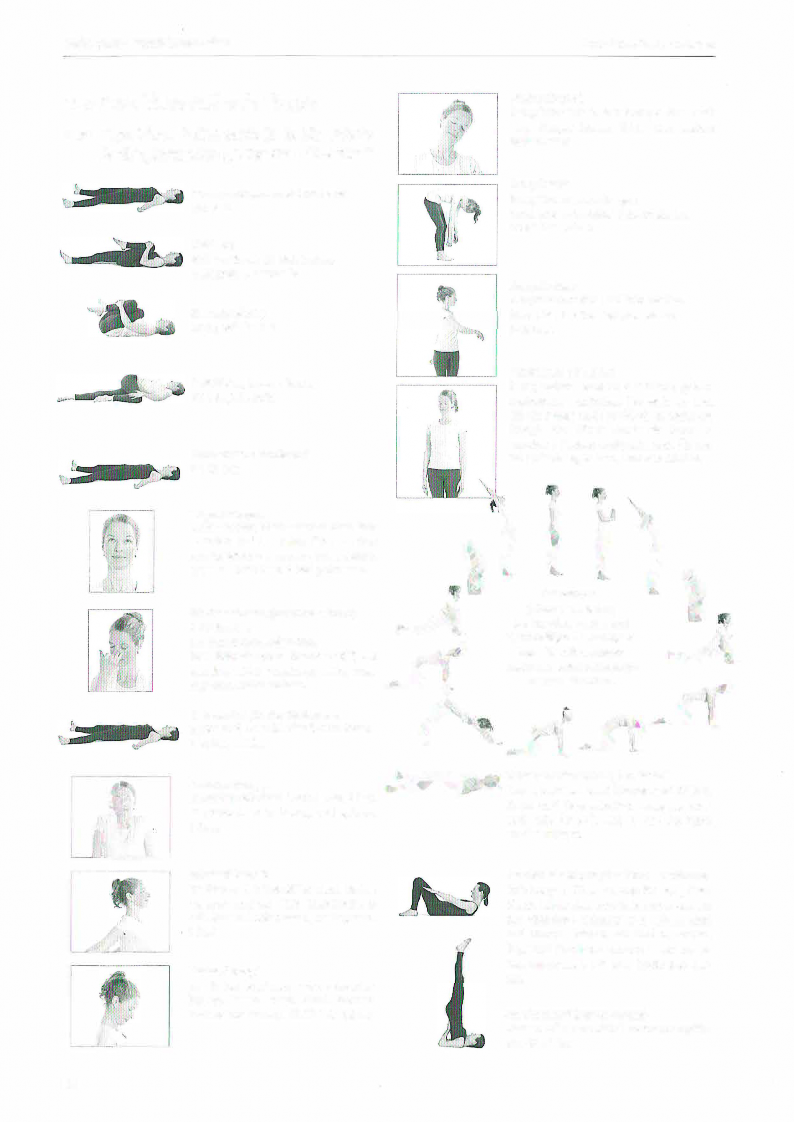
Ha�ha-yoga-Unterrichtstechniken
-
-
-
-
YOGA V1ovA-Reihe Anfänger
YOGA V1DYA-Reihe Anfänger
RNuamckpefneütbwuansgn2ach links beugen. Kopf nach
-
Yoga Vidya-Reihe sanft (z. B. für offene Anfängerstunden geeignet) - Übersicht
lAinnkdserheäSnegiteen.
lassen. 10-15 Sek. halten.
A1-n5faMngins.entspannung (savösana)
nachspüren, wechseln
KKnniie zeuurgBerust, 20 Sek. halten,
1Kr5e-u20zsStreekc. khuanlgten
3D0reSheükb. ujendge(mSeaitkearösana)
Entspannung
Rummpfbneaucghevorne beugen.
A20rm-3e0 uSnedk. Khoapltfelno.cker hängen lassen.
Arme d bei locker baumeln lassen.
RRuummppffdnraechhenrechts und links drehen. 6-10 Mal.
Ruhig stehen. Gewicht auf Fersen geben.
Entspannen im Stehen
aWuifrbdeielsäFuinlegearuufnridchHteann.dfKläocnhzen.trZieiereheddicihe SEcnheurgltieernd, eNracHkäennduendduHricnhterdkioepfA. rÄmhenliczuh
30-60 Sek.
(savösana)
mit Fußsohlen, Beinen, unterem Rücken.
ALiungkes n-ürbeuchntgse; noben - unten; oben links
jeweils 4 Mal; dann 2 Mal palmieren.
-recuhntste, nWarnedch-tsD; auunmten -liNnkase-nspoibtzeen,
,�4 1·�
,F:oe,.J
\:l \
5-10 Runden
Wechselatmung (anulama-vilomo)
Rhythmus 4:4:8 oder 4:8:8
"•:· ....,,,,...-l\�,, •· 6-8(sRüurnyad-enna.mRaushkigöerau) nd 1�· ·
gleichmäßige Bewegungen.
( .i
REvutnl.dSecnh, n1e5ll-a2t5muAnugsa(tkmoepnö,/ak-behinöeti)od2e-3r
..J \,1 t,,
ausBaetimmeVno, rbweiämrtsRbüecukgweänrts-
.?.�1tf...
nur kurze Anhaltephase.
...c:.:
'-'>- .k",... beugen einatmen.
.�Al
Entspannung in der Rückenlage
l Min.
(saväsana) (dhyöna)
c/ , ' . . .J II, llj __::..J~· t
oder Meditation im Sitzen
"'�,-�.J l� 1,-.
�J
f.......... i
,1·,""
61
'/
r,11i
-"'---'
Schulterübung 1
Im Stehen Schultern hochziehen, 5 Sek.
a3nMspaal.nnen, lockerlassen, nachspüren.
3 Mal.
zusamm ziehen, fest anspannen, 5
SImchSutletehreünbuSncghu2lterblätter nach hinten Sek. halten. lockerlassen, nachspüren.
Im Stehen Kopf nach vorne hinunter
Nackenübung 1
khräanfgt ednehlnasesnelna.ssPeans.s1iv0-d1u5rScehk.Shchalwteenr.
��_;
ZImwmiscehr eznweisncthspeannznwuenigÜ(bsauvnögseonn;a3)0-60 Sek. Aautecmh ZuenitdfüKronStziellnetrgaetbioenn abnzwsa.gbeins, Aatbeemr
wieder ruhig ist.
KBnaiuechbmeuugsekne.lüFbüußneg a(duaf sdBeonoBt o-dneanvägseabnean).
dHeärndAebbhiilndtuenr gdeRmichKtoupnfgfaKltneien ogdeebrenw.ieKoapuf uKonpdf uunntderBerusRtükcokrebnanahmebBeond, eBna.ucAhtmmeuns. ktenln. anspannen. 2-3 Mal. 10-30 Sek. hal
len. 45-90 Sek.
SNcahcukeltnerssotallnted s(sicohrvdöanbgeöisaennats)pannt anfüh
160
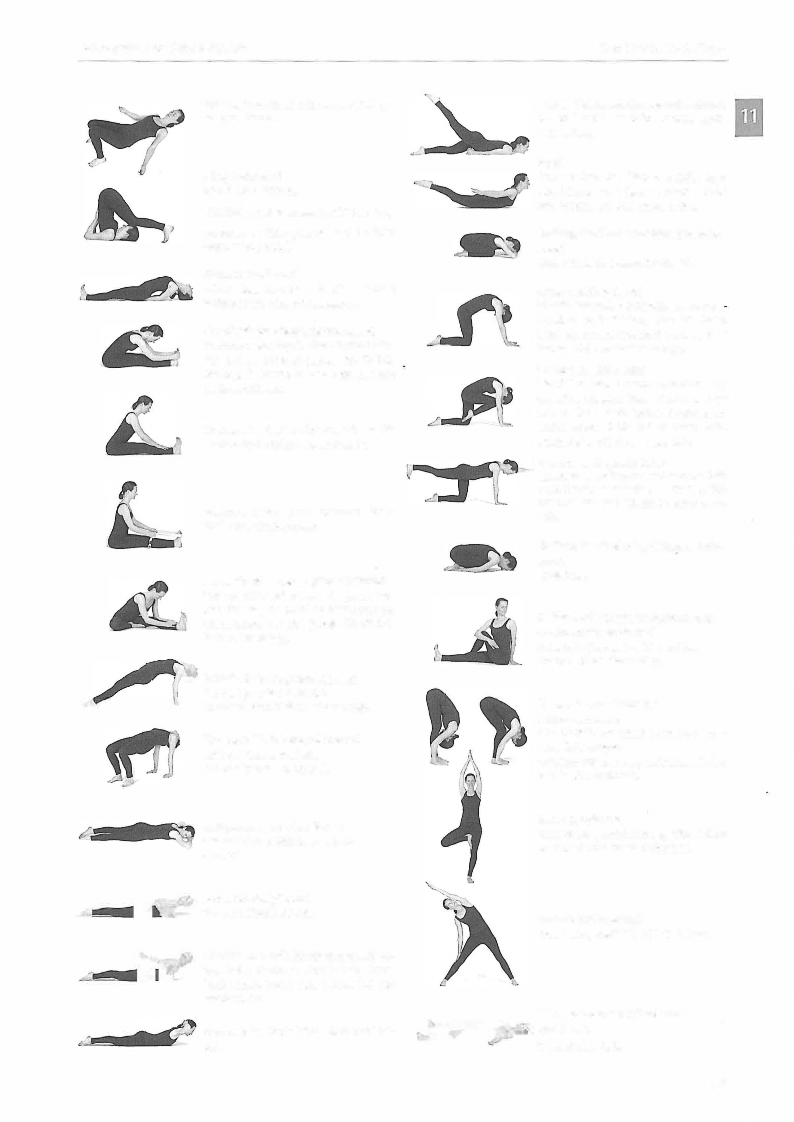
Hatha-yoga-U nterrichtstechniken
Vor Pflug eventuell Entspannung mit ge beugten Knien.
Pflug (ha/asona)
30-120 Sek. halten.
VARIATION 1: Beine ausgestreckt (o. Abb.).
VARIATION 2: Knie gebeugt auf die Stirn legen (siehe Abb.).
Fisch (matsyäsana)
30-60 Sek. Eventuell 2 Mal. Nacken nicht zu weit nach hinten geben.
Vorwärtsbeuge (pascimottänäsana) GRUNDSTELLUNG: Kopf locker hinunter hän gen lassen. 1-3 Mal, jeweils 30-60 Sek. Wichtig: Dehnung in den Beinen, nicht im Kreuz/Rücken.
VARIATION 1: Kopf so halten, wie es für Nacken und Rücken angenehm ist.
VARIATION 2: Kopf oben behalten. Even tuell Yogagurt benutzen.
Halbe Vorwärtsbeuge Uanu-sTr$tisana) Für Anfänger oft besser als ganze Vor wärtsbeuge, da weniger Belastung für Wirbelsäule. 1-3 Mal, jeweils 20-60 Sek. halten. Wechseln.
',
YoGA V1ovA-Reihe Anfänger
Halbe Heuschrecke (ardha-sa/abhasana) 2-3 Mal auf jeder Seite. Jeweils 10-20 Sek. halten.
Vogel
Arme neben den Körper. Hände, Kopf, Oberkörper und Beine heben. 10-30 Sek. halten. 1-3 Mal wiederholen.
Stellung des Kindes (garbhäsana, bälä sana)
evtl. Hände als Kissen, 30-60 Sek.
Katze (märjäry-asana)
Vierfüßlerstand. Ausatmen, Lendenwir belsäule hochschieben, Kinn zur Brust. Beim Einatmen, Brustkorb senken, Kopf heben. 6-12 Mal wiederholen.
VARIANTE 1: Halbe Katze
Vierfüßlerstand. Ausatmen, rechtes Knie zur Stirn bringen. Beim Einatmen Kopf heben, Bein nach hinten ausstrecken, leicht heben. 6 Mal mit rechtem Bein. Dann 6 Mal mit dem linken Bein.
_ ,1 VARIANTE 2: Diagonale Katze
- Linken Arm nach vorne und rechtes Bein nach hinten ausstrecken. Halten, mehr mals tief ein- und ausatmen. Seite wech- seln.
Stellung des Kindes (garbhäsana, bälä sana)
30-60 Sek.
Halber Drehsitz mit gestrecktem Bein
(ardha-matsyendräsana)
Jede Seite jeweils 1-2 Min. halten. Drehen, ohne einzusinken.
� Schiefe Ebene (piJrvottanasana)
L · ,:;::_
1-3 Mal jeweils 10-20 Sek. VARIATION: Kinn bleibt auf der Brust.
VARIATION: Tisch (catu$pädapTtha)
Knie 90 Grad anwinkeln.
1-3 Mal jeweils 10-20 Sek.
Stehende Vorwärtsbeuge
(päda-hastäsana)
30-120 Sek. Eventuell beim Hochkom men Knie beugen.
VARIANTE: Für den empfindlichen Rücken Knie leicht anwinkeln.
,,.1
Entspannung auf dem Bauch wie auf dem Rücken, jeweils 5-8 Atemzüge.
, ��____,,,1/1!1 Kobra (bhuiarigasana)
Baum (vrk$äsana)
Gute Gleichgewichtsübung. Gibt Selbst vertrauen und innere Sicherheit.
Q· •'l
�so{fJ
2-3 Mal je�eils 30 Sek.
VARIATION 1: Hände hinter dem Gesäß fal ten. Beim Einatmen Kopf heben, Brust korb heben. 10-30 Sek. halten. 2-3 Mal wiederholen.
VARIATION 2: Hände hinter dem Kopf hal ten.
Dreieck (tri-ko(Jasana)
Jede Seite jeweils 30-45 Sek. halten
Tiefenentspannung (saväsana)
�� 10-15 Min.
(siehe nächste Seite)
161
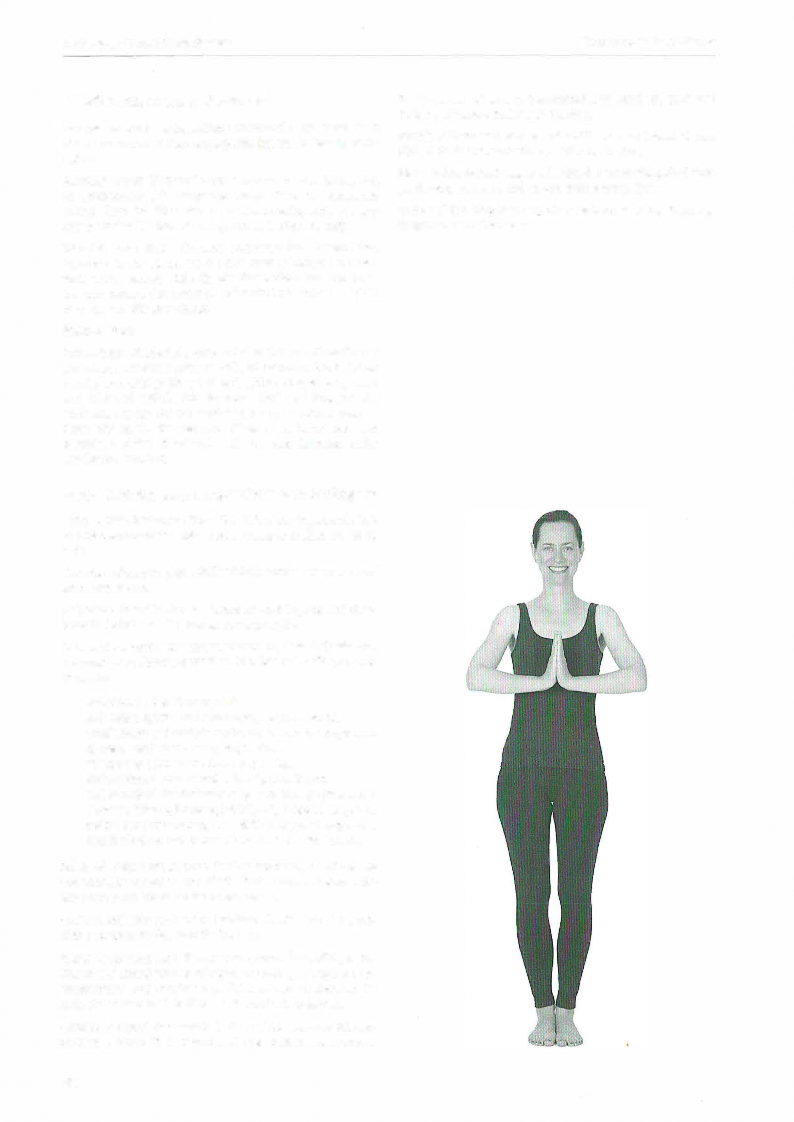
Ha1;ha-yoga-Unterrichtstechniken
-
Tiefenentspannung (saväsana)
Progressive Muskelentspannung: Körperteile von unten nach oben anspannen, 5 Sek. angespannt lassen, loslassen, nach spüren.
Autosuggestion: Körperteile von unten nach oben bitten, sich zu entspannen: ,,Ich entspanne meine Füße. Ich entspanne meine Füße. Die Füße sind vollkommen entspannt. Ich ent spanne meine Waden. Ich entspanne ... ". (siehe S. 159)
Visualisierung: Stelle dir eine wunderschöne Gegend vor, irgendwo in der Natur, wo du dich ganz geborgen und ganz wohl fühlen kannst. Male dir alle Einzelheiten aus. Die Natur um dich herum, den Himmel, spüre die Erde unter dir. Fühle dich eins mit der Umgebung.
Stille: ca. 3 Min.
Affirmation: Wiederhole eine oder mehrere Affirmationen:
„Ich bin in Harmonie mit mir selbst", ,,Ich werde meine Aufgaben freudig und erfolgreich erledigen", ,,Mein Magen ist gesund und fühlt sich wohl", ,,Ich bin voller Kraft und Energie" etc. Finde das, was am ehesten ausdrückt, was du erreichen willst.
Atme tief durch. Strecke und räkele dich. Setze dich auf. Beschließe deine Yogastunde mit ein paar Minuten stiller Meditation (dhyana).
-
-
Hinweise zum Unterrichten von Anfängern
-
-
Nicht zu viele Stellungen üben. Der Ablauf der Yogastunde soll te ruhig, entspannend sein. Besser weniger Stellungen als zu viele.
Stets darauf achten, dass Schüler richtig atmen, entspannt und konzentriert sind.
Aufpassen, dass sich niemand überanstrengt. Yoga ist kein Wett bewerb. Dabei aber die Teilnehmer ermutigen.
Es kommt bei Anfängern weniger darauf an, dass sie Stellungen gut oder gar vollkommen machen. Die Ziele bei Anfängern sind vielmehr:
-
Entwicklung des Körpergefühls
-
Sich selbst spüren und annehmen, so wie man ist.
-
Urteilendem und analysierendem Geist eine Pause gönnen. Spüren, geschehen lassen, empfinden.
-
Freude des bewussten Atems empfinden.
-
Wahrnehmung von Energien im eigenen Körper
-
außergewöhnliche (Entspannungs- und Energie-)Wahrneh mungen: Wärme, Schwere, Leichtigkeit, Kribbeln, Länge etc.
-
Gefühl der Entspannung, der Leichtigkeit, der Energie, des Wohlbefindens und inneren Friedens nach der Stunde
Ruhig, aber dennoch laut und deutlich sprechen, damit alle die Anweisungen verstehen und nicht ständig umherschauen müs sen oder Angst haben, etwas zu verpassen.
Ausreichend, aber nicht zu viel erklären. Schüler sind für prak tische Yogastunde da, nicht für Vortrag.
Kleine Unkorrektheiten durchgehen lassen. übermäßiges Be stehen auf Einzelheiten verhindert am Anfang das Spüren, die Entspannung und verführt zum Urteilen und Analysieren. Es kann aber manchmal als Hilfe zur Konzentration dienen.
Achte stets darauf, dass gerade Schüler mit Nacken- und Rücken problemen nichts für Nacken und Rücken Schädliches machen.
162
YoGA V1DYA-Reihe Anfänger
Bei Anwesenheit von fortgeschritteneren Schülern auch mal fortgeschrittenere Stellungen machen.
Strahle Selbstvertrauen aus, sei einfühlsam und sensibel und fühle dich als Instrument in den Händen Gottes.
Kleine Fehler beim Ansagen oder bei der Reihenfolge sind nicht gravierend, wenn du dich davon nicht beirren lässt.
Gehe auf den Einzelnen ein, aber verliere nicht den Fluss der Yogastunde aus dem Auge.
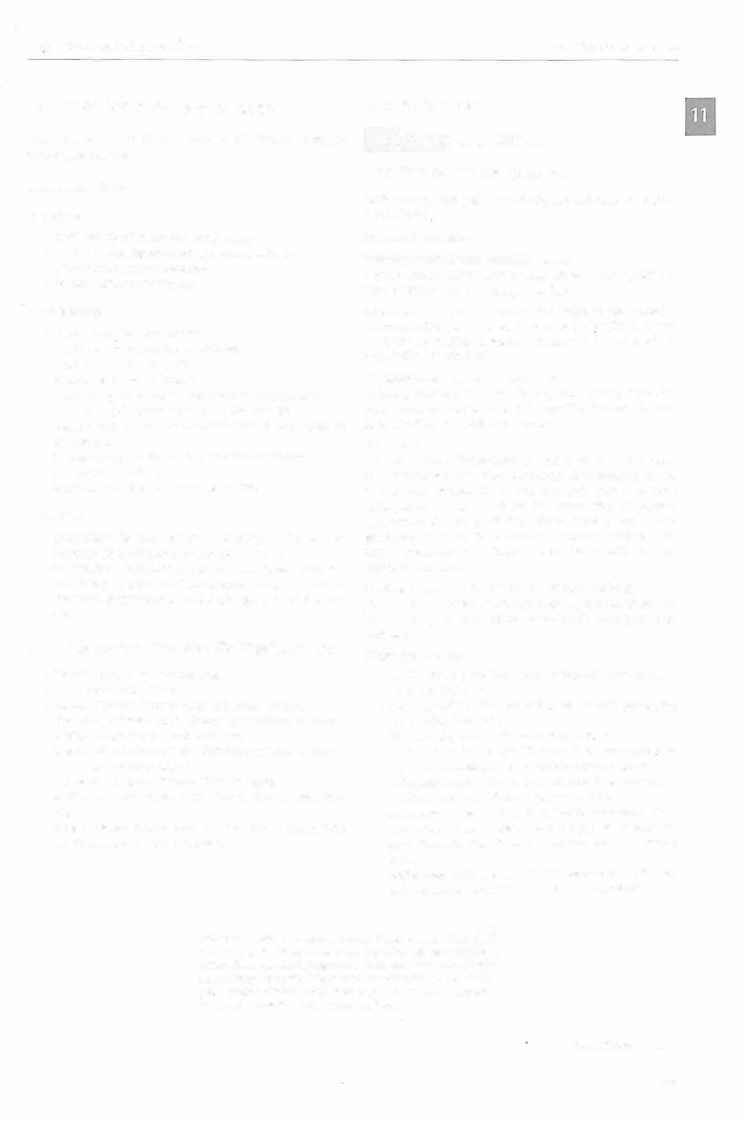
Hatha-yoga-U nterrichtstechniken
-
-
YOGA V1DYA-Anfängerkurse
Diese können als 2x5 Wochen oder als 10 Wochen Anfänger kurs angeboten werden.
-
Lernziele
-
Techniken:
-
zwölf Grundstellungen mit Vorübungen
-
Bauchatmung, kapä/a-bhäti und Wechselatmung
-
Tiefenentspannung (saväsana)
-
Grundmeditationstechniken
-
-
Fähigkeiten:
-
Entwicklung des Körpergefühls
-
Gefühl von Entspannung, Leichtigkeit
-
Erhöhung des Energiegefühls
-
Fühlen von innerem Frieden
-
Entwicklung des subtilen Wahrnehmungsvermögens
-
sich selbst spüren und annehmen, wie man ist
-
Gefühl von Harmonie und Verbundenheit, Geborgenheit im Kosmischen
-
Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden
-
gerade Körperhaltung
-
Auflösung von Spannungen zu jeder Zeit
-
-
Praktisch:
-
Entwicklung der Gewohnheit, regelmäßig zum Yogakurs zu kommen (und Fortsetzung nach diesen Kursen)
-
regelmäßiges Üben zu Hause, wie es in den Tagesablauf passt
-
lntegrierung bestimmter Yogatechniken ins tägliche Leben (Atmung, Entspannung, Aufladeübungen, Körperhaltung etc.)
-
-
-
Allgemeine Hinweise für Yogalehrende
-
Sei stets positiv und ermunternd.
-
Vereinfache und sei klar.
-
Betone Atmung, Entspannung und Konzentration.
-
Sitze nicht, während du die äsanas unterrichtest. Gehe von Schüler zu Schüler, hilf und korrigiere.
-
Mache keine äsanas mit den Schülern zusammen (außer ab und zu mal vormachen).
-
Sei sensibel in jeder Stunde. übereile nichts.
-
-
Erkläre stets den Nutzen jeder Übung, aber gib keine Vor träge.
-
Gehe auf jeden Einzelnen ein, verliere aber nicht den Fluss der Gesamtstunde aus den Augen.
YOGA V10YA-Anfängerkurse
-
-
Anfängerkurs 1 Hatha-yoga 1, 1. Stunde
-
Einführung, Theorie (10-20 Min.)
Dafür sorgen, dass jeder eine Matte hat und dass die Matten richtig liegen,
Sich selbst vorstellen.
Teilnehmer sich einzeln vorstellen lassen
Namen, was an bisheriger Erfahrung mit yoga, etwaige körper liche Beschwerden, Erwartungen an Kurs.
Erkläre kurz, was yoga ist und die fünf Säulen im hatha-yoga
-
Körperstellungen (äsanas), 2. Atmung (pränäyäma), 3. Ent spannung (saväsana), 4. yogische Ernährung, 5. positives Den ken/Meditation (dhyäna)
Hatha-yoga als Hilfe im täglichen Leben
Dehnung, Stärkung, Energien fließen, Entspannung, gegen Rü ckenprobleme, verbessertes Körpergefühl, innerer Frieden, Konzentration, allgemeine Fitness etc.
Kurssystem
Mit YOGA V1ovA-Anfängerkurse 1 und 2 Erlernen der zwölf Grundstellungen des YOGA V1ovA-Stils, Grundatemübungen, Tiefenentspannungstechniken etc. Alternativ kann YOGA V1DYA Anfängerkurse 1 und 2 auch ein Gesamtkurs über 10 Wochen sein. Offene Stunden (zusätzliche offene Stunden evtl. zu ver günstigtem Preis für Kursteilnehmer anbieten, während des Kurses, insbesondere Anfängerstunden interessant). Gefehlte Stunden: Nachholen.
Tradition von Swami Sivananda und Bücher erwähnen
„Das große Yoga Vidya Hatha Yoga Buch", ,,Das große illustrierte Yoga-buch", ,,Das Yoga Vidya Asana-Buch". Yogaübungsplan austeilen.
Allgemeine Hinweise
-
Ca. 2-3 Std. vor der Yogastunde nichts Schweres essen.
-
bequeme Kleidung
-
Kurs regelmäßig besuchen (schon eine Stunde pro Woche gibt positive Resultate).
-
Wer möchte, kann zu Hause zusätzlich üben.
-
Am Ende jeder Kursstunde Übungen für zu Hause vorschla gen oder Hinweis auf offene Anfängerstunde geben.
-
Beim hatha-yoga in Verbindung mit Sport ist es ratsam, zu
erst Sport und anschließend yoga zu machen.
-
-
Hatha-yoga ist keine Disziplin im Wettbewerbssport. Den noch dient er als Schlüssel zum Erfolg, weil er Bewusst sein, Konzentration, Entspannung und korrektes Atmen fördert.
-
-
Hatha-yoga steht nicht nur für Entspannungstechnik, son
dern entwickelt auch Muskelstärke und Flexibilität.
Merke: YOGA VrovA-Anfängerkurse 1 und 2 sind für gesunde Menschen mit normaler Flexibilität gedacht. Bei Menschen mit weniger Flexi bilität müssen manche Übungen durch einfachere Variationen ersetzt werden. Einige alternative Übungen sind im Folgenden als solche ange geben. Andere Variationen findest du im „Das Yoga Vidya Asana-Buch" und im „Das große Yoga Vidya Hatha Yoga Buch".
Fortsetzung: Praxis ►
163
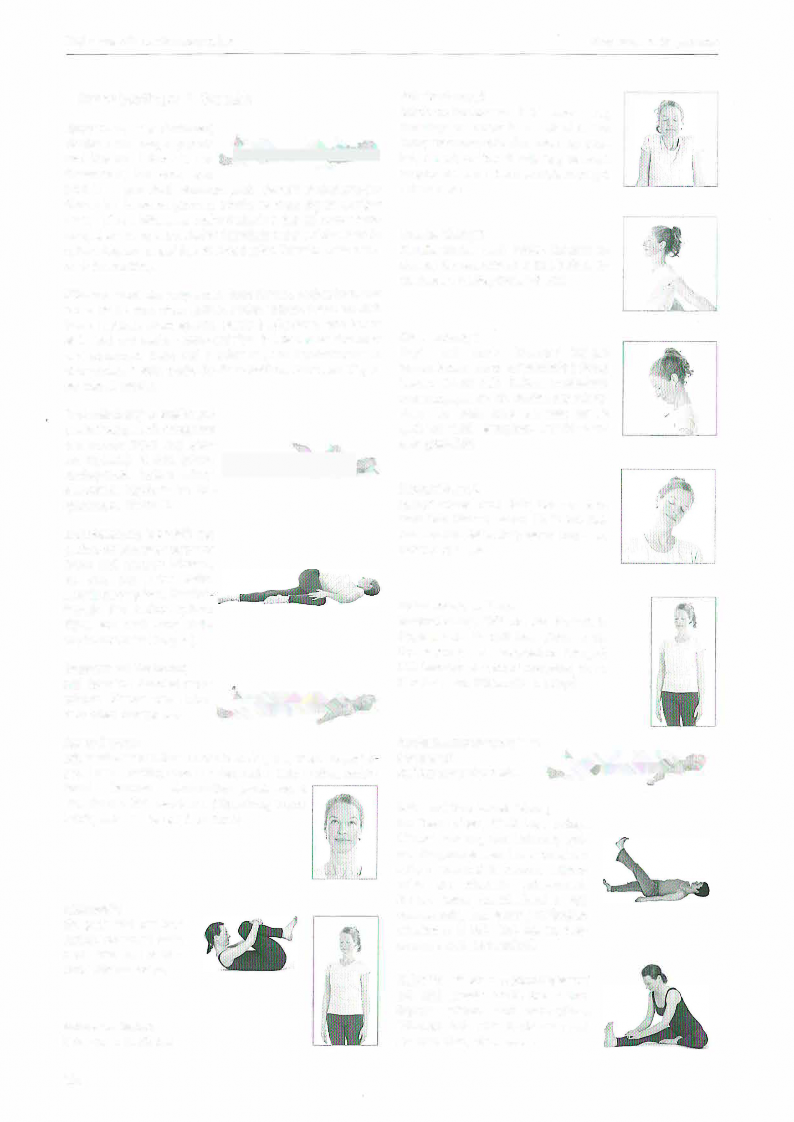
H atha-yoga-Unterrichtstechniken
-
Praxis (Anfänger 1. Stunde)
[�,�-j
Entspannungslage (.saväsana)
Vergiss jetzt Vergangenheit
,c.V
und Zukunft. Sei nur in der� ,....;
Gegenwart, bei dem, was �
jetzt in dir geschieht. Versuche auch, deinem analysierenden Geist eine Pause zu gönnen. Urteile weniger, denke weniger nach, spüre stattdessen mehr. Gedanken mögen weiter kom men, aber richte deine Aufmerksamkeit mehr auf das, was du spüren kannst, als auf das, was du denkst. Korrekte Lage noch mals überprüfen.
Körperbewusstsein: Anspannen, lockerlassen, nachspüren, von unten nach oben. Atem spüren. Boden spüren. Raum um dich herum spüren. Atem spüren. Passiv beobachten, wie Bauch sich hebt und senkt. Atem vertiefen. 3-4 Sek. lang einatmen und ausatmen. Hand auf Bauchnabel, um Bauchatmung zu überprüfen. (Wenn nötig, Schülern helfen). Dann den Körper als Ganzes spüren.
Krokodilsübung 1: Kniebeuge
(Dehnt Hüftgelenk, entspannt
YoGA V1ovA-Anfängerkurse
Schulterübung 1
Schultern hochziehen, 5 Sek. anspannen, lockerlassen, nachspüren. 2-3 Mal. Auf Entspannungsgesetz hinweisen: Ein Mus kel, der mindestens 5 Sek. lang bewusst angespannt wird, kann anschließend gut entspannen.
Schulterübung 2
Schulterblätter nach hinten zusammen ziehen, fest anspannen, 5 Sek. halten, lo ckerlassen, nachspüren. 2-3 Mal.
Nackenübung 1
Kopf nach vorne hinunter hängen lassen. Passiv durch Schwerkraft dehnen lassen. 10-15 Sek. halten. Muskelent spannungsgesetz: Ein Muskel, der minde stens 10 Sek. lang bewusst passiv gedehnt wird, entspannt anschließend
und streckt Kreuz und unte-
ren Rücken.). 20 Sek. halten. � Nachspüren, insbes. Länge
des Beines (Zeichen von Ent- spannung). Wechseln.
Krokodilsübung 2: Drehübung (Dehnt, streckt und entspannt Kreuz und unteren Rücken.)
30 Sek. auf jeder Seite. Jeweils nachspüren, Beschaf .• fenheit des Bodens spüren· (fühlt sich nach einer Seite wie Treppe oder Hang an).
Entspannung (saväsana)
Auf korrekte Bauchatmung
-
'�
.,
:3..
sehr gründlich.
Nackenübung 2
Rumpf etwas nach links beugen. Kopf nach links hängen lassen. 10-15 Sek. hal ten. Andere Seite. Aufpassen: Schultern nicht hochziehen.
Entspannung im Stehen
Bewusst spüren. Wärme oder Kribbeln in Fingern und Handflächen (Zeichen für Entspannung und freigesetzte Energie). Mit Bewusstsein Arme hochgehen bis zu
Schultern, von Füßen bis zum Kopf.
achten. Körper von unten „ l'�. �,,r-;,.a nach oben durchgehen. ,�,.._.;;..,..
Augenübungen
Mit geschlossenen Augen aufsetzen. Augen spüren. Augen öff nen. Links - rechts; oben - unten; unten links - oben rechts; Wand - Daumen - Nasenspitze; jeweils ca. 4
Mal, dann 2 Mal palmieren. (Sitzhaltung kreuz beinig, kniend oder auf dem Stuhl.)
Rückenrolle
Ein paar Mal vor und zurück; eventuell auch nach links und rechts. Dabei Rücken spüren.
Bewusstes Stehen
Entspannen im Stehen
164
Rückenentspannungslage
(saväsana)
Auf Atmung achten etc. '�{{�..--; ·
Bein- und Bauchmuskelübung
Ein Bein heben, 10-20 Sek. halten. Muskelspannung und Dehnung spü ren. langsam senken, beim Aufsetzen spüren, wie und in welcher Reihen folge die Muskeln entspannen. Andere Seite. Anschließend 3 Mal wechselseitig mit Atmung verbinden (Einatmen, 3 Sek. lang heben, Aus atmen, 3 Sek. lang senken).
Halbe Vorwärtsbeuge Uänu-fr�äsana) 1-3 Mal, jeweils 20-60 Sek. halten. Genau spüren und nachspüren. Wichtig: Fuß oder Schienbein ent spannt halten, nicht ziehen.
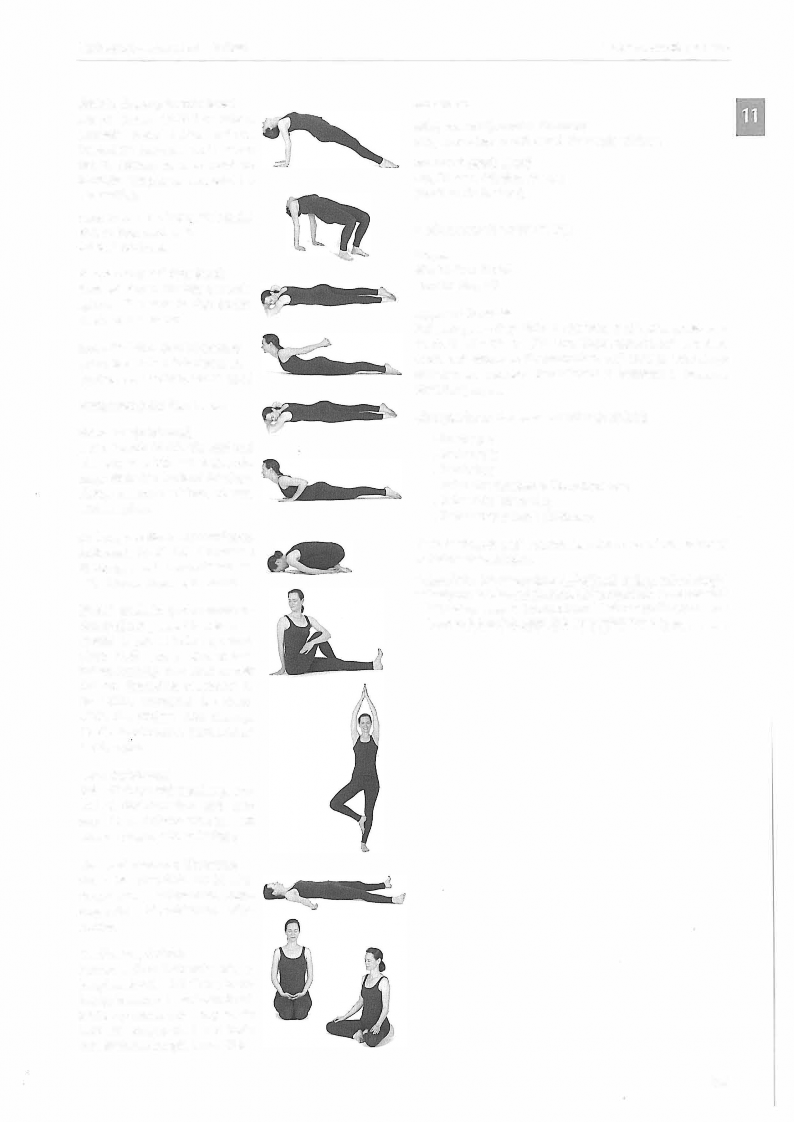
Hatha-yoga-U nterrichtstechniken
Schiefe Ebene (pürvottänäsana)
1-3 Mal jeweils 10-20 Sek. halten. Muskeln beim Halten spüren. Besonders langsam nach unten gehen, spüren, wann sich welche Muskeln entspannen und wie sich das anfühlt.
ALTERNATIVE: Tisch (catus-päda-p,tha)
Knie 90 Grad anwinkeln. 1-3 Mal 10-20 Sek.
Entspannung auf dem Bauch Bewusst atmen. Energie der Erde spüren. Sich ganz in den Boden hinein sinken lassen.
Kobra-Variation (bhujarigasana) 10-30 Sek. halten. Wiederholen. (Spüren, nachspüren, atmen usw.)
Entspannung auf dem Bauch Kobra (bhujarigösana)
2 Mal, jeweils 10-30 Sek. Kopf und Oberkörper leicht anheben. Ach tung: Nicht übertreiben! Schulter blätter zusammenziehen, oberen Rücken spüren.
Stellung des Kindes (garbhösana, bölösana). 30-60 Sek. Aufpassen: Ellenbogen nach unten hängen las sen. Schultern ganz entspannen.
Halber Drehsitz (ardha-matsyen drösana) mit gestrecktem Bein Jeweils 1 Min. Rücken gedreht, ohne nach vorne einzusinken. Ruhige Atmung. Kopf nicht zu weit drehen. Entwickelt Flexibilität in der Hüfte, entspannt das Kreuz, stärkt den Rücken, gute Massage für die Bauchorgane, harmonisiert die Energien.
Baum (vrk$cisana)
Gute Gleichgewichtsstellung. Ent wickelt Gleichgewicht und Kon zentration, Selbstvertrauen. Mit offenen Augen geht es leichter.
Tiefenentspannung (savasana) Besonders gründlich. 10-15 Min. Anspannen - entspannen. Auto suggestion. Visualisierung. Affir mation.
Meditation (dhyäna)
Aufsetzen (über Seite oder mit ge beugtem Knie). Sitzhaltung kreuz beinig, kniend oder auf dem Stuhl. 3 Mal 0r(I wiederholen (or(I ist ein Laut, der Körper, Geist und Seele zur Harmonie bringt). Kurze Stille.
YOGA V1ovA-Anfängerkurse
om om om
lokäb samastab sukhino bhavantu
Mögen alle Wesen Glück und Harmonie erfahren
0r(I säntib santib säntib
0r(I, Frieden, Frieden, Frieden (Gruß an die Meister)
-
Abschlussbesprechung
Fragen
Wie fühlt ihr Euch? Habt ihr Fragen?
Tipps und Hinweise
Auf „Das große Yoga Vidya Hatha Yoga Buch", ,,Das große illus trierte Yogabuch" und „Das Yoga Vidya Asana-Buch" hinweisen sowie auf offene Anfängerstunden. Auf etwaige Workshops aufmerksam machen. Kursteilnehmer bekommen eventuell Vergünstigungen.
Übungen für zu Hause (wenn möglich täglich):
-
Kniebeuge
-
Rückenrolle
-
Beinheben
-
halbe Vorwärtsbeuge Uanu-sTr$cisana)
-
Kobra (bhujarigasana)
-
Tiefenentspannung (saväsana)
-
-
Nach der Stunde auch mit Schülern einzeln sprechen, eventuell zu Kräutertee einladen.
Anm.: Siehe offene Yogastunde für Anfänger (11.3.1). Stunde ruhig, flüssig und konzentriert durchführen. Genügend Zeit für Abschluss besprechung lassen (mindestens 5 Min.). Lieber einige Übungen weg lassen (z. B. Baum) als gegen Ende der Yogastunde zu hetzen.
165

Hatha-yoga-U nterrichtstechni ken
Hatha-yoga 1, 2. Stunde
-
Anfangsbesprechung
Wie ging es mit dem Üben letzte Woche? Ermutigen, loben, auf etwaige Probleme eingehen. Einige werden nicht geübt haben: ist okay. Yoga hat schon Wirkungen, wenn man es ein mal pro Woche macht.
Wiederholen
Was ist hatha-yoga. Die 5 Punkte/Säulen.
-
Theorie: Körperübungen (5 Min.)
-
einfache Vorübungen für Entspannung und Bewusstheit
-
Aufwärmübung: Sonnengruß (sürya-namaskära)
-
äsanas (Stellungen)
Kurz über den Nutzen von äsanas sprechen, wie sie ausgeführt werden etc. (siehe auch Bücher wie „Das große Yoga Vidya Hatha Yoga Buch", ,,Das große illustrierte Yogabuch" und „Das Yoga Vidya Asana-Buch").
-
-
Praxis
Entspannungslage (saväsana)
Krokodilsübungen (makaräsana)
(wie in erster Stunde, evtl. zusätzlich Kreuzstreckung, s. S.160)
Nacken- und Schulterübungen im Stehen
(wie in erster Stunde, eventuell zusätzlich Rumpfbeuge und Rumpfdrehen, s. S.160)
Sonnengruß (sürya-namaskära)
Aufwärmübung. Regt Kreislauf an, weckt morgens auf, bringt Energien zum Fließen, stärkt und dehnt alle Muskeln des Körpers.
Erst 1 Mal vormachen, dann 2 Runden im Rhythmus klar ansa gen, hierbei noch keine Fehler korrigieren. Gefühl für bewuss te, ruhige, flüssige Bewegung entwickeln lassen. Dabei den Sonnengruß mitmachen. Dann 2 langsame Runden, auf Einzel heiten hinweisen. Dann nochmals 2 flüssige Runden.
Sonnengruß (sürya-namaskära) 6-8 Runden
Zwischenentspannung (saväsana)
Bein- und Bauchmuskelübung
(wie in erster Stunde)
Zwischenentspannung (saväsana)
Halbe Vorwärtsbeuge Uänu-s,r�äsana)
(wie in erster Stunde)
166
YOGA VIDYA-Anfängerkurse
.l.A�' "�
..
Ganze Vorwärtsbeuge (pascimottänäsana) &
Aufpassen: Schultern entspannt, Nacken
locker. Dehnung in den Beinen, nicht im Kreuz. Nicht ziehen, sondern passiv ent- spannen. Eventuell mit Yogagurt um Füße.
Schiefe Ebene (pürvottänäsana)
Bauchentspannungslage (o. Abb.)
Kobra-Variation (bhujarigäsana) Mit Händen hinterm Kopf oder wie in der 1 Stunde (s. S. 165).
Entspannung auf dem Bauch
(wie in erster Stunde)
Kobra (bhujarigäsana)
(wie in erster Stunde)
Halbe Heuschrecke
(ardha-salabhäsana)
Stärkt Rücken- und Gesäßmuskeln. Anschließend k ann sich Kreuz sehr gut entspannen. Erstes Mal sehr langsam, 10-30 Sek. halten. Dabei Bein am Boden ganz entspannt las sen. Muskeln spüren. Beim Senken spüren, wann welcher Muskel ent- spannt. Wechseln. Dann 2-3 Mal im Rhythmus der Atmung heben und senken.
Stellung des Kindes
(garbhäsana, bäläsana)
Halber Drehsitz (ardha-matsyen dräsana) mit gestrecktem Bein (wie in erster Stunde)
Dreieck (tri-kanäsana)
Dehnt die Seite, entspannt Hüften. Entlastet Wirbelsäule. Gut für in nere Organe. Seitlich beugen, ohne zu drehen. Nicht überdehnen! Mit Hand abstützen soweit wie nötig. Dehnung sollte angenehm sein.
Tiefenentspannung (saväsana)
Meditation (dhyäna)
Om {3 Mal), kurze Stille, Gebet/mantra, orr säntih (3 Mal), Gruß an die Meister.
-
Abschlussbesprechung
Fragen/Hinweise
Wie ging es in der Stunde?
Besondere Erfahrungen oder Probleme?
Hinweisen auf: ,,Das große Yoga Vidya Hatha Yoga Buch", ,,Das große illustrierte Yogabuch" und „Das Yoga Vidya Asana-Buch" etc. sowie auf offene Stunden und besondere Workshops.
Übungen für zu Hause
Krokodilsübungen, Nackenübungen, Beinheben, Vorwärts beuge, Kobra (bhujarigäsana), Tiefenentspannung (saväsana) oder alles, was gemacht wurde.
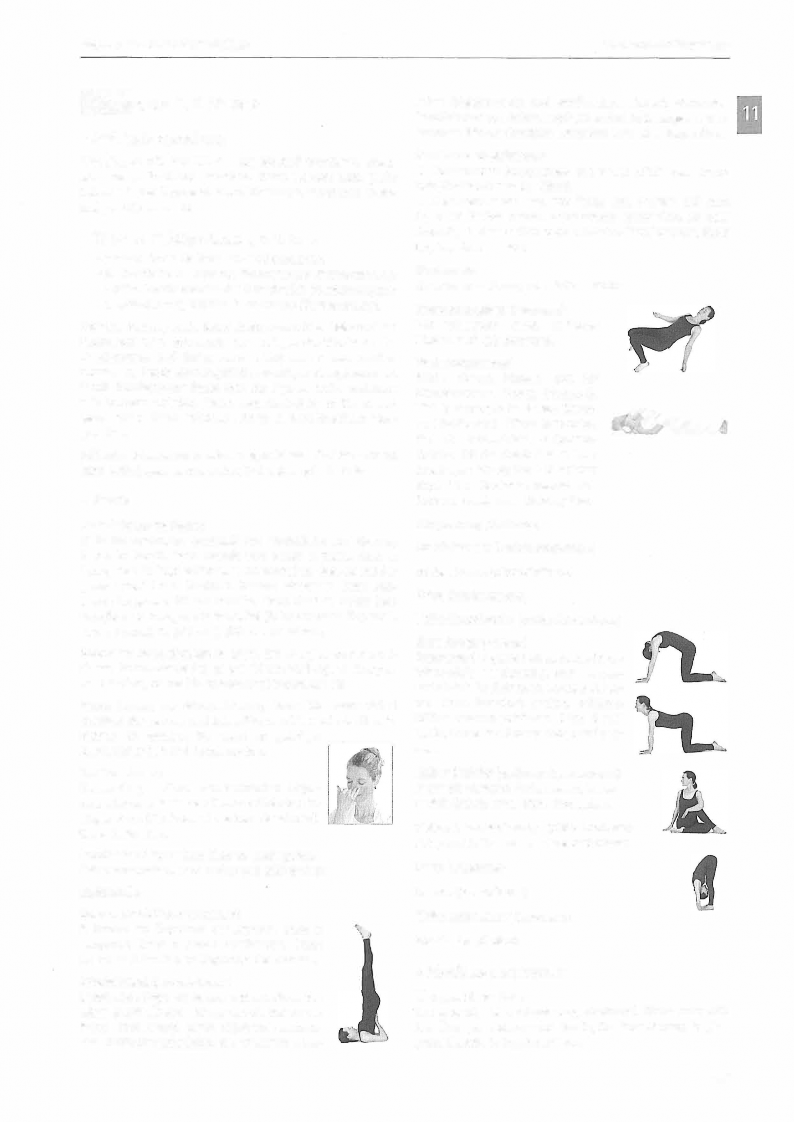
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
Hatha-yoga 1, 3. Stunde
-
Anfangsbesprechung
Wie ging es mit dem Üben letzte Woche? Ermutigen, loben, auf etwaige Probleme eingehen. Einige werden nicht geübt haben: Ist okay. Yoga zeigt schon Wirkungen, wenn man es ein mal pro Woche macht.
-
Theorie: Richtige Atmung (s-10 Min.)
-
Warum durch die Nase ein- und ausatmen.
-
Bestandteile der Atmung: Bauchatmung (Primäratmung; erkläre Funktionsweise des Zwerchfells), Brustatmung (Se kundäratmung), Schlüsselbeinatmung (Tertiäratmung).
Normale Atmung sollte Bauchatmung sein: Man bekommt am leichtesten Luft, notwendig für richtiges Funktionieren der Bauchorgane, und damit venöses Blut zum Herzen zurück kommt. Im Bauch Sonnengeflecht, wichtiges Energiezentrum. Durch Bauchatmung findet man zur eigenen Mitte und kann sich bewusst aufladen. Prär:ia (Lebensenergie) im Bauch auf
YOGA V1ovA-Anfängerkurse
sches Gleichgewicht und Stoffwechsel steuert. Verbessert Durchblutung von Gehirn, Kopfhaut und Gesicht. langsam hoch kommen. Rücken abstützen. Nicht forcieren! Ca. 1 Min. halten.
Schulterstand-Variationen
-
UNTERSTÜTZTER SCHULTERSTAND mit Kissen unter dem Kreuz bein/Gesäß oder an der Wand.
-
SCHULTERSTAND MIT GEBEUGTEN KNIEN: Knie beugen, auf Stirn legen. 10-20 Sek. halten. Beine wieder ausstrecken. Ein paar Atemzüge halten und langsam aus der Stellung kommen, dabei Kopf am Boden lassen.
Rückenrolle
Nach vorne - hinten, nach links - rechts.
Entspannungslage (saväsana)
Mit gebeugten Knien. Entlastet Rücken nach Schulterstand.
Fisch (matsyäsana)
Stärkt oberen Rücken. Gut für Körperhaltung. Dehnt Brustkorb.
Löst Spannungen im Brust-, Bauch
gespeichert, durch richtiges Atmen in harmonischem Fluss gehalten.
Schlechte Atemgewohnheiten wegen Stress. Richtige Atmung kann auch gegen Lampenfieber, Prüfungsangst etc. helfen.
-
Praxis
-
Aufladeübung im Stehen
Tiefe Bauchatmung, eventuell mit Vorstellung von Wärme, Sonne im Bauch. Dann Energie vom Bauch in Beine, dann in Arme, dann in Kopf schicken. Dann vorstellen, dass du mit der ganzen Haut beim Einatmen Energie einatmest, beim Aus atmen im ganzen Körper verteilst. Dann denken, wohin bzw. wem/was du Energie schicken willst (in bestimmtes Körperteil, einem Freund, Projekt etc.). (Wieder hinsetzen.)
Besondere Atemübungen im yoga, um Energien zu harmoni sieren, Energieblockaden zu beseitigen, verborgene Energien zu erwecken, cakras (Energiezentren) anzuregen etc.
Heute kommt die Wechselatmung hinzu. Sie harmonisiert Energien der rechten und linken Körperhälfte sowie der Hemis phären im Gehirn. Sie führt zu geistiger �---� Ausgeglichenheit und Konzentration.
Wechselatmung
Handhaltung erklären, kurz vormachen. Rhyth mus erläutern: Fortgeschrittene 4:16:8 etc.; An fänger 4:4:8 (Einatmen : Anhalten : Ausatmen). Ca. 8-10 Runden.
Anschließend kurz sitzen bleiben. Nachspüren. Beine ausstrecken, nach rechts und links drehen.
Rückenrolle
Sonnengruß (sDrya-namaskära)
2 Runden im Rhythmus der Atmung. Dann 2 langsame Runden genau korrigieren. Dann nochmals 2 Runden im Rhythmus der Atmung.
Schulterstand (sarvängäsana)
Dehnt und entspannt Nacken und Schultern. Ve nöses Blut fließt zum Herzen zurück. Gut für die Beine. Vorbeugend gegen Kopfweh. Harmoni siert Schilddrüsenfunktion, die wiederum seeli-
und Kehlbereich. Öffnet Herz-cokro. �
Gut für Schilddrüse. Aufpassen!
Größter Teil des Gewichtes auf den Ellenbogen. Wenig Gewicht auf dem Kopf. Wer Nackenprobleme hat:
Kopf nur wenig nach hinten geben.
Entspannung (saväsana)
Vorwär tsbeuge (pascimottänäsana)
Schiefe Ebene (pDrvottänäsana)
Kobra (bhujangäsana)
Halbe Heuschrecke (ardha-sa/abhäsana)
Katze (märjäry-äsana)
Entspannt den ganzen Rücken. Macht die Wirbelsäule geschmeidig. Erst Lenden wirbelsäule hochdrücken. 10-20 Sek. hal ten. Dann Brustkorb senken, Schulter blätter zusammendrücken. Dann 6 Mal im Rhythmus der Atmung heben und sen ken.
Halber Drehsitz (ardha-matsyendräsana) Jeden die Variation finden lassen, in der er sich drehen kann, ohne einzusinken.
Stehende Vorwärtsbeuge (päda-hastäsana)
Entspannt halten lassen, ohne zu forcieren.
Baum (vrk?äsana)
Dreieck (tri-konäsana) Tiefenentspannung (saväsana) Meditation (dhyäna)
-
Abschlussbesprechung
Übungen für zu Hause
Sonnengruß, Tiefenentspannung (foväsana). Wenn mehr Zeit: Alle Übungen machen und das Kapitel über Atmung in „Das große illustrierte Yogabuch" lesen.
167
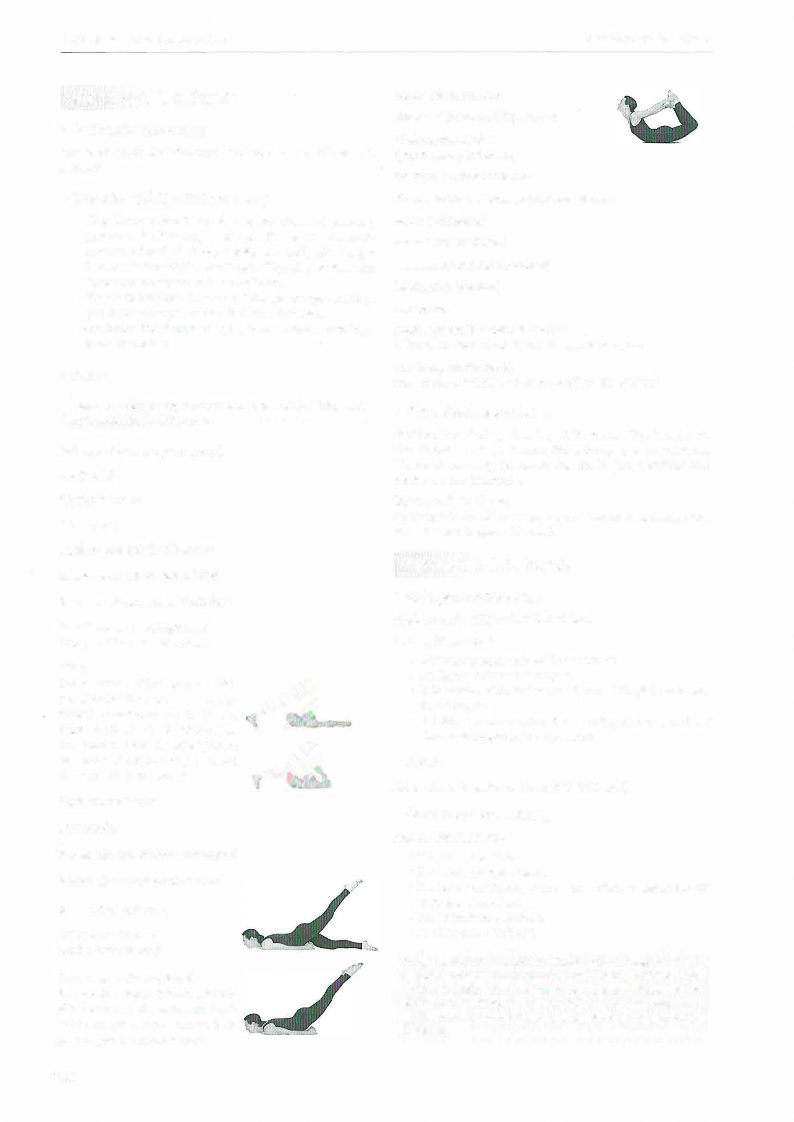
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
Hatha-yoga 1, 4. Stunde
• Anfangsbesprechung
Hat yaga schon Auswirkungen auf euer Leben, Fühlen etc. gehabt?
• Theorie: Richtige Entspannung
-
Über Notwendigkeit und Nutzen der Tiefenentspannung sprechen. Schüler fragen, wie gut für sie die Tiefenent spannung funktioniert. Auf etwaige Schwierigkeiten einge hen. Auf Notwendigkeit der Regelmäßigkeit hinweisen etc.
-
Kurzentspannungstechniken erwähnen.
-
Zur Vertiefung des Themas auf Entspannungsworkshops und Entspannungskurse im Zentrum hinweisen.
-
Auf Kapitel über Entspannung in „Das große illustrierte Yoga buch" hinweisen.
• Praxis
Anm.: Die Entspannung zwischen den osanas wird ab hier nicht mehr jedesmal mit aufgeführt.
Anfangsentspannung (saväsana)
am (3 Mal) Wechselatmung Rückenrolle
Nacken- und Schulterübungen Sonnengruß (sürya-namaskära) Bein- und Bauchmuskelübung(en)
Schulterstand (sarvörigäsana)
bzw. gestützter Schulterstand
Pflug
Dehnt ganze Wirbelsäule und Bei- ne. Massiert Bauchorgane. Harmo-
YOGA V1DYA-Anfängerkurse
Bogen (dhanuräsana)
Eventuell Katze (märjärg-äsana)
Stellung des Kindes
(garbhösana, bä/äsana)
Drehsitz (matsyendrösana)
Stehende Vorwärtsbeuge (päda-hastäsana)
Baum (vrk$äsana)
Dreieck (tri-konäsana) Tiefenentspannung (saväsana) Meditation (dhyäna)
am am am
/akäb samastäb sukhina bhavantu
Mögen alle Wesen Glück und Harmonie erfahren
arr, säntib säntib säntib
arr,, Frieden, Frieden, Frieden, {Gruß an die Meister)
-
Abschlussbesprechung
Auf YOGA VIDYA-Anfängerkurs Yoga 2 hinweisen. Yoga 1 und 2 bil den Einheit. Im Yoga 2 neue Atemübungen, weiterführende Tiefenentspannung, Ausbauen der Stellungen, Vertiefen und Verfeinern der Erfahrung.
Übungen für zu Hause
Sonnengruß, Vorwärtsbeuge, Kobra, Tiefenentspannung. Oder alles, was heute gemacht wurde.
Hatha-yoga 1, 5. Stunde
-
Anfangsbesprechung
Infoblatt zum Anfängerkurs 2 verteilen.
Fragen, Hinweise etc.
-
Wer macht weiter mit Anfängerkurs 2?
-
Bei Zusagen Namen eintragen.
-
Falls jemand nicht weitermacht, unaufdringlich nach dem
-
.
nisiert Energiezentren in Bauch, ·
Brust und Kehle. Ca. 20-30 Sek. hal- �ten lassen. Wer Schwierigkeiten
i::'.J _
Grund fragen.
-
Bei Zeitproblemen auf spätere Anfängerkurse 2 und auf die offene Yogastunden hinweisen.
hat, beugt die Knie und gibt sie auf � die Stirn. Nicht forcieren! < • ,
Fisch (matsyäsana)
Rückenrolle
Vorwärtsbeuge (pascimottänäsana)
Schiefe Ebene (pürvattänösana)
Kobra (bhujarigäsana)
Halbe Heuschrecke
(ardha-sa/abhäsana)
Heuschrecke (sa/abhäsana)
Beide Beine. Stärkt Rücken- und Ge säßmuskulatur. Anschließend kann sich Kreuz gut entspannen. Vorbeu gend gegen Kreuzschmerzen.
168
-
-
-
-
Praxis
Siehe offene Yogastunde für Anfänger (11.3.1)
-
Abschlussbesprechung
Fragen, Hinweise etc.
-
Wie hat es gefallen?
-
Nach Anregungen fragen.
-
Nochmals auf Anfängerkurs 2 und offene Yogastunden für Anfänger hinweisen.
-
Für Teilnahme bedanken.
-
Zu Kräutertee einladen.
Anm.: Persönlicher Kontakt zum Yogalehrer/ zur Yogalehrerin ist gerade bei Anfängern sehr wichtig. Es ist hilfreich, 15 Min. vor der Stunde für Schüler zur Verfügung zu stehen und anschließend mit ihnen noch zu sprechen. Bei Gesprächen sind Yogathemen am geeignetsten. Aktiv auf Schüler zugehen, sie sind meist sehr dank bar dafür.
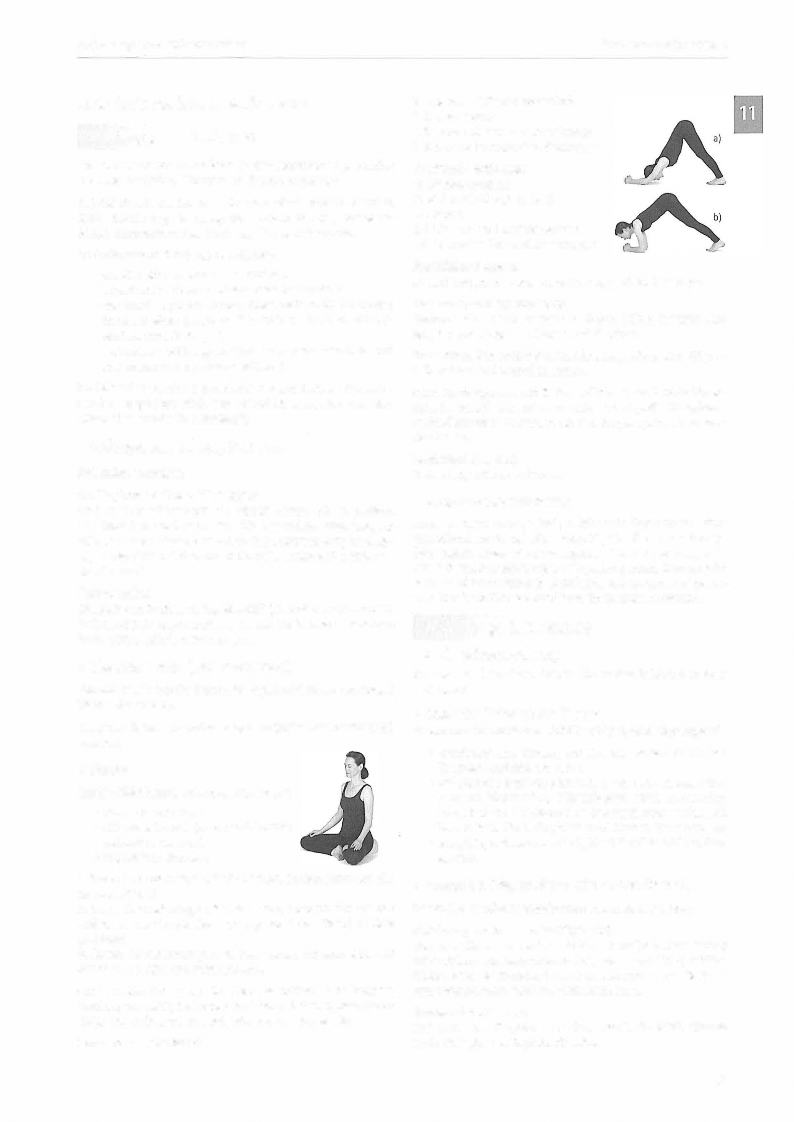
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
-
-
Anfängerkurs 2, Aufbaukurs Hatha-yoga 2, 1. Stunde
-
-
Die Anfangsbesprechung kann in den spärteren Yogastunden auch mal wegfallen. Übungen an Gruppe anpassen!
In jeder Stunde des Kurses sollte mindestens gemacht werden: eine Atemübung, Sonnengruß, Umkehrstellung, Vorwärts beuge, Rückwärtsbeuge, Drehung, Tiefenentspannung.
Im Anfängerkurs 2 geht es u. a. darum:
, die Korrekturen genauer zu machen.
, Yogastunden etwas anstrengender zu gestalten.
, den Schülern/Schülerinnen etwas mehr in die Stellungen hineinzuhelfen (ohne zu übertreiben, denn im Grunde sind sie noch Anfänger).
, auf subtilereWirkungen aufmerksam zu machen (z. B. auch mal cakras und mantras erwähnen).
Im Folgenden werden nur die Übungen erwähnt, an denen be sonders gea,rbeitet wird. Der Ablauf ist ansonsten wie eine offene Yogastunde für Mittelstufe.
-
Anfangsbesprechung (5-15 Min.)
Sich selbst vorstellen
Schüler/innen sich vorstellen lassen
Welche Yogaerfahrungen sie bisher hatten, ob körperliche Beschwerden vorliegen, was für besondere Erwartungen/ Wünsche sie an diesenKurs haben (besonders wichtig für dieje nigen, die nicht bei dem direkt davorliegenden Anfängerkurs 1 dabei waren).
Kurs vorstellen
Erlernen von Kopfstand, kapa/a-bhati (Schnellatmung), andere Tiefenentspannungstechniken, kleine Variationen, genauere Korrekturen, subtilere Wirkungen.
-
Theorie: Prär:,a (Lebensenergie)
Siehe dazu „Das große illustrierte Yogabuch", Kap. 8 von Swami Vishnu-devananda.
Eventuell Kirlianfotografien zeigen und/oder den Armversuch machen.
-
Praxis
Kapala-bhäti (wörtl. ,,Glanz des Schädels")
, Einmal vormachen.
, Nutzen erläutern (prar:,a und Sonnen geflecht erwähnen).
, Insgesamt 3 Runden.
-
RUNDE: 15 Ausatmungen, 20 Sek. halten, Konzentration auf das Sonnengeflecht.
-
RUNDE: 20 Ausatmungen, 30 Sek. halten, Konzentration auf das Aufsteigen der Energie des Sonnengeflechts von Bauch zu Herz und Kopf.
-
RUNDE: 25 Ausatmungen, 40 Sek. halten, Konzentration auf Strahlen aus Stirn und Schädeldecke.
Auf korrekte Bewegung des Bauches achten. Sehr langsam machen, nur mäßig fest ausatmen lassen. Betonen, dass nur so lange angehalten werden soll, wie es ganz bequem ist.
Entspannung (savasana)
YOGA V1DYA-Anfängerkurse
Sonnengruß (siJrya-namaskara)
2 Runden normal
2 Runden mit genauen Korrekturen 2-6 Runden im normalen Rhythmus
Kopfstand-Vorübungen
-
Ellenbogenstand
(2 Mal je 30-40 Sek. halten)
-
Delphin
(12 Mal vor- und zurückbewegen mit bewusster Ein- und Ausatmung)
Anschließend äsanas
Je nach Zeit mindestens Vorwärtsbeuge, Rückwärtsbeuge.
Tiefenentspannung (savasana)
VARIATION: Körperteile anspannen, 5 Sek. halten, langsam sen ken, Entspannung der Muskeln dabei spüren.
Dann durch den Körper gehen, ohne Suggestion, aber Körper teile spüren und vorstellen lassen.
Dann Kontaktpunkte mit Boden spüren. In alle Punkte hinein atmen. Gefühl der Schwere oder Leichtigkeit. Energiefeld rechts/links/oben spüren. In alle Richtungen spüren, weit wer den lassen.
Meditation (dhyana)
2 Min. lang mit am im Herzen
-
Abschlussbesprechung
Übungen für zu Hause, 1 Mal pro Woche im Yogazentrum schon gut. Schnellere Fortschritte, wenn tägliche Übung. Auch mög lich: Täglich etwas wie Sonnengruß, Tiefenentspannung o. ä. plus 2-3 Mal gründlicher (siehe Yogaübungsplan). Können jetzt auch an offenen Stunden Mittelstufe teilnehmen. Auf beson dere Seminare /Workshops/Kurse im Zentrum hinweisen.
Hatha-yoga 2, 2. Stunde
-
Anfangsbesprechung
Wie war die Übung letzte Woche, besondere Erfahrungen oder Probleme?
-
Theorie: Richtige Ernährung
Thema nur kurz andeuten. Schüler nicht vor den Kopf stoßen!
, Ernährung und Wirkung auf körperliches Wohlbefinden, Energien, Gefühlswelt, Geist.
, Auf yogische Ernährung hinweisen, wie beispielsweise Voll korngetreideprodukte, Hülsenfrüchte, Tofu, Gemüse/Sa late, Obst und Milchprodukte (eventuell ganz weglassen).
, Kein Fleisch, Fisch, Eier, Weißmehl, Zucker, Konserven etc.
-
Bringt körperlicheGesundheit, Vitalität, geistige Stärke, Sen sibilität.
-
-
Praxis: im Allgemeinen wie offene Stunde
Besonders beachten: kapä/a-bhäti nochmals korrigieren Einführung des Kopfstandes (sir�asana)
Genau erklären. Vormachen. Helfen. Ermutigen. Anmerkung: Wer größere Nackenprobleme hat, sollte Arzt/Chiropraktiker fragen, bevor er Kopfstand macht und ansonsten nur die Kopf stand-Vorübungen machen. ALTERNATIVE: Hund.
Kopfstand-Vorübungen
Erst nach dem Kopfstand machen, damit die Schüler/innen noch Kraft (für den Kopfstand) haben.
169
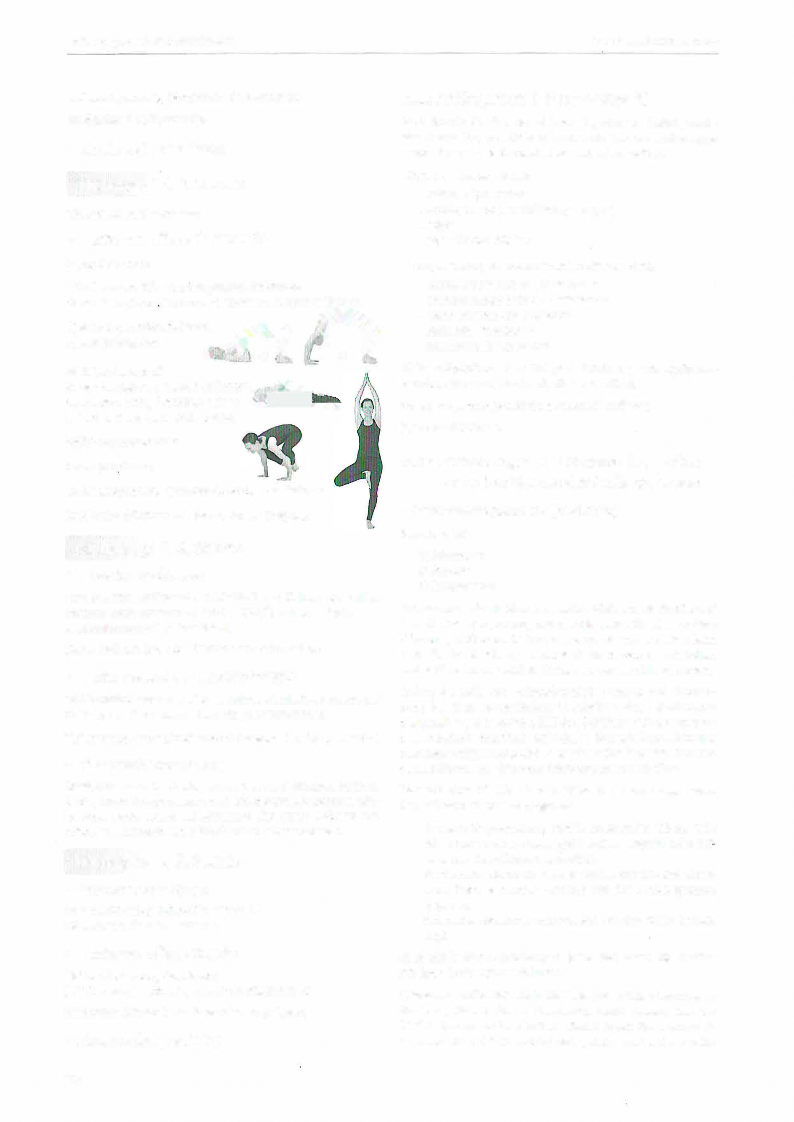
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
Tiefenentspannung (saväsana; wie Vorstunde)
Meditation (wie Vorstunde)
-
Abschlussbesprechung Hatha-yoga 2, 3. Stunde
Theorie diesmal weglassen
-
Praxis: wie offene Yogastunde
Besonderheiten:
Schulterstand, Pflug (saivärigäsana, ha/äsana)
�:e:��,;:�;;;�;;;::;::::�;��t' 1�)
Fisch (matsyäsana)
, �
Genau korrigieren, Nutzen erläutern. .,
VARIATIONEN: Mit gekreuzten Beinen, ��-,.._-""'--""-"' kniend und aus dem Lotos (Abb.).
Krähe (käkäsana) oder
Baum (vrksäsana)
Tiefenentspannung (saväsana): Autogenes Training
Meditation (dhyäna) mit Kerzenstarren (trätaka)
Hatha-yoga 2, 4. Stunde
-
Theorie: Meditation
Kurz den Sinn und Zweck von Meditation erläutern, auf beiden Ebenen: Entspannung und Spiritualität/Überbewusstsein.
Meditationstechnik deiner Wahl.
(Kann auch am Ende der Stunde gemacht werden)
-
Praxis: besonders Vorwärtsbeugen
Pascimottänäsana mind. 3 Min. halten. Meditative Aspekte der Stellung erspüren lassen. Dann ein paar Variationen.
Tiefenentspannung (saväsana): Autogenes Training (s. S. 109f.)
-
Abschlussbesprechung
Erwähnen, dass der Anfängerkurs 3 in zwei Wochen beginnt. Schön, wenn Gruppe zusammenbleiben würde. Ansonsten offe ne Yogastunden. Auch auf Jahresabo hinweisen: Unbegrenzte offene Yogastunden, ein 5-Wochenkurs eingeschlossen.
Hatha-yoga 2, 5. Stunde
-
Anfangsbesprechung
Wer macht weiter mit Anfängerkurs 27 Bei Zusagen, Namen eintragen.
-
Praxis: wie offene Stunde
Tiefenentspannung (saväsana)
(mit Autosuggestion etc., wie im Anfängerkurs 1)
Meditation (dhyäna) mit Kerzenstarren (trätaka)
-
Abschlussbesprechung
170
YOGA V1DYA-Anfängerkurse
-
-
-
Anfängerkurs 3 (Hatha-yoga 3)
Jede Stunde ähnlich der offenen Yogastunde. Dabei jeweils eine äsana-Gruppe mit Variationen mehr betonen. Mit Gruppe absprechen, ob sie theoretischen Teil haben wollen.
Mögliche Themen wären:
-
prä(la, när;/Ts, cakras
-
-
-
-
a?täriga-yoga {,,achtgliedriger yoga")
-
kriyäs
-
yoga für den Rücken
Übungsgruppen, die betont werden können, sind:
-
Rückwärtsbeugen mit Variationen
-
Drehsitz länger halten + Variationen
-
mehr arbeiten am Kopfstand
-
stehende Variationen
-
Stellungen länger halten
Mehr prä(läyäma. Zum Beispiel Einführung von ur;fr;/Tyäna bandha, agni-sara, bhrämarT, sTta/T und sTtkärT.
Tiefenentspannungstechniken eventuell variieren:- Kurze Meditationen.
-
-
-
Anmerkungen zu ausgewählten Teilen der ersten Stunde des Anfängerkurses
-
-
-
-
Anfangsentspannung (savasana)
Betonung auf:
-
-
-
-
Stimmung
-
Atmung
-
Entspannung
-
STIMMUNG - für die Stunde schaffen. Während die Schüler auf dem Rücken entspannen, soll der/die Lehrer/in eine positive Stimmung aufbauen. Erkläre, was yoga ist, wie er helfen kann usw. Hilf den Schülern, Vertrauen in die äsanas zu entwickeln und erkläre ihnen, welchen Nutzen sie daraus ziehen können.
Erkläre die Rolle von Aufmerksamkeit, Atmung und Entspan nung bei allen Yogapraktiken. Wiederhole diese Erklärungen mehrmals in jeder Stunde. Hilf den Schülern, sich zu entspan nen, indem du mehrmals auf richtige Körperhaltung, Atmung, bewusste Entspannung und Autosuggestion hinweist. Benutze deine Stimme, um ihnen zur Entspannung zu verhelfen.
Dies soll etwa 10 Min. dauern. Diese Grundanleitungen wer den während dieser Zeit gegeben:
-
Korrekte Körperposition. Fersen auseinander geben, Füße fallen nach außen, Augen geschlossen, Lippen leicht auf einander, Handflächen nach oben.
-
Geräuschlos durch die Nase 8 Runden tief ein- und ausat men. Nach 8 Runden Atmung mit der Autosuggestion beginnen.
-
Entspanne den Körper systematisch von den Füßen bis zum Kopf.
Wiederhole diese Anweisungen jedes Mal, wenn die Schüler mit ihrer Entspannung anfangen.
-
-
ATMUNG - sollte tief, durch die Nase und mit dem Bauch sein. Einatmen, Bauch hinaus. Ausatmen, Bauch hinein. Lass die Schüler ihre rechte Hand auf den Bauch legen. Sollte ein Schü ler immer noch nicht korrekt atmen, gehe zu ihm hin; lege deine
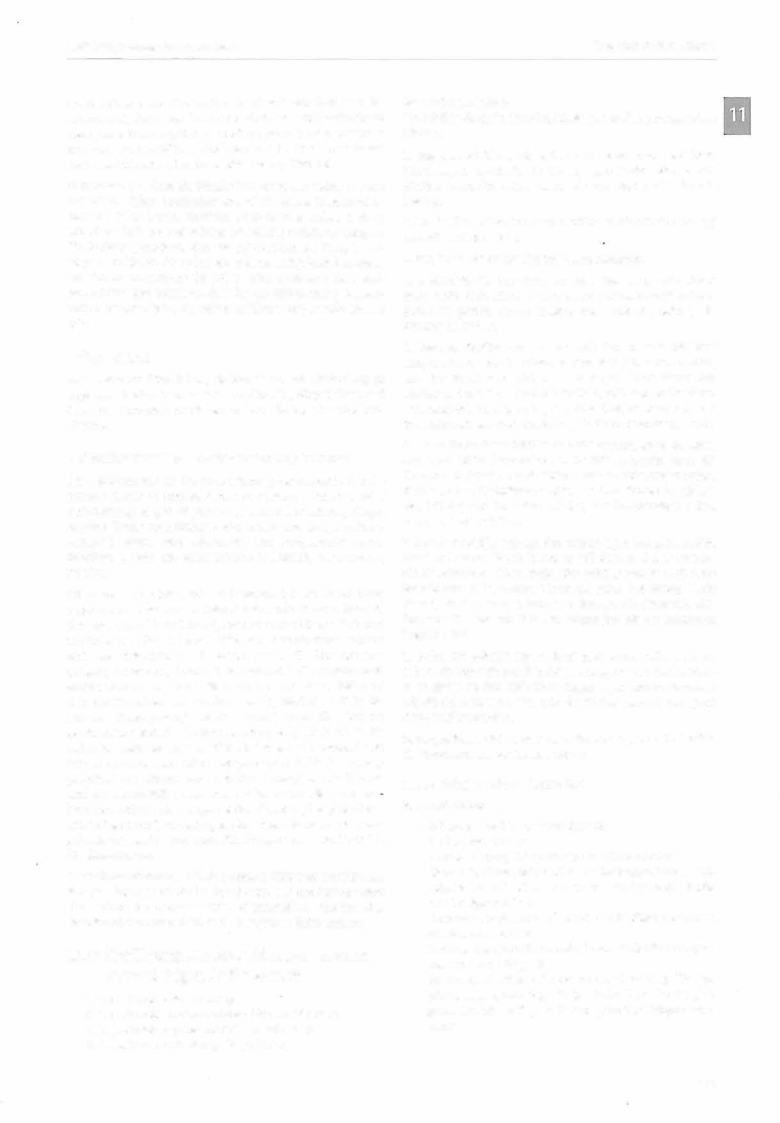
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
Hand auf seine und übe sanften Druck auf seine Hand aus, bis er ausatmet; dann sage ihm, er soll einatmen, und lass im Druck nach (deine Hand liegt immer noch auf seiner); dann ausatmen und den Druck erhöhen; einatmen und im Druck nachlassen usw. Dies fortführen, bis der Schüler es begriffen hat.
-
ENTSPANNUNG - Lass die Schüler ihre Arme und Beine hin und her rollen. Hüften hochheben und fallen lassen. Brust hochhe ben und fallen lassen. Kopf von Seite zu Seite rollen. Erkläre, wie Körperhaltung und geistige Einstellung zusammenhängen. Die Schüler ermutigen, sich wie Schwämme, die Energie auf saugen, zu fühlen. Sie sollen die Erdanziehungskraft benutzen, um sich zu entspannen. Sie sollen keine Spannung mehr spü ren. Erkläre den Schülern, dass für die Entspannung Konzen tration notwendig ist. Sie sollen auf ihren Körper aufmerksam sein.
-
Om. ,· Gebet
Habe keine unnötige Scheu, die Yogastunde mit dreimal orr, zu beginnen. Erkläre kurz das Warum: Orr, hilft, Körper, Geist und Seele zur Harmonie zu führen und auf die Yogastunde einzu stimmen
-
Bauchatmung (vor der Wechselatmung im Sitzen)
Die Bauchatmung ist die Grundatmung, darum auch Primär atmung genannnt. Andere Namen sind Zwerchfellatmung oder tiefe Atmung. Es gibt im yoga zwar auch die vollständige Yoga atmung (unter Einbeziehung von Brust- und Lungenspitzen atmung), diese wird allerdings erst fortgeschritteneren Schülern, welche die Bauchatmung vollständig beherrschen, gelehrt.
Führe vor und erkläre, wie und warum sich der Bauch beim Einatmen nach außen und beim Ausatmen nach innen bewegt. Das Zwerchfell ist ein Muskel, der durch den Körper läuft und die Brust vom Bauch trennt. Während man einatmet, schiebt sich das Zwerchfell nach unten gegen die Bauchorgane (Magen, Leber etc.). Dadurch bewegen sich die Organe nach außen. Dies massiert auch die Leber und regt sie an. Während sich das Zwerchfell nach unten bewegt, wird die Luft in die Lungen hineingesaugt. Achte darauf, dass die Atmung geräuschlos verläuft. Die Bauchatmung bringt Luft bis in die untersten Teile der Lungen, füllt die Lungen und versorgt den Körper mit einer maximalen Menge Sauerstoff. Die Ausatmung geschieht von alleine; das Zwerchfell bewegt sich nach oben und der Bauch fällt zusammen; dadurch wird die ganze ver brauchte Luft aus den Lungen entfernt (siehe „Das große illus trierte Yogabuch" ). Abbildungen der Lungen kann man von ver schiedenen Quellen beziehen. Abbildungen sind unentbehrlich für diese Stunde.
Die tiefe Bauchatmung hilft dem ganzen Körper zu entspannen, lädt das Sonnengeflecht im Bauchraum auf und harmonisiert
�en prär,,a, die Lebensenergie. Gleichmäßige, rhythmische, tiefe Bauchatmung verhilft auch zu geistiger Entspannung.
-
-
-
Einführung von Atemübungen in einem zehnwöchigen Anfängerkurs
1. Yogastunde: Bauchatmung
3. Yogastunde: anuloma-viloma (Wechselatmung)
6. Yogastunde: kapäla-bhäti (Schnellatmung)
8. Yogastunde: vollständige Yogaatmung
YOGA V10YA-Anfängerkurse
Bauchatmung lehren
Die Schüler sitzen in einer kreuzbeinigen Stellung mit geradem Rücken.
-
Sag den Schülern, sie sollen ihre rechte Hand auf ihren Bauch legen, damit sie die Bewegungen fühlen können und der/die Lehrer/in sehen kann, ob der Bauch sich korrekt bewegt.
-
Die Schüler sollen ihre Augen schließen (damit sie nicht auf ihre Mitschüler achten).
-
Sag ihnen, sie sollen einatmen und ausatmen.
-
Beobachte sie, um sicher zu sein, dass sie gerade sitzen; wenn nicht, gehe hinter sie und ziehe sanft an ihren Schultern, damit sie gerade sitzen. Erkläre, wie schlechte Haltung die Atmung behindert.
-
Manche Schüler werden nur mit dem oberen Teil ihrer Lungen atmen. Ihre Schultern werden sich heben und senken, aber ihr Bauch wird sich nicht bewegen. Gehe hinter den Schüler und drücke auf seine Schultern, während du ihn daran erinnerst, wie wichtig es ist, das Zwerchfell zu benutzen. Lass ihn mehrmals ein- und ausatmen, bis die Bauchatmung klappt.
-
Lasse die anderen Schüler es nicht merken, wenn du einen aus ihrer Mitte herausnimmst. Der/die Lehrer/in kann die Stunde unterbrechen und erklären, wie sie nicht atmen sollen. Bitte um einen Freiwilligen und sage gleich: ,,Kannst du mir hel fen, bitte?", und hole den Schüler, der Schwierigkeiten hat, ohne ihn bloßzustellen.
-
Lass den Schüler sich auf den Rücken legen und seine rechte Hand auf seinen Bauch legen; er soll dann in dieser Position die Bauchatmung üben. Sollte der Schüler immer noch nicht korrekt atmen, lege deine Hand auf seine und drücke leicht darauf, bis er ausatmet; dann sage ihm, er solle einatmen, den Druck nachlassen etc. Fahre so weiter fort, bis der Schüler es begriffen hat.
-
Sollte ein Schüler seinen Kopf nach unten halten, um zu sehen, ob sich sein Bauch bewegt, schlage vor, zu Hause könn te er einige Bücher auf seinen Bauch legen und beobachten, wie sie sich bewegen. Wie man die Bücher benutzt, kann jetzt demonstriert werden.
-
Vergewissere dich, bevor du weitermachst, dass die Schüler die Bauchatmung verstanden haben.
-
-
Allgemeine Hinweise
-
-
(vgl. s. 159, 11.24)
-
Sei immer positiv und ermutigend!
-
Erkläre, vereinfache.
, Betone Atmung, Entspannung und Konzentration.
, Bleib nicht sitzen, während du die Stellungen lehrst. laufe zwischen den Schülern herum und korrigiere sie. Suche und korrigiere Fehler.
, Der/die Lehrer/in sollte nicht mit den Schülern zusammen die äsanas ausführen.
-
Stelle dich auf jede Stunde ein! Lasse die Schüler entspan nen, wenn es nötig ist!
-
Mache die Schüler aufmerksam auf: YOGA V1ovA-Übungs pläne, ,,Das große Yoga Vidya Hatha Yoga Buch", ,,Das große illustrierte Yogabuch" und „Das Yoga Vidya Asana Buch".
171

Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
-
-
-
Krankenkassen/ZPP-Anerkennung von hatha-yoga-Kursen als Prävention
Die ZPP, Zentrale Prüfstelle Prävention, wurde vom Spitzenver band der Krankenkassen (GKV) installiert; mittlerweile arbeiten fast alle Krankenkassen mit der ZPP zusammen. Das hat den Vorteil, dass du dich als Yogalehrer/in bzw. Kursanbieter/in ein malig, kostenfrei und zentral für alle beteiligten Krankenkassen bewerben und registrieren lassen kannst. Allerdings ist das Registrierungsverfahren relativ aufwändig.
Nach dem Stand vom April 2017 (kann sich laufend ändern, da das Ganze noch im Fluss ist) gelten folgende Voraussetzungen für deine Anerkennung als Kursanbieter/in für Präventions maßnahmen:
-
abgeschlossene zweijährige Yogalehrerausbildung mit mind. 500 Unterrichtseinheiten
-
abgeschlossenes Studium/Berufsabschluss
-
-
-
, Nachweis von 200 Stunden Unterrichtspraxis, wenn dein Berufsabschluss nicht in einem Gesundheits- oder Sozial bereich liegt
, Einreichen eines Stundenbildes, welches den Anforderun gen der Krankenkassen/ZPP entspricht: Nach momenta nem Stand (1.4.2017) entspricht das Stundenbild in etwa dem YOGA VIDYA-Anfängerkurs 1 und 2, wobei der Kopf stand ersetzt wird durch den Hund und der Schulterstand durch den kissengestützten Schulterstand.
Als Mitglied unseres Yogalehrer/innen-Berufsverbands bekommst du ein komplettes Musterstundenbild für einen Präventions-Hatha-Yoga-Kurs sowie Unterstützung und Hilfestellung für die Registrierung/Bewerbung bei der ZPP (berufsverband@yoga-vidya.de).
11.s Wirkungen der Yogaübungen
(Anm.: Die körperlichen Wirkungen stammen zum großen Teil aus dem Buch „Yoga Asanas" von Swami Sivananda.)
Schnellatmung (kapä/a-bhäti)
Körperlich: Stärkt das Zwerchfell und die Atemhilfsmuskeln. Reinigt die Lungen. Massiert Herz, Leber und Magen. Während der Periode des schnellen Atmens wird der Sauerstoffgehalt im Blut sehr stark erhöht. Das Blut wird dadurch alkalisch (basisch), was bestimmte Stoffwechselvorgänge und Entschla ckung cverbessert. Beim Atemanhalten steigt der Kohlensäure gehalt im Blut, was wiederum andere Stoffwechselvorgänge anregt und die Lungeneffizienz verbessert. Die Zeit des Atem anhaltens ist ein Trainingsreiz, der dazu führt, dass sich die Lungenkapazität erhöht, Kreislauf und Herztätigkeit verbessert werden. Kapä/a-bhäti hilft, die Atemwege (Bronchien, Alve olen, Luftröhre und Nasendurchgänge) zu reinigen, und ist eine gute Vorbeugung gegen Heuschnupfen, Asthma und Erkäl tungskrankheiten. Kapäla-bhäti wirkt reinigend und entschla ckend auf den ganzen Körper. Manche Schüler fühlen sich anfangs leicht schwindlig bei der Übung. Dies ist ein Zeichen, dass das Gehirn noch nicht an diese Menge von Sauerstoff gewöhnt ist, und oft auch, dass der Schüler raucht/geraucht hat. Das Schwindelgefühl vergeht aber nach ein paar Malen. Vergewissere dich auch, dass der Schüler korrekt atmet, insbe sondere die Einatmung NICHT forciert.
Energetisch: Kapäla-bhäti aktiviert das Sonnengeflecht. Die Energie steigt hoch zum Kopf und strahlt von dort aus. Kapä/a-
172
Wirkungen der Yogaübungen
bhäti heißt „Glanz des Schädels" und bezieht sich auf das Gefühl der Energieausstrahlung aus dem Kopf. Man kann mit tels müla-bandha (Wurzelverschluss = Zusammenziehen der Beckenbodenmuskeln), Visualisierung und Konzentration den präQa in die SU$Umnä (feinstoffliche Wirbelsäule) lenken und die cakras aktivieren.
Geistig: Kapä/a-bhäti aktiviert und verhilft zu einem klaren Kopf. Es ist sehr gut, um geistige und emotionelle Spannungen zu beseitigen. Es hilft gegen Müdigkeit und Niedergeschlagen heit und führt zu innerer Freude und Kraft.
Wechselatmung (anuloma-viloma, näc;ii-sodhana)
Körperlich: Wechselatmung hilft, die Lungenkapazität zu erhö hen und die Atmung unter Kontrolle zu bringen. Gerade die Perioden des Atemanhaltens sind ein gutes Training für Herz und Kreislauf. Anuloma-viloma hilft, die Nasendurchgänge zu öffnen. Wechselatmung ist vorzüglich gegen Allergien, Heu schnupfen und Asthma und wirkt vorbeugend gegen Erkäl tungskrankheiten. Anuloma-viloma wirkt harmonisierend auf alle Körpersysteme.
Energetisch: När;ii-sodhana heißt „Reinigung der nädTs". Alle 72 000 nädTs werden geöffnet, sodass prär:,a, die Lebensener gie, besser fließen kann. Insbesondere ir;iä, pingalä und susumnä werden geöffnet, Sonnen- und Mondenergie in ir;iä und pinga/ä harmonisiert. Durch die Öffnung der SU$Umnä kann der präQa in die höheren cakras fließen. Durch Konzen tration kann man den präQa dort hinschicken, wo man ihn haben möchte.
Geistig: Wechselatmung fördert die Konzentrationsfähigkeit und bereitet den Geist auf die Meditation vor. Wechselatmung hilft, zur inneren Ruhe und Kraft zu finden. Emotionelle Un gleichgewichte werden umgewandelt in das ruhige Gefühl der Stärke und Kraft. Die Wirkungen von kapäla-bhäti sind schnel ler spürbar, die der Wechselatmung halten länger an.
Sonnengruß (sOrya-namaskära)
Körperlich: Der Sonnengruß, der am Anfang der Stunde geübt. wird, ist unerlässlich als Vorbereitung auf die äsanas. Er dehnt und wärmt den Körper. Hunderte von Muskeln werden wäh rend des Sonnengrußes eingesetzt. Der Sonnengruß lädt das Sonnengeflecht wieder mit Energie auf und regt das Herz Kreislauf-System an. Diese Übung ist kein äsana (Stellung), son dern eine Yogaübung für sich.
Energetisch: Besonders das Sonnengeflecht wird angeregt. Der Sonnengruß belebt und energetisiert. In den zwölf Bewegun gen werden alle cakras angesprochen:
1. anähata, 2. visuddha, 3. svädhi$thäna, 4. äjfiä, 5. mülä dhära, 6. mar:,i-püra, 7. anähata, 8. mülädhära, 9. äjfiä, 10. svä-dhi$thäna, 11. visuddha, 12. sahasrära.
Geistig: Die Übung harmonisiert und gibt Selbstvertrauen.
-
Kopfstand (str?äsana)
Körperlich: Die Halsschlagader erhält wesentlich mehr Blut. Das Gehirn, die Wirbelsäule und der Sympathikus werden mit Blut versorgt. Krankheiten der Nerven, Augen, Ohren, Nase und des Halses verschwinden. Dieses äsana ist gut gegen Krampfadern, Nierenkoliken und hartnäckige Verstopfung. Dieses äsana ist auch gut gegen Magensenkung und nervöses
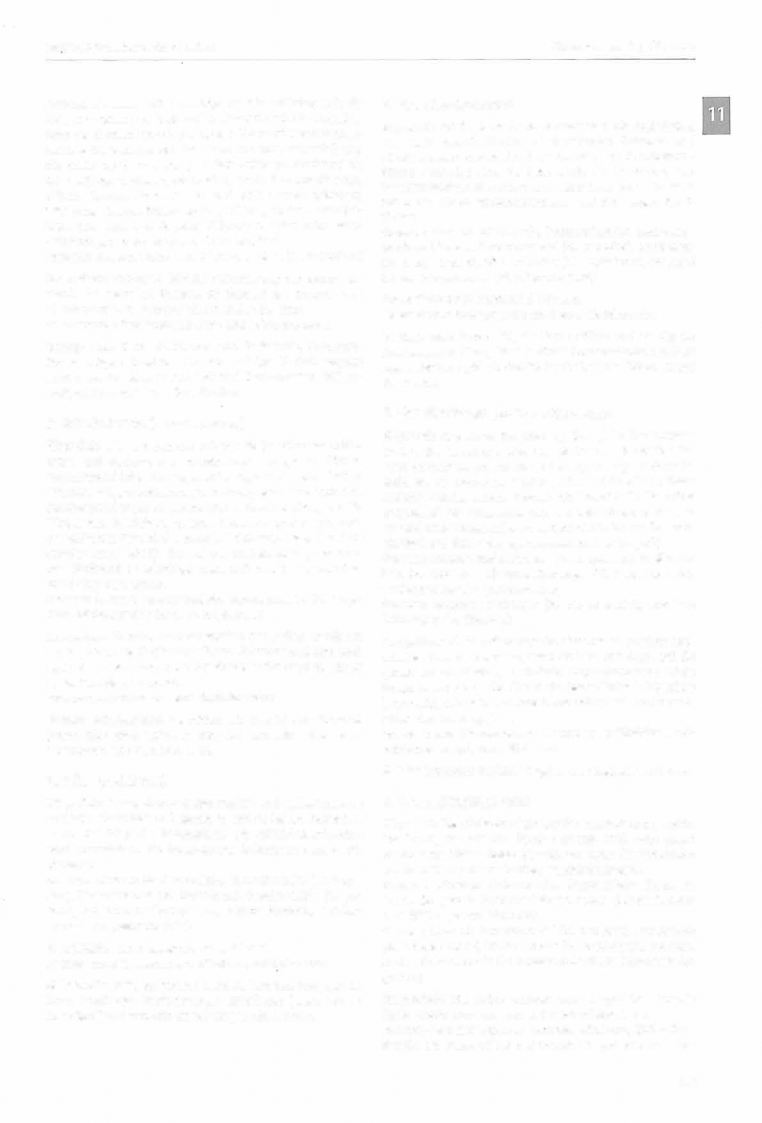
Hatha-yoga-U nterrichtstechniken
Asthma. Die Lunge wird gereinigt, da alle schlechte Luft die Lungen verlässt. Der Kopfstand verbessert auch die Durchblu tung der Kopfhaut {Verringerung von Haarausfall und Verlang samung des Grauwerdens der Haare bzw. von Haarausfall) und des Gesichtes (Verringerung der Faltenbildung). Kopfstand gilt als „Verjünger''. Gleichgewichtssinn, muskuläre Koordination, Selbstvertrauen, Konzentration und Mut werden gefördert. Wer unter starkem Bluthochdruck, Schädigung der Halswirbel säule oder schweren Augenschädigungen leidet, sollte einen Arzt befragen, bevor er dieses ösana ausführt.
GESTÄRKTE MUSKELN: Delta- bzw. Schultermuskeln (M. deltoideus)
Energetisch: Kopfstand hilft zur Sublimierung von apana und damit der sexuellen Energie. Er aktiviert die Sonnen- und Mondenergien im Sonnengeflecht und in der Stirn.
ANGESPROCHENE ENERGIEZENTREN: öjfiö- und sahasröra-cakra
Geistig: Viele Gehirnfunktionen, wie Gedächtnis, Konzentra tionsvermögen, kreatives Denken, geistige Klarheit werden erhöht. Der Kopfstand entwickelt Mut, Konzentration, Willens kraft, Gleichgewicht und Koordination.
-
Schulterstand (sarvängäsana)
Körperlich: Dieses asana normalisiert die Funktion der Schild drüse und dadurch den Metabolismus im ganzen Körper. Schulterstand hilft, eine jugendliche Figur und glatte Haut zu erhalten. Magenverstimmung und Krampfadern verschwinden. Schulterstand ist gut für die weiblichen Geschlechtsorgane. Die Wirbelsäule bleibt/wird flexibel. Nackenverspannungen wer den aufgelöst. Der Schulterstand hat viele Wirkungen des Kopf standes {siehe oben), die auf der Umkehrhaltung beruhen. Der Kopfstand ist allerdings mehr aktivierend, der Schulter stand eher beruhigend.
GEDEHNTE MUSKELN: Nackenmuskeln, Kapuzenmuskel (M. trape zius), Rückenstrecker (hpts. M. longissimus)
Energetisch: Schulterstand regeneriert den prär:,a. Er gilt wie der Kopfstand als Verjüngungsübung. Schulterstand kann auch nach einem anstrengenden Arbeitstag geübt werden, um zu neuer Energie zu kommen.
ANGESPROCHENE ENERGIEZENTREN: visuddha-cakra
Geistig: Schulterstand vermittelt ein Gefühl der Ganzheit (sarva, alle; ariga, Teile). Er hilft, sich und sein Leben so zu akzeptieren, wie man bzw. es ist.
-
Pflug (halasana)
Körperlich: Dieses äsana dehnt Rücken und Halswirbelsäule und hilft, Flexibilität zu bekommen und zu halten. Außerdem dehnt der Pflug die Beinmuskeln. Die Schilddrüsenfunktion wird normalisiert, die Bauchorgane bekommen eine sanfte Massage.
GEDEHNTE MUSKELN: Nackenmuskeln, Kapuzenmuskel (M. trape zius), Rückenstrecker {M. longissimus), Gesäßmuskeln {M. glu teus), Oberschenkelbeuger {M. biceps femoris), Waden muskeln {M. gastrocnemius)
Energetisch: Harmonisierend, ausgleichend. ANGESPROCHENE ENERGIEZENTREN: visuddha-, anöhata-cakra
Geistig: Pflug hilft, zur inneren Mitte zu kommen. Pflug gibt die Kraft, langfristige Veränderungen einzuleiten {,,sein Feld zu bestellen") und geduldig die Wirkungen abzuwarten.
Wirkungen der Yogaübungen
-
Fisch (matsyäsana)
Körperlich: Auch dieses äsana harmonisiert die Schilddrüse. Der Fisch schafft Abhilfe bei verspannten Schulter- und Rückenmuskeln, die eventuell im oder nach dem Schulterstand fühlbar geworden sind. Der Fisch erhöht die Lebenskraft und beseitigt Steifheit im Lenden- und Halswirbelbereich. Der Fisch stärkt die obere Rückenmuskulatur und hilft gegen Rund rücken.
GEDEHNTE MUSKELN: Halsmuskeln, Brustmuskeln {M. pectoralis) GESTÄRKTE MUSKELN: Kapuzenmuskel {M. trapezius), Armbeuger (M. biceps brachii), Rückenstrecker {M. longissimus), eventuell breiter Rückenmuskel (M. latissimus dorsi)
Energetisch: Stark aktivierend, öffnend.
ANGESPROCHENE ENERGIEZENTREN: anöhata-, visuddha-cakra
Geistig:.Dieses ösana hilft, das Herz zu öffnen und emotionale Spannungen zu lösen, die sich oft auf Sonnengeflecht und Herz legen. Der Fisch gibt ein Gefühl der Freiheit, der Offenheit und der Freude.
s. Vorwärtsbeuge (pascimottänasana)
Körperlich: Eine starke Bauchübung. Sie regt die Bauchorgane an, z. B. die Nieren, die Leber und die Bauchspeicheldrüse. Sie wirkt harmonisierend auf die Verdauung und regt die Abwehr kräfte an. Bei drohender Erkältung können 3-10 Min. in dieser Stellung Wunder wirken. Pascimottönösana ist für Diabetiker unerlässlich. Die Kniesehnen und -muskeln {Oberschenkelbeu ger und Wadenmuskeln) werden flexibel. Die Wirbelsäule wird elastisch und dauernde Jugendlichkeit wird herbeigeführt.
GEDEHNTE MUSKELN: Rückenstrecker (M. longissimus), Gesäßmus keln {M. gluteus), Oberschenkelbeuger (M. biceps femmis), Wadenmuskeln (M. gastrocnemius)
GESTÄRKTE MUSKELN: Armbeuger (M. biceps brachii), eventuell Hüftbeuger (M. iliopsoas)
Energetisch: Die Vorwärtsbeuge ist eines der energetisch wirk samsten ösanas, besonders, wenn sie lange gehalten wird. Sie gilt als eine der Stellungen, die beim fortgeschrittenen yogT die kundalinT erwecken. Sie öffnet die feinstoffliche Wirbelsäule (s�?-um(lö), aktiviert alle cakras in der Wirbelsäule und harmo nisiert das Sonnengeflecht.
ANGESPROCHENE ENERGIEZENTREN: besonders mü/ödhöra-, svö dhi?thöna-, mar:,i-püra-, öjfiö-cakra
Geistig: Entwickelt Geduld, Hingabe, die Fähigkeit, loszulassen.
6. Kobra (bhujangäsana)
Körperlich: Die Rückenmuskeln werden massiert und gestärkt. Der Druck, der auf den Bauch ausgeübt wird, wirkt gegen Verstopfung. Dieses ösana ist auch gut gegen die verschiede nen Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane.
GEDEHNTE MUSKELN: Halsmuskeln, Brustmuskeln (hpts. M. Pectoralis), gerade Bauchmuskeln (M. rectus abdomini), even tuell Hüftbeuger {M. iliopsoas)
GESTÄRKTE MusKELN: Kapuzenmuskel (M. trapezius), Armstrecker (M. triceps brachii), Rückenstrecker (M. longissimus), eventuell breite Rückenmuskeln (M. latissimus dorsi), Gesäßmuskeln (M. gluteus)
Energetisch: Die Kobra aktiviert und energetisiert. Energie fließt sowohl vorne als auch in der Wirbelsäule hoch.
ANGESPROCHENE ENERGIEZENTREN: anöhata, visuddha-, äjfiö-cakra
Geistig: Die Kobra öffnet und befreit. Sie gibt Mut zu hohen
173
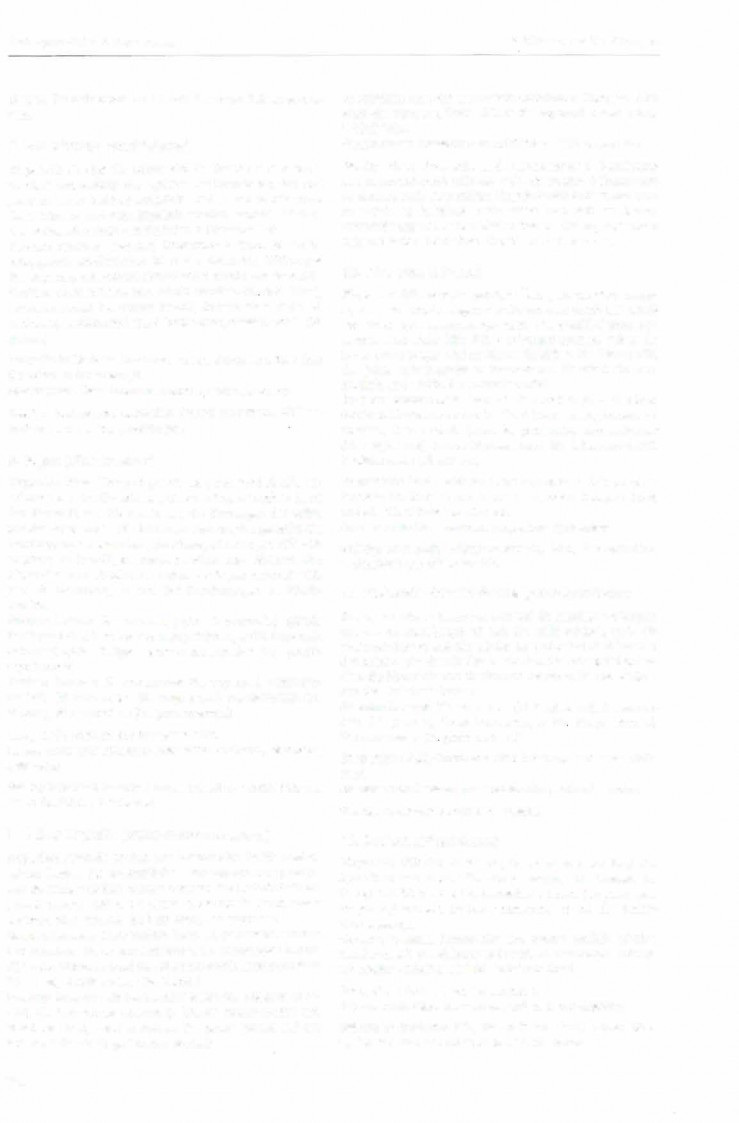
Hatha-yoga-U nterrichtstechniken
idealen. Sie befreit von Furcht und gibt neues Selbstbewusst sein.
7. Heuschrecke (sa/abhäsana)
Körperlich: Wie bei der Kobra wird der Druck auf den Bauch verstärkt und dadurch die Funktion des Darmes reguliert und gestärkt. Leber, Bauchspeicheldrüse und Nieren werden mas siert. Rücken- und Gesäßmuskeln werden gestärkt. Rücken und lschiasschmerzen verschwinden in kürzester Zeit.
GEDEHNTE MUSKELN: eventuell Brustmuskeln (hpts. M. Pecto ralis), gerade Bauchmuskeln (M. rectus abdomini), Hüftbeuger (M. iliopsoas), Oberschenkelstrecker (M. quadriceps femoris) GESTÄRKTE MUSKELN: Delta- bzw. Schultermuskeln (M deltoideus), Oberarmstrecker (M. triceps brachii), Brustmuskeln (hpts. M. pectoralis), Rückenstrecker (M. longissimus), Gesäßmuskeln (M. gluteus)
Energetisch: Die Heuschrecke wirkt stark aktivierend. Sie öffnet die cakras in der suJum(lä.
ANGESPROCHENE ENERGIEZENTREN: besonders visuddha-cakra
Geistig: Salabhäsana entwickelt Selbstbewusstsein, Willens kraft und Durchsetzungsvermögen.
8.Bogen(dhanuräsana)
Körperlich: Diese Übung ist gut für die ganze Wirbelsäule, an gefangen von den Halswirbeln, über die Brust-, Lenden- bis zu den Sakralwirbeln. Sie kombiniert die Wirkungen der Kobra und der Heuschrecke. Die Rückenmuskeln werden gestärkt. Die Bauchorgane erhalten eine gute Massage. Der Bogen hilft, Ver stopfung zu beseitigen, Magenverstimmung, Rheuma und Magen-Darm-Krankheiten zu heilen. Der Bogen reduziert Fett, regt die Verdauung an und löst Blutstauungen im Bauch bereich.
GEDEHNTE MUSKELN: Brustmuskeln (hpts. M. pectoralis), gerade Bauchmuskeln (M. 1·ectus abdomini), Hüftbeuger (M. iliopsoas), Beinstrecker/vierköpfiger Oberschenkelstrecker (M. quadri ceps femoris)
GESTÄRKTE MUSKELN: Kapuzenmuskel (M. trapezius), Unterarm muskeln, Rückenstrecker (M. longissimus), Gesäßmuskeln (M. gluteus), Wadenmuskeln (M. gastrocnemius)
Energetisch: Aktiviert das Sonnengeflecht.
ANGESPROCHENE ENERGIEZENTREN: Ma(li-püra-, anähata-, visuddha-, äjnä-cakra
Geistig: Entwickelt Selbstvertrauen. Erhebt den Geist. Führt zu einem Gefühl der Erhabenheit.
9. Halber Drehsitz (ardha-matsyendräsana)
Körperlich: Durch die Drehung des Körpers wird die Wirbelsäule seitlich flexibel, das sympathische Nervensystem wird gestärkt und die Rückenmuskeln werden massiert. Der Drehsitz heilt all gemein nervöse Leiden. Die Massage, welche die Bauchorgane erfahren, führt Gifte ab, die beim Verdauen entstehen.
GEDEHNTE MUSKELN: Brustmuskeln (hpts. M. pectoralis), schräge Bauchmuskeln (M. obliquus abdomini, M. transversus abdomi ni), breiter Rückenmuskel (M. latissimus dorsi), Lendenmuskeln (M. psoas), Gesäßmuskeln (M. gluteus)
GESTÄRKTE MUSKELN: schräge Bauchmuskeln (M. obliquus abdo mini, M. transversus abdomini), breiter Rückenmuskel (M. latissimus dorsi), Lendenmuskeln (M. psoas) jeweils auf der anderen Seite als die gedehnten Muskeln
174
Wirkungen der Yogaübungen
Energetisch: Eine der energetisch wichtigsten Übungen. Akti viert das Sonnengeflecht, öffnet die suJumnä (feinstoffliche Wirbelsäule).
ANGESPROCHENE ENERGIEZENTREN: mülädhära-, äjnä, sahas-rära
Geistig: Wirkt stressabbauend, nervenstärkend, beruhigend und harmonisierend. Gibt die Kraft, im inneren Gleichgewicht zu bleiben, auch wenn äußere Umstände sich ändern, die inne re Würde zu behalten, auch wenn man sich an äußere Umstände anpasst, seinen idealen treu zu bleiben, auch wenn man auf andere Menschen eingeht und auf sie zugeht.
-
Pfau (mayüräsana)
Körperlich: Gilt als wirkungsvollste Übung für die Verdauungs organe. Die Hauptschlagader im Bauch wird durch den Druck der Ellenbogen zusammengepresst. Die anschließende ver mehrte Blutzufuhr hilft den Verdauungsorganen, stärkt die Leber sowie Magen und Bauchspeicheldrüse. Die Übung hilft, das ganze Nervensystem zu regenerieren. Sie stärkt die Arm muskeln und erhöht die Lungenkapazität.
GEDEHNTE MUSKELN: Delta- bzw. Schultermuskeln (M. deltoideus) GESTÄRKTE MUSKELN: Armstrecker (M. triceps brachii), Unterarm muskeln, Brustmuskeln (hpts. M. pectoralis), Rückenstrecker (M. longissimus), breiter Rückenmuskel (M. latissimus dorsi), Gesäßmuskeln (M. gluteus)
Energetisch: Stark aktivierend und aufweckend. Sehr empfeh lenswert am Morgen und immer dann, wenn Energie schnell und effektiv aktiviert werden soll.
ANGESPROCHENE ENERGIEZENTREN: ma(li-püra-, äjnä-cakra
Geistig: Entwickelt Selbstbewusstsein, Mut, Konzentration, Willenskraft und Gleichgewicht.
-
Stehende Vorwärtsbeuge (päda-hastäsana)
Körperlich: Dieses äsana hat zum Teil die gleichen Wirkungen wie die Vorwärtsbeuge: Es hält die Taille schlank, stellt die Elastizität der Wirbelsäule wieder her und dehnt die Sehnen in den Beinen, vor allem in den Kniekehlen. Sie unterstützt außer dem die Blutzufuhr zum Gehirn und hat einen Teil der Wirkun gen der Umkehrstellungen.
GEDEHNTE MUSKELN: Rückenstrecker (M. longissimus), Gesäßmus keln (M. gluteus), Oberschenkelbeuger (M biceps femoris), Wadenmuskeln (M gastrocnemius)
Energetisch: Päda-hastäsana wirkt belebend und energetisie rend.
ANGESPROCHENE ENERGIEZENTREN: mülädhära-, sahasrära-cakra.
Geistig: Entwickelt Demut und Hingabe.
-
Dreieck (tri-konäsana)
Körperlich: Hilft den Gedärmen, besser zu arbeiten. Regt den Appetit an und unterstützt die Verdauung. Die Muskeln im Rumpf und Rücken werden beweglich. Rückenschmerzen kann vorgebeugt werden. Die Leber wird massiert und der Gallen fluss angeregt.
GEDEHNTE MUSKELN: Armstrecker (M. triceps brachii), schräge Bauchmuskeln (M. obliquus abdomini, M. transversus abdomi ni), breiter Rückenmuskel (M. latissimus dmsi)
Energetisch: tri-kanäsana harmonisiert.
ANGESPROCHENE ENERGIEZENTREN: alle cakras in der SUJUm(lä
Geistig: tri-konäsana hilft, die Welt aus einem neuen Blick winkel zu sehen und offen zu werden für Neues.
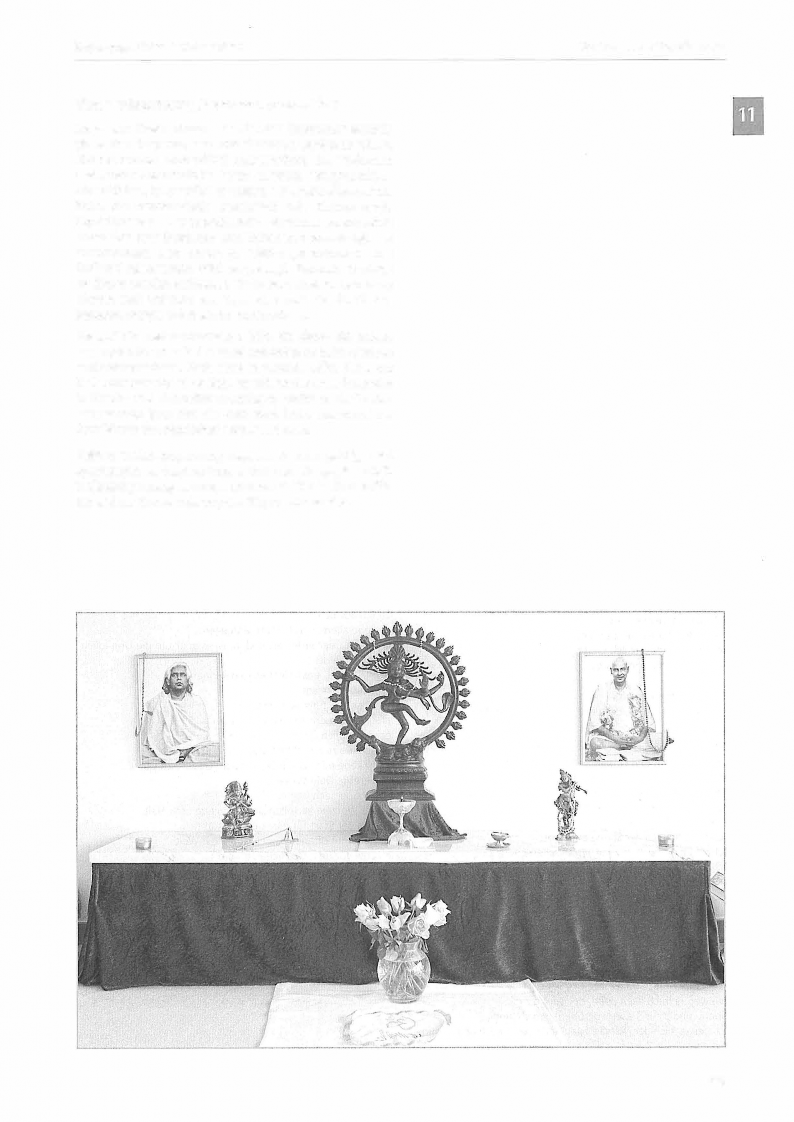
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
Tiefenentspannung (saväsana, yoga-nidrä)
Körperlich: Tiefenentspannung löst den Entspannungsimpuls (Relaxation Response) aus: Stresshormone werden abgebaut, Glückshormone (Endorphine) ausgeschüttet, die Produktion bestimmter Botenstoffe im Gehirn angeregt. Parasympathikus wird aktiviert, Sympathikus reduziert. Der Kreislauf kommt zur Ruhe, die Arterienwände entspannen sich. Bluthochdruck, Kopfschmerzen, Magenproblemen, Verdauungskrankheiten sowie allen stressbedingten Krankheiten wird vorgebeugt. Das Immunsystem wird angeregt, Erkältungskrankheiten und Stoffwechselstörungen wird vorgebeugt. Reparaturvorgänge im Körper werden verbessert. 10-15 Min. Tiefenentspannung können auch während des Tages oder nach der Arbeit ver brauchte Energie sofort wieder zurückbringen.
Energetisch: Tiefenentspannung hilft, die durch die äsanas angeregten Energien in den nädis und cakras zu harmonisieren und aufzuspeichern. Nach einer Yogastunde sollte daher die Tiefenentspannung nie fehlen, sonst kann der erweckte prä,:w in Unruhe und Nervosität umschlagen. Während der Tiefen entspannung kann sich die Aura ausdehnen, manchmal der Astralkörper den physischen Körper verlassen.
Geistig: Tiefenentspannung regeneriert auch geistig, baut Spannungen ab, führt zu innerer Ruhe und Ausgeglichenheit. Tiefenentspannung kann auch zu einem Gefühl der Freude füh ren und zur Transzendierung des Körperbewusstseins.
Wirkungen der Yogaübungen
175
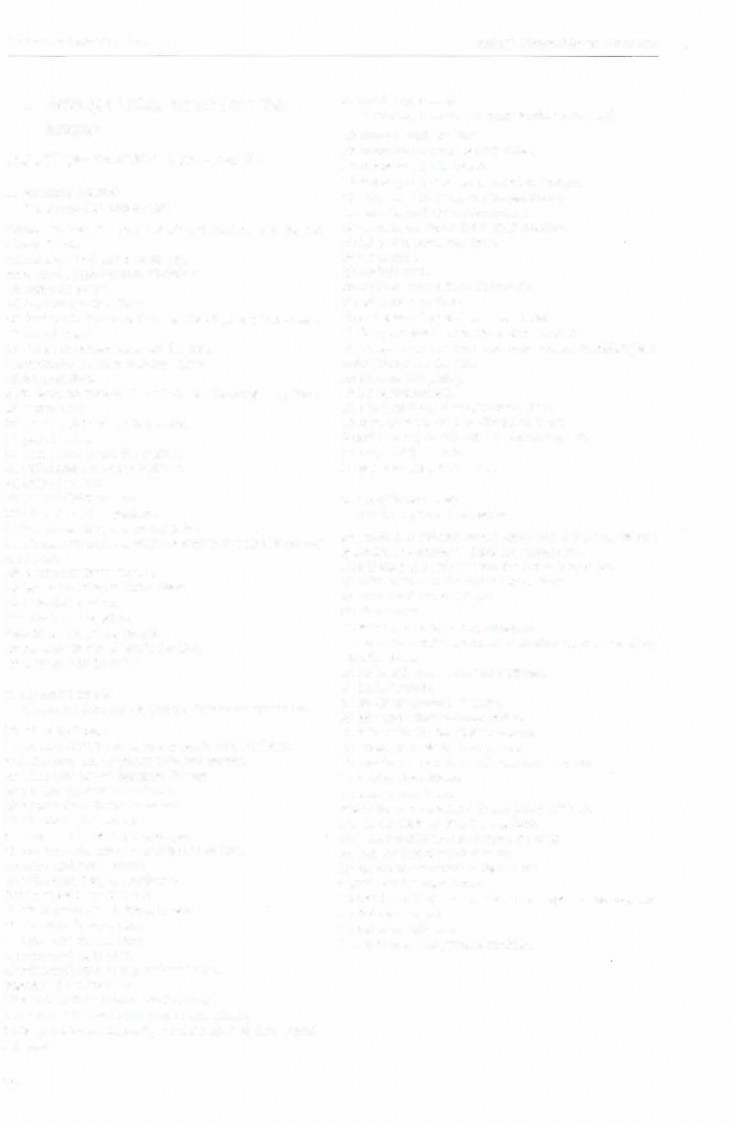
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
-
-
Geistige Entsprechungen der äsanas
-
Sürya-namaskära (Sonnengruß)
-
Of'!I miträya namab
(Verehrung dem Liebevollen)
Sonne, ich bedanke mich bei Dir und beginne den Tag mit einem Lächeln.
Ich stehe vor Gott und bete zu Ihm. Ich verbinde mich mit dem Göttlichen. Ich grüße die Sonne.
Ich bitte um geistige Führung.
Ich beginne in Dankbarkeit für all die Dinge und Lebewesen, die um mich sind.
Ich stehe mit beiden Füßen auf der Erde. Das Göttliche wohnt in meinem Herzen. Ich bin andächtig.
Gott, Vater, ich möchte Dich mit diesem Sonnengebet grüßen. Ich sammle mich.
Ich bereite mich vor und öffne mich. Ich gehe in mich.
Ich grüße Dich, kosmische Energie. Gegrüßet seist Du, treuer Begleiter. Ich grüße das Licht.
Körper und Geist sind eins.
-
Ich bin ruhig und ausgeglichen.
Ich entspanne mich, komme zur Ruhe .
Ich bin demütig und lege meine Gedanken in meine Hände vor mein Herz.
Ich vertraue meinem Können.
Ich lege mein Leben in Gottes Hände. Ich sehe Gott in allem.
Ich ruhe in meiner Mitte. Gegrüßt sei unser aller Freund.
Ich bin eins mit mir. Ich grüße das Licht. Ich sammle mich im Gebet.
-
-
Of'!I ravaye namab
(Verehrung dem, der die Ursache für Veränderungen ist)
Ich grüße die Sonne.
Ich strecke mich Dir entgegen und werde immer offener. Ich öffne mich und empfange Licht und Wärme.
Ich öffne mich für die kosmische Energie. Ich bin eins mit dem Unendlichen.
Ich wachse dem Himmel entgegen. Ich bin offen. Ich öffne mich .
Ich strecke mich der Sonne entgegen.
Ich verbinde mich mit der himmlischen Energie. Ich öffne mich zum Himmel.
Ich öffne mich, Dich zu empfangen. Gepriesen sei Deine Allmacht.
Ich bin biegsam wie ein Baum im Wind. Ich bin offen für neue Ideen.
Ich öffne mich für das Licht. Ich öffne mich nach oben.
Ich öffne mich für Neues in meinem Leben. Gegrüßt sei der Strahlende.
Ich wende mich nach oben, der Sonne zu.
Sonne und Licht fließen von oben in mich hinein. Ich beuge mich dem Allmächtigen und strecke mich dem Himmel entgegen.
176
Geistige Entsprechungen der äsanas
-
Of'!I süryäya namab
(Verehrung dem, der uns zum Handeln veranlasst)
Ich verneige mich vor Gott.
Ich verbeuge mich vor dem Göttlichen. Ich verbeuge mich in Demut.
Ich verbeuge mich vor der kosmischen Energie. Ich neige mich zur Erde, zum Vergänglichen.
Ich habe Respekt vor der Schöpfung.
Ich vertraue der Natur und meiner Intuition. Ich bin bereit, etwas zu lernen.
Ich neige mich. Ich schließe mich.
Ich verbinde mich mit der Erdenergie. Ich neige mich zur Erde.
Ich verbeuge mich vor Deiner Herrlichkeit.
Die Beugemuskeln meiner Beine sind gedehnt.
Ich beuge mich zur Erde und spüre meine Standfestigkeit, meine Wurzeln in der Erde.
Ich bin anpassungsfähig. Ich bin vertrauensvoll.
Ich beuge mich vor dem göttlichen Willen. Ich verneige mich vor dem Göttlichen in mir.
Gegrüßt sei der, der Vitalität und Aktivität verleiht. Ich beuge mich zur Erde.
Ich verbeuge mich tief vor Ihm.
-
Of'!I bhänave namab
(Verehrung dem Lichtspender)
Ich spüre den sicheren Boden unter mir, der Deine Wärme speichert, und empfange Deine kosmische Kraft.
Ehrerbietig nehme ich die Kraft der Sonne in mich auf. Ich öffne mein Herz der Quelle allen Lebens.
Ich schaue auf zum Göttlichen. Ich bin aufrecht.
Ich sehe allem, was kommt, entgegen.
Ich bin mit der Erde verbunden, weiß aber um die Unendlich keit allen Seins.
Ich bin bereit, etwas Neues zu beginnen. Ich bin beherrscht.
Ich bin erwartungsvoll gespannt.
Ich höre und erkenne Gottes Willen.
Ich öffne mich für die göttliche Energie. Ich schaue zuversichtlich nach vorne.
Ich begebe mich zur Erde, mit dem Gesicht zu Dir. Ich verehre Dein Wissen.
Ich schaue nach vorne.
Meine Wurzeln verteilen sich und geben mir Halt. Dies ist der Start für eine neue Zukunft.
Ich gehe mit offenen Augen durch die Welt. Ich knie vor dem Göttlichen in mir.
Ich schaue zuversichtlich in die Zukunft. Gegrüßt sei der Erleuchtete.
Ich wende mich wieder der Sonne entgegen, bleibe aber mit der Erde verbunden.
Ich verharre, halte inne.
Kniend bitte ich um göttliche Strahlen.
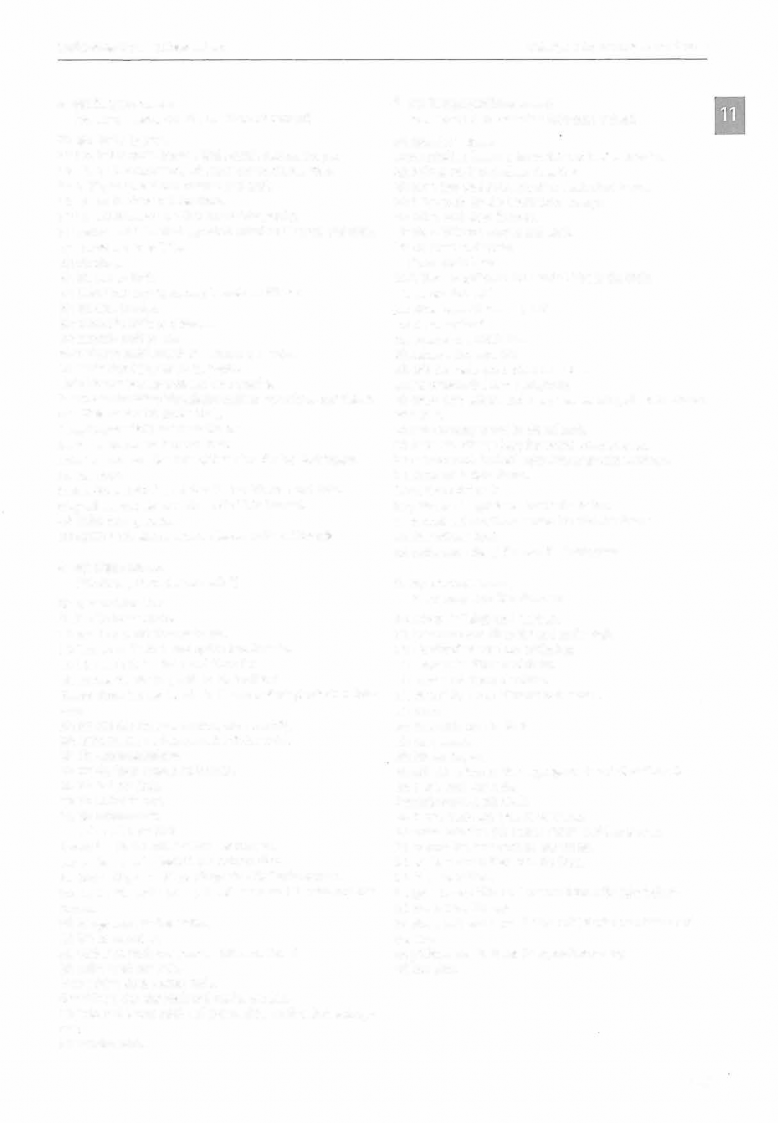
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
-
orr khagäya namal:,
(Verehrung dem, der sich am Himmel bewegt)
Sie gibt Kraft, Energie.
Ich bin fest verpolt. Energie fließt durch meinen Körper. Ich bin im Gleichgewicht. Ich gehe den mittleren Pfad. Mein Körper ist voll von Energie und Kraft.
Ich bin im Einklang mit der Erde.
Ich bin mit Himmel und Erde im Gleichgewicht.
Ich befinde mich im Gleichgewicht zwischen Himmel und Erde. Ich werde immer kräftiger.
Ich bin stark.
Ich bin fest in Gott.
Ich halte Kraft und Spannung in meinem Körper. Ich bin eine Brücke.
Ich entwickle Kraft und Willen. Ich sammle Kraft in mir.
Ich verharre stabil zwischen Himmel und Erde. Ich senke den Blick vor Deiner Güte.
Mein Körper ist gespannt wie eine Brücke.
Durch gleichmäßige Verteilung meines Gewichtes auf Hände und Füße erlebe ich große Kraft.
Ich gehe geradlinig auf mein Ziel zu. Ich vertraue meiner inneren Kraft.
Zwischen mir und der Erde gibt es eine direkte Verbindung. Ich bin stark.
Meine Arme behalten mich zwischen Himmel und Erde. Gegrüßt sei der, der sich durch die Lüfte bewegt.
Ich halte mich gerade.
Ich spüre noch einmal meine eigene Kraft und Energie.
-
orr pÜfil')e namal:,
(Verehrung dem, der alle nährt)
Sie spendet das Licht. Gottes Wille geschehe.
Ich werde von der Erde getragen.
Ich tauche in die Erde und spüre ihre Energie. Ich bin eins mit der Erde und diene ihr.
Ich nehme Verbindung mit der Erdkraft auf.
Mutter Erde, ich d_anke Dir als Quelle meiner physischen Exis tenz.
Ich bin mit der Erde verbunden, die mich trägt. Ich spüre meine Verbundenheit mit der Erde. Ich bin anpassungsfähig.
Ich bin dankbar, spüren zu können. Ich bin Teil der Erde.
Ich bin voller Demut. Ich bin willensstark.
Ich neige mich zur Erde.
Beweglich bin ich mit der Erde verbunden. Ich verdecke mein Gesicht vor Deinem Glanz.
Ich bilde mit ganzer Körperlänge eine Wellenbewegung.
Ich danke für mein Leben, demütig beuge ich mich auf den Boden.
Ich beuge mich Gottes Willen. Ich bin konzentriert.
Ich verbeuge mich vor meinem höheren Selbst. Ich neige mich zur Erde.
Meine Stirn küsst Mutter Erde.
Gegrüßt sei der, der Kraft und Stärke verleiht.
Ich knie und beuge mich auf Erden, ohne mich selbst aufzuge ben.
Ich erhebe mich.
Geistige Entsprechungen der äsanas
-
orr hiral')yagarbhäya namal:,
(Verehrung dem, der allen Reichtum enthält)
Sie spendet Wärme.
Deine Strahlen lassen mich weich und flexibel werden. Ich befreie mich von allem Negativen.
Ich lasse Erd- und Sonnenkraft in mich einströmen. Ich öffne mich für die himmlische Energie.
Ich öffne mich dem Kosmos.
Ich bin erfüllt von Anmut und Kraft. Ich bin stark und mutig.
Ich öffne mein Herz.
Mein Herz ist geöffnet. Ich sende Liebe in die Welt. Ich bin ausdauernd.
Ich blicke voller Erwartung auf. Ich bin voller Kraft.
Ich schaue zum Göttlichen. Ich sehne mich nach Dir.
Ich erhebe mich, um Dich zu schauen. Meine Brustwirbel sind nachgiebig.
Ich trete dem Leben und dem, was es mir gibt, entschlossen entgegen.
Ich sehe vertrauensvoll in die Zukunft.
Ich habe ein offenes Herz für meine Mitmenschen.
Ich erhebe mich kraftvoll vom Schweren zum leichten. Ich öffne mich dem Guten.
Mein Herz wird weit.
Gegrüßt sei das goldene, kosmische Selbst. Verwurzelt mit der Erde erhebe ich mich zur Sonne. Ich bin voll von Kraft.
Ich recke mich der göttlichen Kraft entgegen.
-
orr marTcaye namal:,
(Verehrung dem Strahlenden)
Sie bringt Helligkeit und Klarheit.
Ich bekomme von Dir mehr und mehr Kraft. Ich bin standhaft und unverrückbar.
Ich beherrsche Sinne und Geist. Ich erhebe mich von der Erde.
Ich bin mit Erde und Himmel verbunden. Ich diene.
Ich löse mich von der Erde. Ich bin gesund.
Ich bin ein Bogen.
Ich schaue zurück in die Vergangenheit und akzeptiere sie. Ich neige mich zur Erde.
Demütig sammle ich Kraft.
Ich beuge mich, um Dich zu verehren.
Ich stehe mühelos mit beiden Füßen auf dem Boden. Ich nehme hin, was nicht zu ändern ist.
Ich achte unseren Planeten, die Erde. Ich bin bescheiden.
Ich gebe meine Hilfe und meinen Schutz für Schwächere. Ich bin voll von Energie.
Ich stehe fest und unverrückbar mit Händen und Füßen auf der Erde.
Gegrüßt sei der Gott der Morgendämmerung. Ich bin aktiv.
177
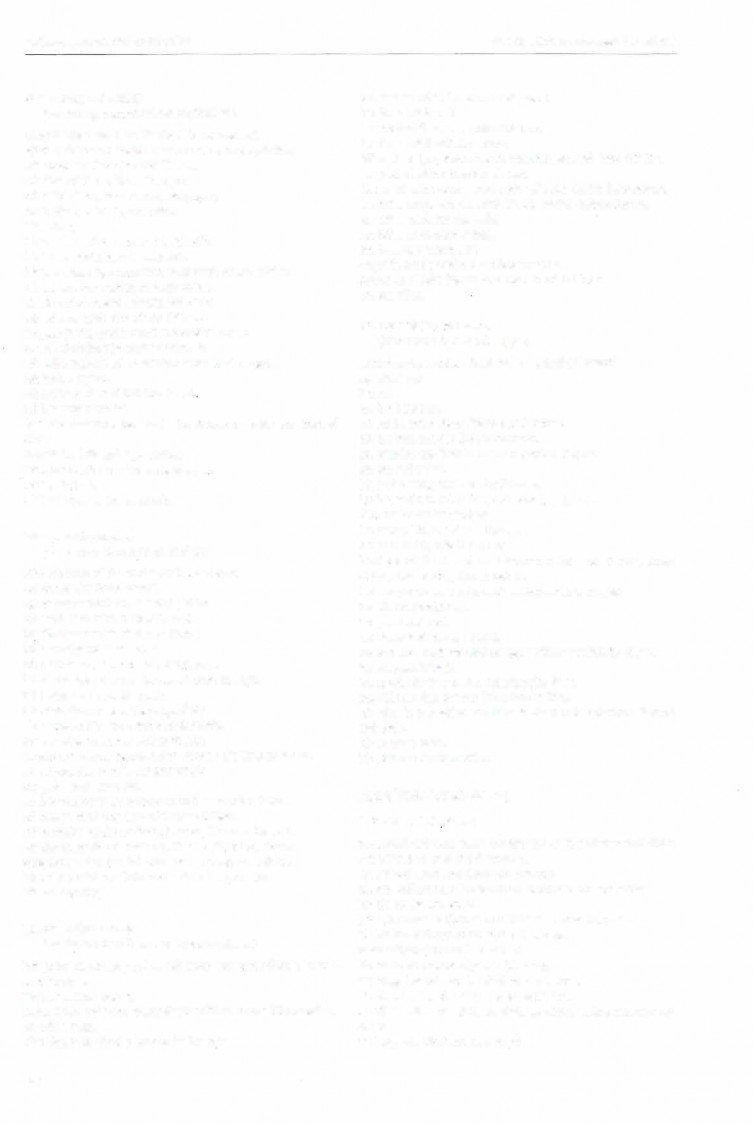
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
-
om ädityäya namab
(Verehrung dem Verehrungswürdigen)
Ehrerbietig nehme ich die Kraft der Sonne auf. Körper, Geist und Seele erheben sich energiegeladen. Ich schaue auf zu dem Göttlichen.
Ich löse mich von Verhaftungen.
Ich sehe allem, was kommt, entgegen. Mein Herz ist jetzt ganz offen.
Ich erkenne.
Ich schaue mit Freude in die Zukunft. Ich bin erwartungsvoll gespannt.
Mögen diese Eigenschaften mich auch heute stärken. Ich schaue zuversichtlich nach vorne.
Zu Dir aufschauend schreite ich voran. Ich erhebe mich, um Dir zu dienen.
Es gelingt mir, große Schritte vorwärts zu tun. Meine Kraft liegt in meinen Wurzeln.
Ich sehe meinen Mitmenschen offen in die Augen. Ich lächle mir zu.
Ich knie vor dem Göttlichen in mir Ich bin zuversichtlich.
Aus der gesammelten Kraft des Berges schreite ich kraftvoll voran.
Gegrüßt sei die geistige Mutter.
Ich wende mich der Sonne entgegen. Ich bin bei mir.
Ich bitte um die Sonnenkraft.
-
Of!I savitre namab
(Verehrung dem Schöpferischen)
Ich verbeuge mich vor der Kraft der Sonne. Ich danke der Sonnenkraft.
Ich verneige mich vor Dir, Gott, Vater. Ich verbeuge mich in Dankbarkeit.
Ich überlasse mich völlig der Natur. Ich verneige mich vor Gott.
Ich verbeuge mich vor dem Göttlichen.
Ich verbeuge mich vor der kosmischen Energie. Ich neige und schließe mich.
Ich akzeptiere meine Vergangenheit. Verbeugend löse ich mich von der Erde. Ich verneige mich vor Deiner Gnade.
Es fällt mir immer leichter, den Kopf an die Knie zu legen. Ich erlebe das Gefühl der Sicherheit.
Ich gebe mich Gott hin.
Ich bin vollkommen entspannt und lasse mich fallen. Ich beuge mich vor dem göttlichen Willen.
Ich verneige mich vor Stein, Pflanze, Tier und Mensch. Ich danke, mich verneigend, für alle göttlichen Gaben. Gegrüßt sei der, den ich von Herzen verehren möchte. Ich beuge mich zur Erde und gebe mich ganz hin.
Ich bin demütig.
-
om arkäya namab
(Verehrung dem Sohn des Ursprünglichen)
Mit jeder Einatmung dehne ich mich aus und schöpfe kosmi sche Energie.
Gib mir Deinen Segen.
Liebe, Mut, Kraft und Gesundheit erfüllen meine Körperzellen. Ich öffne mich.
Ich öffne mich für die kosmische Energie.
178
Geistige Entsprechungen der äsanas
Ich strecke mich der Sonne entgegen. Ich öffne mich weit.
Ich wachse über mich selbst hinaus. Ich freue mich auf das Leben.
Mich Dir entgegenstreckend, öffnend gebe ich mich Dir hin. Ich preise Deinen Namen allezeit.
Wenn ich mich öffne, werde ich Hilfe von außen bekommen. Ich öffne mich, um die Strahlen der Sonne aufzunehmen.
Ich öffne mich für das Licht. Ich öffne mich dem Guten. Ich hole zu Neuem aus.
Gegrüßt sei der Sohn der Göttermutter.
Sonne und Licht fließen von oben in mich hinein. Ich bin offen.
12. Of!I bhäskaräya namab
(Verehrung dem Strahlenden)
„Nicht mein, sondern Dein Wille geschehe." !Lk 22,241 Of!I SÖnti 0(!1
Amen.
Ich bin bewusst.
Ich stehe mit beiden Füßen auf der Erde. Ich bin fest mit der Erde verwurzelt.
Ich erspüre die Kraft in meinem ganzen Körper. Ich bin zufrieden.
Ich stehe entspannt und im Frieden.
Ich bin ruhig in mir selbst, entspannt, gelassen. Alles ist im Gleichgewicht.
Ich danke Dir, kosmische Energie. Ich ruhe in Dir, wie Du in mir.
Ich freue mich mit meinem Körper und habe das Gefühl, etwas Gutes, Gesundes getan zu haben.
Ich entspanne und sehe meinen Aufgaben entgegen. Ich bin bodenständig.
Ich gehe aufrecht.
Ich stehe fest wie ein Baum.
Ich bewahre Haltung und schaue meiner Realität ins Auge. Ich bin gesammelt.
Ich spüre die im Inneren gesammelte Kraft. Gegrüßt sei der, der zur Erleuchtung führt.
Ich ruhe in mir selbst und lebe in Harmonie zwischen Himmel und Erde.
Ich sammle mich.
Ich stehe in Konzentration.
-
-
YOGA V1ovA-Reihe
-
-
-
Kopfstand (sTrsäsana)
Sauerstoff erfrischt mein Gehirn und erfüllt Körper und Geist mit Harmonie und Gleichgewicht.
Ich bin voll Kraft und dennoch anmutig.
Ich bin vollkommen konzentriert, aufmerksam und ruhig. Ich bin mutig und stark.
Ich habe meinen Körper und Geist voll unter Kontrolle.
Ich bin im Gleichgewicht und beherrsche mein selbstgebautes Fundament.
Ich stehe zu meiner eigenen Meinung.
Ich fange bei mir an, die Welt zu verändern. Ich bin frei. Ich bin ruhig und konzentriert.
Ich fühle mich königlich, im Gleichgewicht, meine Intuition er wacht.
Ich trage die Welt auf dem Kopf.
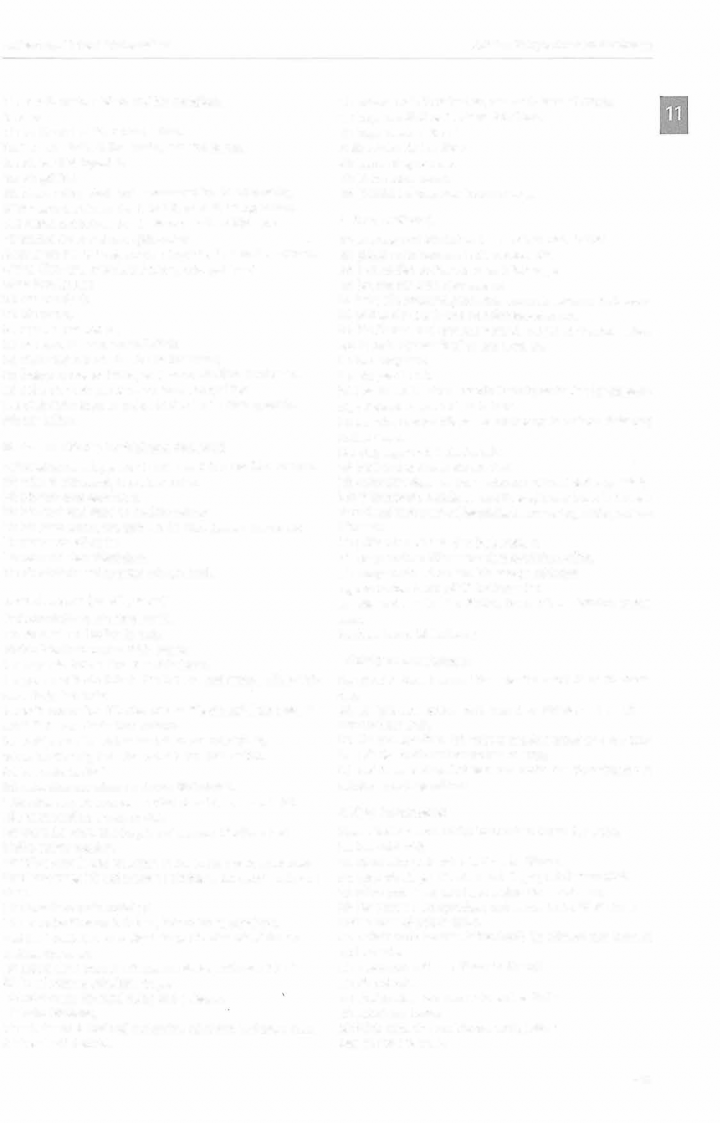
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
Ich ruhe in meiner Mitte und bin standfest.
So'ham.
Ich bin Herrscher über mein Leben.
Auch wenn die Welt Kopf steht, ruhe ich in mir. Ich bin im Gleichgewicht.
Ich bin göttlich.
Ich bleibe ruhig, stark und ausdauernd im Gleichgewicht, auch wenn der Strom der Polarität seine Richtung ändert. Mit Gleichmut betrachte ich diese verkehrte Welt und verbrenne sie in meinem ajfia-cakra.
Auch wenn meine Welt auf dem Kopf steht, stehe ich aufrecht. Meine Hirn- und Beindurchblutung wird gefördert.
Mein Kopf ist klar. Ich bin standhaft. Ich bin mutig.
Ich sage Ja zum Leben.
Ich bin entschlossen und tatkräftig.
Ich stehe fest wie ein Fels in der Brandung.
Ich bleibe in meiner Mitte, auch wenn die Welt Kopf steht. Ich sehe die Welt aus einer anderen Perspektive.
Die Welt steht Kopf, trotzdem bleibe ich im Gleichgewicht mit mir selbst.
Stellung des Kindes (garbhasana, balasana)
Vertrauensvoll entspanne ich mich im Schoß der Mutter Erde. Ich ruhe in mir selbst, in meiner Mitte.
Ich bin von Gott geschützt.
Ich bin stark und gebe an andere weiter.
Ich bin ganz entspannt, atme in die Erde hinein, welche der Ursprung von allem ist.
Ich vertraue dem Göttlichen.
Ich bin einfach und spontan wie ein Kind.
-
Schulterstand (sarvaligasana)
Kraft durchdringt alle Körperteile. Ich bin stark und voller Energie. Meine Schultern tragen mich empor.
Ich trage die Erde auf meinen Schultern.
Ich gehe durch die Schule des Lebens und nehme alle weltli chen Aufgaben wahr.
Ich weiß um meine Pflichten und erfülle sie auf eigene Weise mit Würde und Aushaltevermögen.
Ich weiß, dass ein spirituelles Leben nur möglich ist, wenn ich die Aufgaben der materiellen Welt erfülle. Ich bin zielorientiert.
Ich sehe alles aus einem anderen Blickwinkel.
Was unten ist, ist auch oben. Was oben ist, ist auch unten. Alle meine Zellen erneuern sich.
Ich trage die Erde, Weltkugel, auf meinen Schultern und bleibe aufrecht dabei.
Ich führe Anteile und Energien in mir in Harmonie zusammen. Probleme trage ich auf meinen Schultern, bin dabei ruhig und stark.
Ich akzeptiere mein Schicksal.
Ich herrsche über mein Leben, indem ich es annehme. Fest im Kosmischen verankert, trage ich alles Weltliche auf meinen Schultern.
Ich stütze den Himmel mit meinen Füßen, während ich die Welt auf meinen Schultern trage.
Ich trage mein Schicksal ruhig und gelassen. Ich habe Rückgrat.
Ich erhebe mich kraftvoll auf meine Schultern und trage mein Schicksal mit Geduld.
Geistige Entsprechungen der äsanas
Ich nehme mein Schicksal an, was auch immer kommt. Ich trage die Welt auf meinen Schultern.
Ich trage mein Schicksal. Meine Füße sind im Feuer. Ich stehe ruhig und still.
Ich stütze mich selbst.
Ich lausche auf das, was kommen mag.
-
Pflug (halasana)
Erneuerung und Wachstum beherrschen mein Leben. Ich pflüge mein Leben. Ich bin zuversichtlich.
Ich bereite den Boden für neue Erfahrungen. Ich bin mit der Erde verwachsen.
Ich habe alle notwendigen Mittel, um mein Leben zu verändern. Ich pflüge alte Denk- und Handlungsweisen um.
Ich bin flexibel und erreiche Veränderungen in meinem Leben durch mein eigenes Wollen und Können.
Ich bin entspannt. Ich bin ganz in mir.
Ich bereite mein Leben, schaffe fruchtbaren Boden für das stän dige Neuerschaffen meines Lebens.
Ich benutze meinen Körper als Werkzeug für meinen Geist und meine Seele.
Die Vergangenheit ist hinter mir. Ich bereite den Boden für die Saat.
Ich verändere das, was ich verändern will und bleibe geduldig. Mit Willenskraft, Ausdauer und Beweglichkeit bereite ich den Grund, auf dem mein Selbst gedeiht und warte geduldig auf die Blütezeit.
Ich pflüge den Boden, den Du bereitest.
Ich neige meinen Körper vor dem göttlichen Arilitz. Ich pflüge mein Leben um. Ich ersetze schlechte Eigenschaften durch göttliche Tugenden.
Ich säe und bereite den Boden, bevor ich die Früchte ernten kann.
Auch im Chaos ist Ordnung.
Brücke (setu-bandhasana)
Selbstsucht, Gier, Zorn und Hass werden durch Liebe überwun den.
Ich schlage eine Brücke zwischen dem Göttlichen im Univer sum und der Erde.
Ich bin ganz geöffnet. Ich schlage Brücken zwischen allen Wel ten mit der Kraft der kosmischen Energie.
Ich verbinde, schlage Brücken und suche das Gemeinsame in scheinbaren Gegensätzen.
-
Fisch (matsyasana)
Meine Seele schwimmt im kosmischen Ozean der Liebe. Ich bin zielstrebig.
Ich fühle mich wohl wie ein Fisch im Wasser.
Ich sehe die Dinge, die hinter mir liegen, mit Gelassenheit. Ich öffne mein Herz und lasse meine Liebe erstrahlen.
Ich lasse mein Herz sprechen und handle in der Welt durch meine innewohnende Liebe.
Ich befreie mein inneres Selbst durch die Öffnung zum Himmel und zur Welt.
Ich schwimme mit dem Fluss der Energie. Ich bin befreit.
Ich strahle Liebe aus und ruhe auf der Erde. Ich entwickle Liebe,
ich fühle mich frei von Schwermütigkeiten. Dies ist reine Wonne.
179
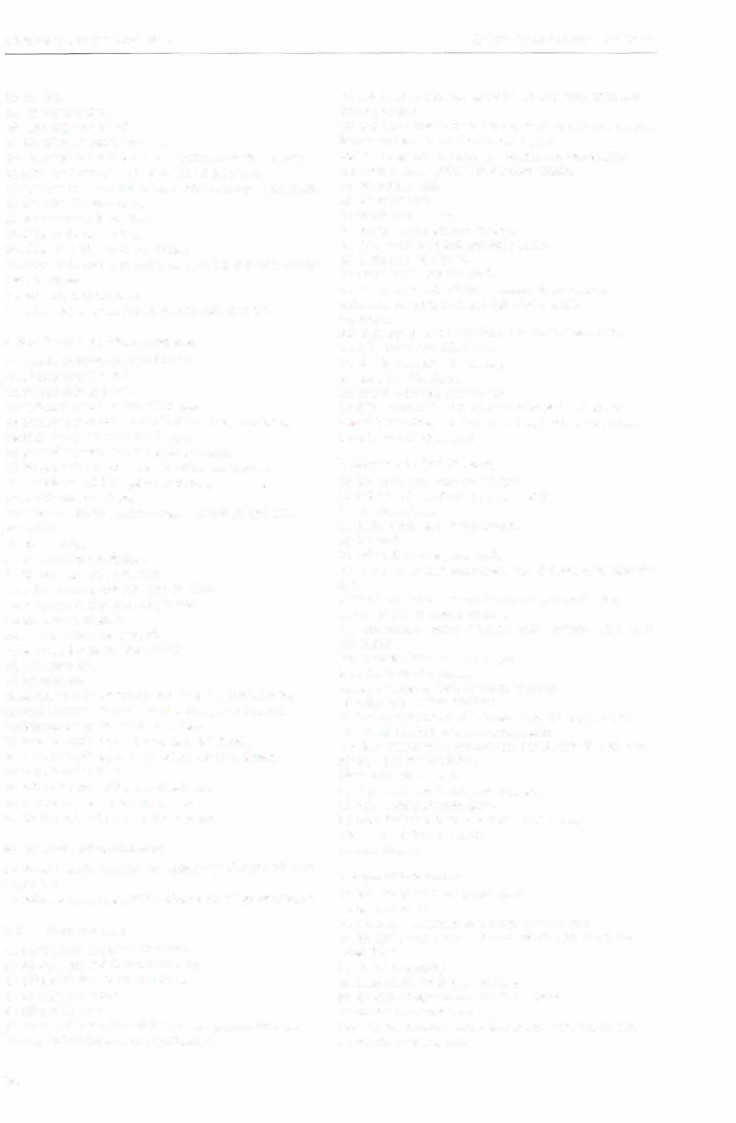
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
Ich bin frei.
Ich bin ungebunden.
Ich kann tun, was ich will.
Ich bin offen für Veränderungen.
Im Bewusstsein der Erdverbundenheit meines Körpers öffne ich mich der kosmischen Energie, die mich befreit.
Ich sprenge Brust und Kehle und entfalte mich ins Universum. Ich bin offen für alles Neue.
Ich bin biegsam wie ein Fisch. Ich öffne mein Herz-cakra.
Ich öffne mich für die Gnade Gottes.
Ich öffne mein Herz weit und fühle mich frei und wohl wie ein Fisch im Wasser.
Ich bin offen und vertraue.
Ich gebe mich meinem Leben, meinen Aufgaben hin.
-
Vorwärtsbeuge (pascimottänäsana)
Energie durchströmt meinen Rücken. Alles Krankhafte löst sich.
Ich bin geduldig und fest.
Ich verbeuge mich vor dem Göttlichen.
Ich erwarte nur so viel, wie mein Körper hergeben kann. Geduldig beuge ich mich den Dingen.
Ich lasse alles geschehen, ich lasse es fließen.
Ich bin geduldig und vertraue dem Fluss des Lebens. Ich genieße es, mich hingeben zu dürfen,
ohne aktiv sein zu müssen.
Ich gebe alles Wollen und Erzwingen einfach ab und lasse geschehen.
Ich bin demütig.
Ich lasse die Energie fließen. Ich bin eins mit mir, im Ganzen.
Ich habe Ausdauer mit mir selbst in allem. Ich entwickle Geduld und gehe in mich.
Ich übe mich in Geduld.
Ich lasse in Demut los, gebe ab.
Ich vertraue der kosmischen Energie. Ich lasse ganz los.
Ich bin geduldig.
Geduldig, mein Selbst bewahrend, lasse ich Weltliches los, vor dem Kosmos gebeugt, auf seine Energie vertrauend. Zurückgezogen ins Selbst atme ich Dich.
Ich lasse los und beuge mich vor dem Göttlichen.
Ich lasse mich geborgen in den Schoß der Erde sinken. Ich habe Geduld mit mir.
Ich gebe mich dem göttlichen Gesetz hin. Ich nehme mich ernst. Ich bin bei mir.
Ich bin für mich. Ich habe mich verborgen.
Schiefe Ebene (piJrvottänäsana)
Ich bin auch stark, wenn ich mal „schief liege", suche ich nach dem Grund.
Ich halte mich gerade gestreckt, obwohl mein Kopf gebeugt ist.
-
Kobra (bhujaligäsana)
Ich befreie mich von allem Negativen. Ich bin voll Kraft und dennoch anmutig. Ich öffne mich der kosmischen Kraft.
Ich bin stark und mutig. Ich öffne mein Herz.
Ich erhebe mich aus dem Weltlichen und gelange über die
Öffnung meines Herzens zum Spirituellen.
180
Geistige Entsprechungen der äsanas
Ich zeige meine Liebe der ganzen Welt und richte mich zum Himmel empor.
Ich drehe und wende mich aus den weltlichen Begrenzungen heraus und strecke mich zur Unendlichkeit.
Meine Schlauheit lässt mich der Welt meine Liebe zeigen und mich meiner spirituellen Berufung folgen.
Ich bin ausdauernd. Ich bin voller Kraft.
Ich werde weit und frei.
Ich empfange die göttliche Energie.
Ich öffne mein Herz und entwickle Liebe. Ich blicke zum Göttlichen.
Ich strebe nach dem Spirituellen.
Ich bin im Irdisch-Sinnlichen verankert, öffne meinen Mitmenschen mein Herz und habe hohe ideale.
Ich strebe.
Aus dem Staube mich aufrichtend suche ich Dein Anlitz. Ich öffne mich dem Göttlichen.
Ich bin biegsam wie eine Schlange. Ich habe den Überblick.
Ich strahle Licht und Energie aus.
Ich öffne mich zum Licht. Ich ruhe erhaben in mir selbst. Meine Aufmerksamkeit kommt und geht, wie es sein muss. Ich schaue nach dem Licht.
-
Heuschrecke (salabhäsana)
Ich bin stark. Das Leben macht Spaß.
Mein Rücken ist kraftvoll und geschmeidig. Ich bin dynamisch.
Ich befreie mich von Verhaftungen. Ich bin stark.
Ich rette mich aus eigener Kraft.
Ich nehme allen Mut zusammen, um Hindernisse zu überwin den.
Mein Ziel erreiche ich durch Sammlung meines Geistes, meiner Kraft und meines Willens.
Ich überwinde meine Trägheit und erreiche eine neue Dimension.
Ich entwickle Kraft, um zu springen. Ich schaffe alles im Leben.
Ich sammle Sprungkraft für Veränderungen. Ich habe ganz starken Rückhalt.
Ich bleibe ruhig, wenn mich jemand angreift oder verletzt. Mein Wille ist stark, rein und unbesiegbar.
In vollem Bewusstsein der Schwere der Materie löse ich mich mit der Kraft meines Willens.
Diese Erde hält mich nicht.
Ich stelle mich den Herausforderungen. Ich habe Durchhaltevermögen.
Ich habe Kraft und Ausdauer in der Anstrengung. Rücken und Beine sind stark .
Ich kann fliegen.
-
Bogen (dhanuräsana)
Ich bin ausdauernd und konzentriert. Ich bin ganz leicht.
Die Energien in meinem Körper bilden einen Kreis.
Ich bin der Lenker meines Wagens, mit dem ich durch das Leben fahre.
Ich bin leistungsfähig.
Ich halte durch. Mein Wille ist stark.
Ich bin ganz entspannt und bereit für Neues. Ich spanne meinen Körper.
Mein Körper tauscht Energie über meine Extremitäten aus. Ich schaffe Verbindungen.
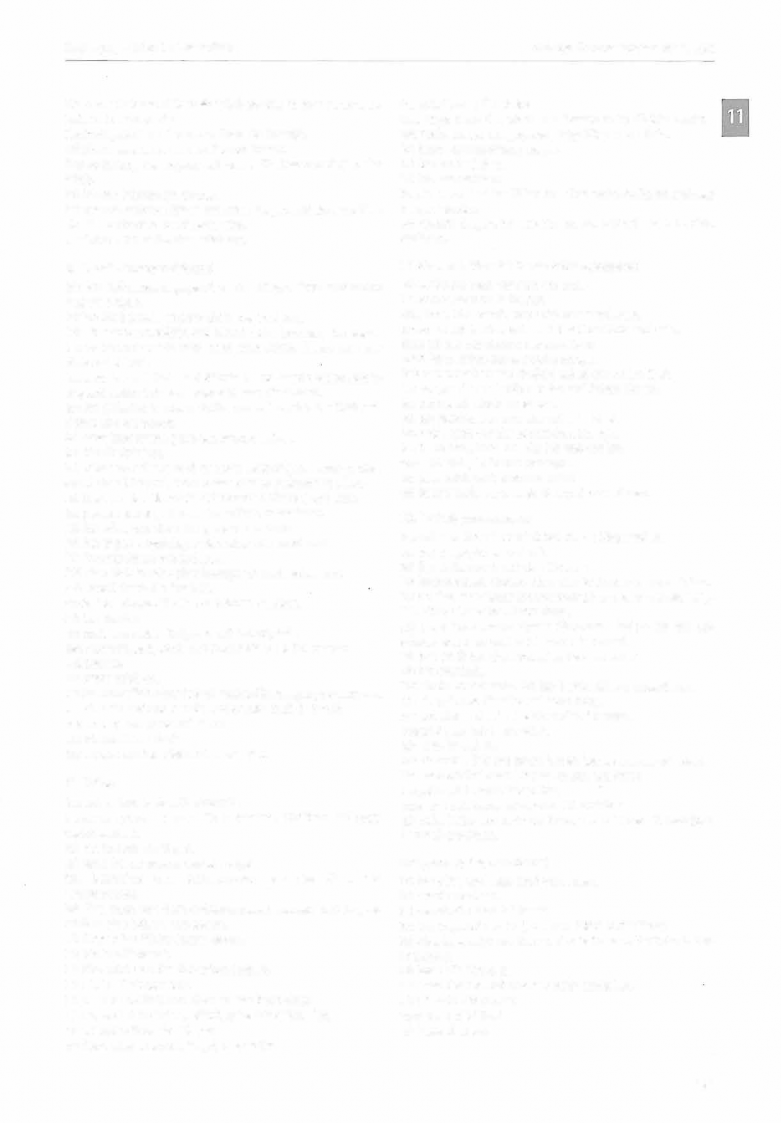
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
Die verschiedenen Teile meines Lebens und meiner Persönlich keit sind in Harmonie.
Kraftvoll gebe ich mich in den Kreis der Energie. Erhaben lasse ich mich vom Kosmos tragen.
Der Spannung des Bogens entspricht die Geschwindigkeit des Pfeils.
Ich bin ein Instrument Gottes.
Ich spanne meinen Körper wie einen Bogen, mit dem der Pfeil der Konzentration losgelassen wird.
Ich öffne mich und dehne mich aus.
-
Drehsitz (matsyendräsana)
Ich bin aufmerksam gegenüber den Dingen links und rechts meines Weges.
Meine Wirbelsäule ist aufrecht in der Drehung.
Ich bin anpassungsfähig und bleibe dabei trotzdem ich selbst. Ich drehe und wende mich nach allen Seiten, bleibe mir aber stets selbst treu.
Ich bewahre mit Stolz und Würde meine eigene Weltanschau ung und bleibe trotzdem aufgeschlossen für andere.
Ich bin gefestigt in meiner Mitte und zeige mich der Welt auf richtig und würdevoll.
Ich erweitere meine geistigen Möglichkeiten. Ich bin diszipliniert.
Ich höre und schaue nach anderen Meinungen, bewahre aber ein starkes Rückgrat, habe meine eigene Meinung zu allem.
Ich lasse los. Ich bin gestreckt zwischen Himmel und Erde. Ich passe mich an, ohne meine Würde zu verlieren.
Ich bin offen und stark. Ich gebe und nehme.
Ich bin anpassungsfähig, bleibe aber mir selbst treu. Ich kommuniziere mit anderen.
Mit dem Halt in mir selbst bewege ich mich sicher und würdevoll durch die Dualität.
Aufrecht entsage ich allen weltlichen Freuden. Ich bin flexibel.
Ich meistere meine Aufgaben mit Leichtigkeit.
Mit Aufrichtigkeit, Stolz und Flexibilität finde ich meinen Lebensweg.
Ich passe mich an.
Ich bin beweglich, ohne jedoch meine Überzeugung zu verlieren. Ich bin aufrecht und gerade und wende mich dennoch anderen zu und gehe auf sie zu.
Ich bin rund und stark.
Ich schaue zurück: Mein Leben war gut.
-
Krähe
Ich habe einen festen Standpunkt.
Dennoch spüre ich auch die schwachen Einflüsse auf mein Gleichgewicht.
Ich bin frei wie ein Vogel.
Ich kann frei schweben wie ein Vogel.
Ich betrachte den Mikrokosmos aus der Sicht des Makrokosmos.
Ich löse mich von dem erdgebundenen Denken und begebe mich in eine höhere Dimension.
Ich fliege allen Nichtigkeiten davon. Ich bin konfliktbereit.
Ich löse mich von der Erdverbundenheit. Ich bin im Gleichgewicht.
Ich schaue die Welt von oben an, bin Betrachter.
Ich bin auf mich allein gestützt, gebe mir selbst Halt. Ich schwebe über den Dingen.
Ich habe eine erhabene Vogelperspektive.
Geistige Entsprechungen der äsanas
Ich behalte den Überblick.
Das Körperliche überwindend schwebe ich im Gleichgewicht. Die Kraft, die Du uns gegeben, trägt Körper und Geist.
Ich kann Verantwortung tragen. Ich bin ausgeglichen.
Ich bin konzentriert.
So wie ich auf beiden Füßen im Leben stehe, stehe ich auch auf beiden Händen.
Ich möchte fliegen. Ich möchte den Kontakt mit der Erde nicht verlieren.
-
Stehende Vorwärtsbeuge (päda-hastäsana)
Ich verbeuge mich vor dem Göttlichen. Ich verbeuge mich in Demut.
Wer hoch hinaus will, muss tief verwurzelt sein.
Ich stehe mit beiden Beinen fest auf der Erde und weiß, dass ich nur mit Geduld wachsen kann.
Mich kann nichts aus der Ruhe bringen. Erdverbundenheit und Geduld geben mir innere Kraft. Ich beuge mich geduldig vor den weltlichen Dingen. Ich bin bereit, etwas zu lernen.
Ich bin geschlossen und eins mit mir selbst. Ich neige mich vor der kosmischen Energie. Ich fasse Dich, Erde, aus der ich geformt bin. Gruß Dir Gott, in Demut gebeugt.
Ich lasse mich vertrauensvoll fallen.
Ich beuge mich, ohne mein Rückgrat zu verlieren.
-
Dreieck (tri-konäsana)
Energie und Freude durchfluten meine Körperzellen. Ich bin ausgeglichen und rein.
Ich bin in Harmonie mit dem Kosmos.
Ich kann zur Seite drehen, ohne den Blick nach vorne zu richten. Ich bin fest mit Mutter Erde verwurzelt und kann mir alle Mög lichkeiten dieser Welt betrachten.
Ich bereichere meine eigene Sichtweise, indem ich mir an schaue, was links und rechts von mir passiert.
Ich löse mich von den normalen Denkschemata. Ich bin elastisch.
Jede Seite ist mir recht. Ich bin bereit, alles zu akzeptieren. Ich bin geöffnet für alles auf jeder Seite.
Ich erweitere mich in alle Himmelsrichtungen. Bes_tärkt gehe ich in die Welt.
Ich gehe ins Leben.
Ich bin stabil. Zeit und Raum haben keinen Einfluss auf mich. Das, was wir loslassen können, macht uns freier.
Ich gebe mich neuen Ideen hin.
Ich sehe mein Leben aus neuen Blickwinkeln.
Ich habe festen Kontakt zum Boden und will das Höchste (den Himmel) erreichen.
Entspannungslage (saväsana)
Ich bin offen und löse mich vom Alten. Ich werde wachsen.
Ich verarbeite alles Erfahrene.
Ich bin losgelöst und frei, voll von Glück und Wärme.
Ich überlasse mich der Erde und erhalte neue Kraft durch Ent spannung.
Ich lasse alle Dinge los.
Ich lasse das neu Erfahrene in mich einfließen. Ich bin voller Vertrauen.
Auch im Tod ist Kraft. Ich lasse alles los.
181
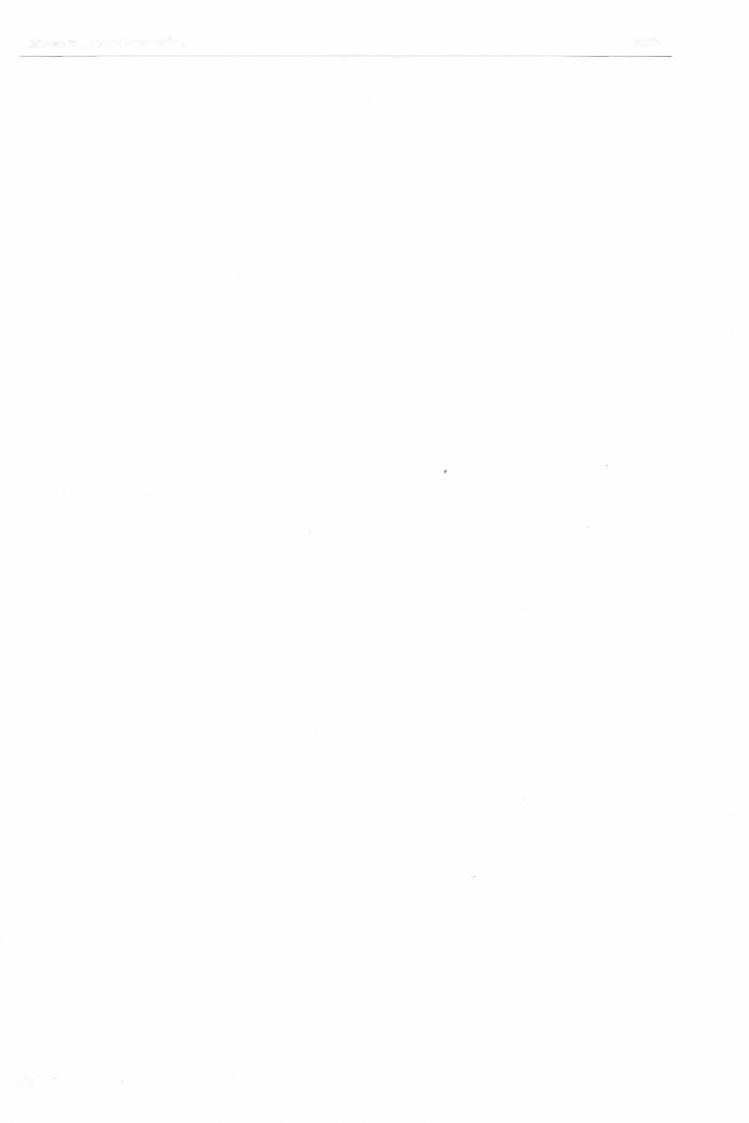
Hat ha-yoga-Unte rrichtstech ni ken Notizen
182
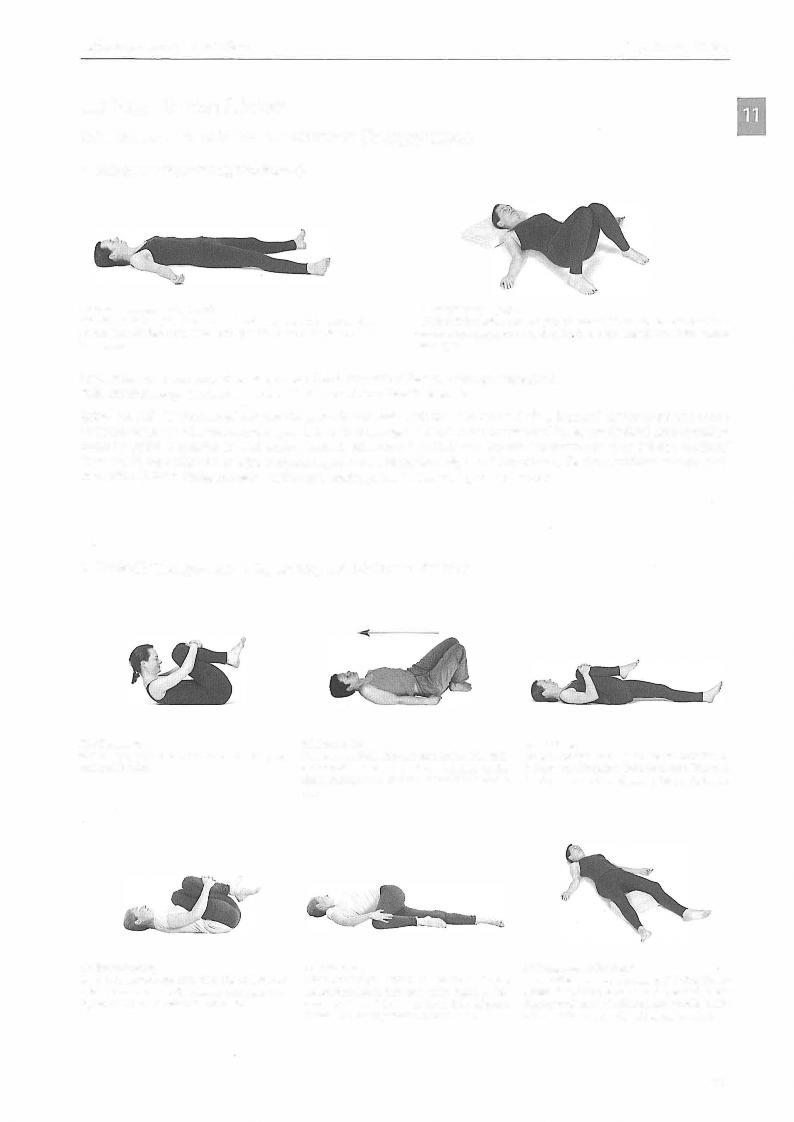
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken Yoga für den Rücken
-
-
Yoga für den Rücken
-
Nähere Betrachtung der einzelnen Übungsgruppen
-
-
-
Anfangsentspannung (savasana)
-
Entspannungslage (.s'avasano) 1.2 Entspannungslage (.s'avosono)
Auf den Rücken legen. Fersen auseinander geben. Arme neben den Körper, Handflächen nach oben. Evtl. gerollte Decke oder Kissen unter Knie legen.
Auf den Rücken legen. Knie beugen, Fußsohlen auf den Boden. Knie oder Füße entweder zusammen oder auseinander Evtl. Decke oder flaches Kissen unterm Kopf legen.
Körperteile von unten nach oben anspannen, 5 Sek. angespannt lassen, loslassen, nachspüren. Tiefe Bauchatmung. Einatmen, Bauch hebt sich. Ausatmen, Bauch senkt sich.
Spüre, wie sich das Sonnengeflecht und der ganze Bauchbereich mit neuer Energie aufladen. Eventuell kannst du dir eine Sonne im Bauch vorstellen oder wiederholen: ,,Ich lade mein Sonnengeflecht mit neuer Energie auf." Du kannst dir dabei Licht vorstellen und/oder geistig wiederholen: ,,Ich schicke meinen Rückenmuskeln Licht und Energie." Verharre vor allem bei den Muskeln/ Organen, die besonders viel Energie/Entspannung brauchen. Finde deine eigenen Affirmationen, die das ausdrücken, was du errei chen willst: ,,Meine Rückenmuskeln werden ganz stark", ,,Mein Nacken wird ganz entspannt."
-
-
Krokodilsübungen zur Entspannung der Rückenmuskulatur
-
Rückenrolle 2.2 Salamander
-
Knie beugen, Kopf heben, Hände um die Knie, vor Knie beugen, Fußsohlen auf dem Boden. Mit Rück- und zurück rollen. wärtsschritten Rücken nach hinten schieben. Parallel dazu Schultern und Schulterblätter mitwandern las
sen.
-
-
Kniebeuge
Ein Knie beugen. Mit Händen um das Knie fassen, Knie zur Brust hinziehen. Tief atmen, beim Einatmen Bauch gegen den Oberschenkel drücken. Wechseln.
-
Kreuzstreckung
Beide Knie beugen, ein Knie über das andere. Mit beiden Händen um das Knie fassen, das weiter weg ist, und es zur Brust hinziehen. Wechseln.
-
Drehübung
Linkes Knie beugen. Linken Fuß auf Innenseite des rechten Knies legen. Knie nach rechts legen. Rechte Hand auf linkes Knie legen. Nach links schauen. Rechtes Bein bleibt gestreckt. Andere Seite.
-
Entspannung (fovasono)
-
Auf den Rücken legen, entspannen. Bei einer Hyper lordose (Hohlkreuz) oder einem empfindlichen Rü cken generell ist es oft hilfreich, eine gerollte Decke oder zwei Kissen unter die Kniekehlen zu geben.
183
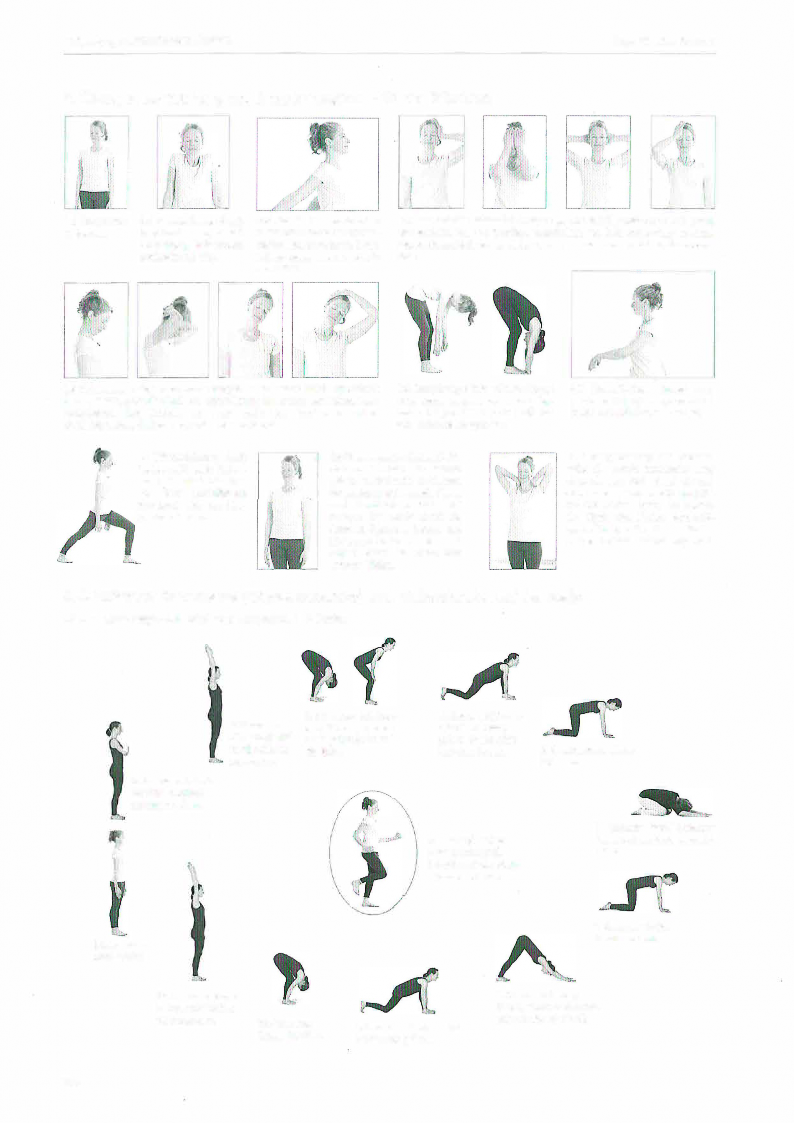
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken Yoga für den Rücken
-
Übungen zur Stärkung und Entspannung von Hals und Schultern
-
Entspannen im Stehen.
-
Schulterübung: Schul tern hochziehen, 5 Sek. anspannen, lockerlassen, nachspüren. 3 Mal.
-
Schulterübung: Schulter blätter nach hinten zusammen ziehen, fest anspannen, 5 Sek. halten. lockerlassen, nachspü ren. 3 Mal.
-
Isometrische Halsmuskelübungen: Mit der Hand jeweils 10-20 Sek. gegen den Kopf drücken. Mit dem Kopf gegenhalten. Von links, von rechts, von vorne (gegen die Jochbeine), von hinten und diagonal von vorne rechts und von vorne links.
\ 1
l
-
Halsdehnung: Kopf nach vorne hängen lassen. Passiv durch Schwerkraft dehnen lassen, oder die Hände zur Unterstützung hinter dem Kopf falten, Arme lockerlassen, das Gewicht der Arme zieht den Kopf nach unten. 10-15 Sek. halten. Ähnlich nach links und nach rechts.
-
Rumpfbeuge: Knie gebeugt. Rumpf nach vorne beugen. Arme und Kopf locker hängen lassen. 20-30 Sek. hal ten. Hals wird langgezogen.
-
Rumpfdrehen: Rumpf nach rechts und links drehen. Arme dabei locker baumeln lassen. 6-10 Mal.
-
Wadendehnung durch Ausfallschritt nach hinten: Jede Seite 10-20 Sek. hal ten. Über Muskelketten entspannt sich anschlie ßend der Nacken.
-
Entspannen im Stehen: Ruhig stehen. Gewicht auf Fersen geben. Wirbelsäule aufrichten. Konzentriere dich auf die Finger und Handflächen. Ziehe die Energie der Hände durch die Arme zu Schultern, Nacken und Hinterkopf. Ähnlich von den Fuß sohlen durch die Beine zum unteren Rücken.
-
Energetisierung des Nackens: Reibe die Hände aneinander oder atme ein paar Mal schnell ein und aus. Gib die Hände rechts und links auf den Nacken. Spüre die Energie der Hände den Nacken durchströ men. Ähnlich mit unterem Rücken oder beliebigem anderen Körperteil.
-
-
Aufwärmen: Sonnengruß (sürya-namaskara) oder Gehen/Laufen auf der Stelle
-
Sonnengruß: ruhige, aber doch flüssige Bewegungen. 4 -12 Runden.
f_
-
AUSATMEN: Hände vor dem Brustkorb zusammengeben.
J
-
EINATMEN: Arme hoch und Schulterblätter zusammen.
-
AUSATMEN: Knie beu gen, Hände neben die Füße geben (oder auf die Knie).
-
EINATMEN: Rechtes Bein nach hinten geben. Rechtes Knie auf dem Boden.
-
-
Gehen/Laufen: Statt Sonnengruß,
2-5 Min. auf der Stelle gehen oder laufen.
-
-
ATEMANHALTEN: Linkes Knie dazu.
-
AUSATMEN: Gesäß Richtung Fersen geben. Arme gestreckt lassen.
12. AUSATMEN: Arme senken.
-
EINATMEN: In den Vierfüßlerstand.
11. EINATMEN: Arme heben, Schulterblät
ter zusammen. 10. AUSATMEN: 9. EINATMEN: Rechten Fuß
-
AusATMEN: Becken heben, Fersen nach unten geben (oder wie Nr. 5).
Linken Fuß dazu.
nach vorne geben.
184

Hatha-yoga-U nte rrichtstechniken Yoga für den Rücken
-
Übungen zur Stärkung der Bauchmuskulatur
-
Beinheben: Auf den Rücken legen. Rechtes Bein heben. Bein oben halten. langsam senken. Wechseln.
J
5.5 Bauchübung: wie 5.4, aber bei bei den Variationen die Füße heben.
-
Beinheben: Beine abwechselnd 4 Sek. lang heben und senken. Ein atmen, heben. Ausatmen, senken.
l
5.6 Schräge Bauchmuskelübung: Knie anwinkeln und Füße heben. Hände am Hinterkopf. Linke Brusthälfte und rechte Beckenhälfte anheben. Wech seln.
VARIATION: Füße auf dem Boden. Linke Brusthälfte anheben, Hände Richtung rechtes Knie, tief atmen. Wechseln.
-
-
Grundspannung Rückenlage: Len denwirbelsäule in den Boden drü cken, dabei Bauchmuskeln einsetzen. Dann die Zehen und Fußrücken anhe ben, Fersen in den Boden drücken.
5.7 Schräge Bauchmuskelübung: Rechte Hand von vorne innen gegen das linke Knie drücken. Mit Knie ge genhalten. Wechseln.
VARIATION: Gestrecktes Bein anwinkeln.
-
Bauchübung: Lendenwirbelsäule in den Boden drücken. Kopf und Brust etwas heben. Hände hinterm Kopf, Ellenbogen so weit wie möglich ausei nander geben, tief atmen.
-
VARIATION: Hände Richtung Knie.
�-
5.8 Drehübung als Gegenstellung zum Entspannen: Beide Knie nach rechts legen, Kopf nach links. Wechseln,
-
-
-
Übungen zur Dehnung der Beinmuskeln
Zweck: Die Dehnung der Beine entlastet die Lendenwirbelsäule und entspannt reflektorisch den Nacken.
-
Beinstreckung: Auf den Rücken legen. Rechtes Bein gestreckt heben. Mit beiden Händen an Fuß, Knöchel, Wade oder hinter den Oberschenkel fassen und Bein zum Rumpf hin ziehen. Kopf unten lassen. 20-30 Sek. halten. Wechseln. VARIATION: Gurt oder Handtuch zu Hilfe nehmen.
6.3 Ganze Vorwärtsbeuge (pascimottänäsana): Wie 6.2, aber beide Beine nach vorne gestreckt. Wichtig: Lendenwirbelsäule gerade. In Kreuz und Rücken sollten es sich angenehm anfühlen. Dafür die Knie evtl. leicht anbeugen.
-
Halbe Vorwärtsbeuge Uänu-s,rsäsana): Aufsetzen. Rechtes Knie beugen. Linkes Bein ausstrecken, An linken Fuß, Knöchel, Wade oder Knie fassen. Wenn nötig, Yogagurt oder Handtuch benutzen und um den Fuß winden. Ruhig halten. Dehnung in Wade, hinter Knie und Oberschenkel spüren, weniger im Kreuz, Rücken oder Nacken. Normalerweise ist der Nacken locker, Kopf hängt hinunter (ohne Abb.). Wenn es für den Rücken angenehmer ist, kannst du den Nacken gerade und den Kopf (wie auf der Abb.) oben behalten. 30-60 Sek. verharren. Wechseln.
-
6.4 Wadendehnung: Rechtes Bein strecken. Mit beiden Händen linken Fuß fas sen. Fuß zum Oberkörper ziehen. Linkes Knie kann auch leicht angewinkelt sein. Wadendehnung spüren. 10-15 Sek. halten. 5-10 Sek. locker lassen. Noch 2 Mal wiederholen. Bein ausstrecken. Entspannung in Wade und Nacken spüren. Wechseln. Eventuell auch mit beiden Füßen, Knie bleiben leicht angewinkelt.
185
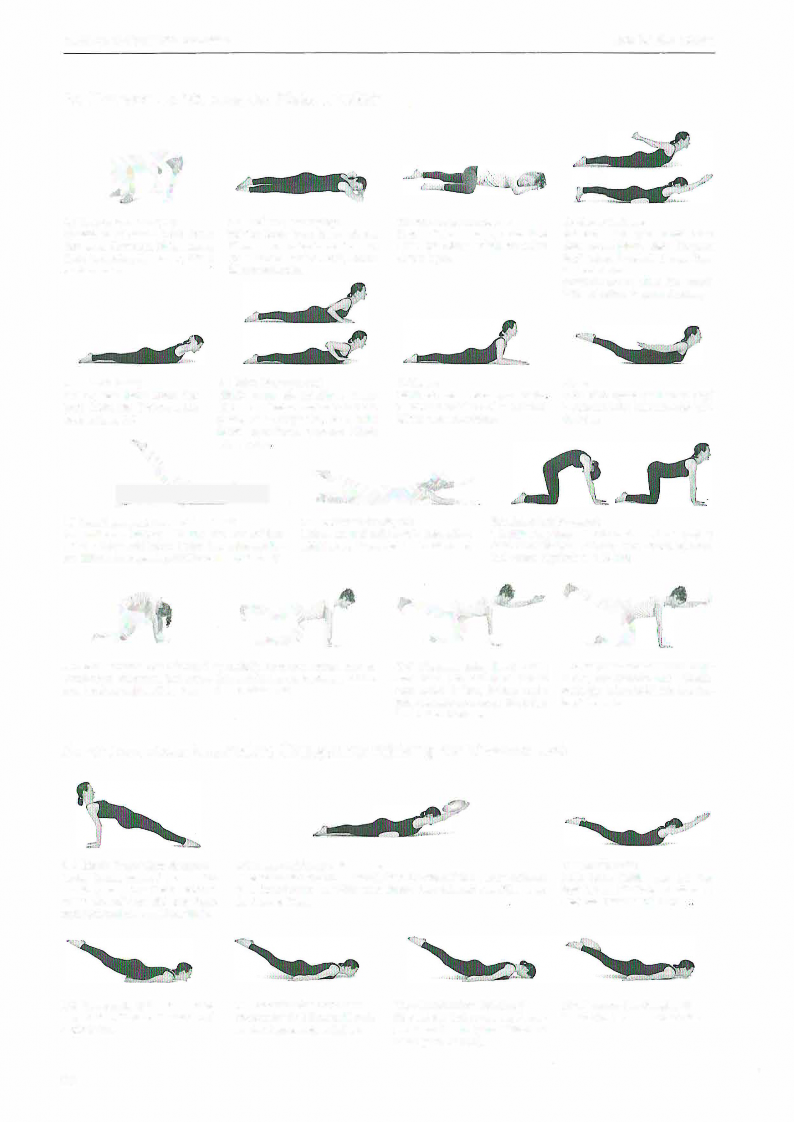
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken Yoga für den Rücken
7a. Übungen zur Stärkung der Rückenmuskeln
.lflllilkJ Jtj)
-
-
Tisch (catu�-päda-pftha)
Auf den Boden setzen. Hände hinter das Gesäß. Einatmen, Hüften heben. 10-30 Sek. halten. Ausatmen, Hüften wieder senken.
-
-
Kobra-Vorübung
Wie 7.4, aber Hände hinter dem Kopf. Stärkt die Rückenmuskeln noch mehr als 7.4
-
-
-
Bauchentspannungslage
-
Auf den Bauch legen, Kissen mit den Händen machen, Kopf zur Seite legen, große Zehen berühren sich, Fersen fallen auseinander.
-
-
Kobra (bhujarigasana)
-
Hände unter die Schultern, Hand flächen am Boden. Kopf und Brustkorb heben, Gesäß anspannen, mit Händen leicht unterstützen. VARIATION: Hände
7.3 Bauchentspannungslage
Rechtes Knie angezogen, rechte Hand unter linke Wange. Linken Arm neben Körper legen.
7.7 Sphinx
Stärkt die obere Rückenmuskulatur Ellenbogen auf den Boden. Schulter blätter zusammenziehen.
7.4 Kobra-Vorübung
Auf den Bauch legen. Hände hinter dem Gesäß falten. Beim Einatmen Kopf heben, Brustkorb heben. Even tuell wiederholen.
VARIATION: Kissen unter den Bauch, Füße aufstellen. Arme ausstrecken.
-
-
Vogel
Arme nach hinten ausstrecken. Kopf, Hände und Beine heben. 1-3 Mal wie derholen.
-� he�a
:�::.
-
Halbe Heuschrecke (ardha-salabhäsana) 7.10 Boot-Variation diagonal 7.11 Katze (marjary-äsana)
-
Arme unter den Körper geben. Kinn oder Stirn auf dem Boden. Rechtes Bein heben. Linkes Bein entspannt las sen, Hüften nicht verdrehen. 10-20 Sek. halten. Wechseln.
Linken Arm und rechtes Bein heben, Kopf leicht heben, Hals gerade lassen. Wechseln.
Vierfüßlerstand (dynamisch). Ausatmen, Lendenwirbel säule hochschieben, Kinn zur Brust. Einatmen, Brust korb senken, Kopf heben. 6-12 Mal.
,, r
--�-, -.J') I\:_' - -��..!..!,:,.� l .,...
"�......:. 1
l' /
t
\, 1
_;J
�
-
-
Katze-Variation: Vierfüßlerstand (dynamisch). Ausatmen, rechtes Knie zur Stirn bringen. Einatmen, Kopf heben, Bein nach hinten ausstrecken, leicht he ben. 6 Mal mit rechtem Bein. Dann 6 Mal mit linkem Bein.
-
Diagonale Katze: Rechtes Bein und linken Arm inkl. Hand parallel zum Boden heben. (Besser noch: Fußsohle zeigt nach oben). 10-20 Sek. lang halteri. Wechseln.
-
Diagonale-Katze-Variation: Hand fläche, Schädeldecke und Fußsohle senkrecht halten.10-20 Sek. lang hal ten. Wechseln.
7b. Weitere etwas forderndere Übungen zur Stärkung der Rückenmuskeln
-
Schiefe Ebene (pürvottanasana) 7.16 Kobra-Variation (bhujarigasana) 7.17 Boot-Variation
-
Becken heben, sodass der ganze Kör per eine gerade Linie bildet. Kopf ent weder wie auf dem Bild oder leicht nach hinten geben, parallel zur Hüfte.
Gewicht auf die Hände (z. B. Kissen), dabei die Füße auf dem Boden festhalten (z. B. durch Partner oder Füße unter Heizung bzw. Schrank) oder Füße gegen die Wand drücken.
Beide Beine, beide Arme und den Kopf heben. Für Fortgeschrittenere: Gewichte auf Füße und Hände .
7.18 Heuschrecke (salabhasana) Beide Beine heben. 10-20 Sek. halten. Evtl. wiederholen.
186
-
-
Heuschrecken-Variation 1 Decke unter die Hüften und Bauch, um das Kreuz gerade zu halten.
-
Heuschrecken-Variation 2 7.21 Heuschrecken-Variation 3 Stirn auf den Boden, um den Nacken Gewicht (z. B. Kissen) auf die Füße. gerade zu halten. (Kann auch ohne
-
Decke geübt werden).
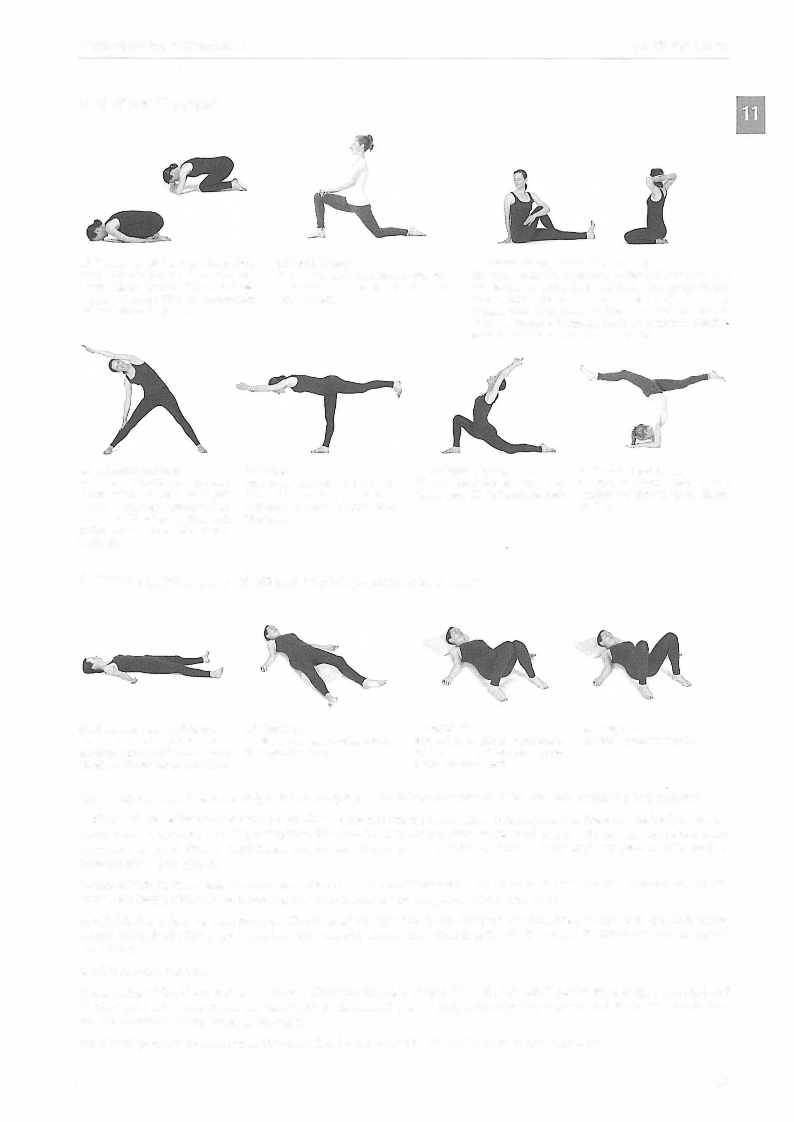
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken Yoga für den Rücken
-
Weitere Übungen
1
-
Stellung des Kindes (garbhäsana, bä/ä 8.2 Psoasdehnung 8.3 Halber Drehsitz (ardha-matsyendräsana)
sana). Auf die Fersen setzen. Stirn zum Boden. Rücken bewusst dehnen und ent spannen. VARIATION: Stirn auf übereinander gelegte Hände oder Fäuste.
Rechtes Bein nach vorne. Knie parallel zum Fußgelenk. Hüfte senken. 10-30 Sek. hal ten. Wechseln.
Hinsetzen. Linkes Bein ausstrecken. Rechten Fuß links neben das linke Knie geben. Rechte Hand rechts hinter dem geraden Rücken auf den Boden geben. Linken Arm um das rechte Knie legen. Drehen, ohne nach vorne zu beugen. 30-120 Sek. halten. Wechseln. VARIATION: Fersensitz. Hände am Hinterkopf. Oberkör per nach rechts drehen. Ellenbogen nach hinten geben.
-
-
Dreieck (tri-koQäsana)
Beine etwa 100-120 cm weit ausei nander geben. Einatmen, linken Arm heben. Ausatmen, ausgestreckten Arm samt Oberkörper seitlich nach rechts neigen. 30-60 Sek. halten. Wechseln.
-
Waage
Arme nach vorne, ein Bein nach hin ten ausstrecken. Bein, Rumpf, Arme und Kopf in einer geraden Linie. Wechseln.
-
Halbmond (aiijaneyäsana)
Wie 8.2, dabei aber die Arme nach hinten geben (für Fortgeschrittenere).
-
Skorpion (vrscikäsana)
-
Variation im Spagat. Dehnt die Psoas muskeln und hält den oberen Rücken flexibel.
-
-
-
Tiefenentspannung in saväsana (Rückenlage, wörtl. ,,Totenstellung" )
-
Entspannungslage in saväsana Auf den Rücken legen. Beine etwas auseinander Arme neben den Körper, Handinnenflächen zeigen nach oben.
-
VARIATION 1
Ein Kissen oder eine gerollte Decke unter die Knie geben.
-
VARIATION 2 9.4 VARIATION 3
Knie gebeugt, Fersen auseinander, Knie leicht auseinander geben. Knie zusammen, Decke oder flaches
Kissen hinter den Kopf.
Auf den Rücken legen in eine der obigen Entspannungslagen. Die Entspannung dauert 10-20 Min. und geschieht in fünf Schritten:
-
Körperteile der Reihe nach von unten nach oben anspannen: Erst die Beine heben, 5Sek. anspannen, loslassen, nachspüren. Becken heben, 5Sek. anspannen, loslassen, nachspüren. Brust heben ... Arme heben, dabei Fäuste machen ... Gesicht zur Nasenspitze hin zusam menziehen ... Mund öffnen, dabei Zunge rausstrecken, Augen auf, nach hinten schauen ... Dann Kopf vonSeite zu Seite drehen. Bewegungslos liegen bleiben.
-
Autosuggestion: Körperteile von unten nach oben bitten, sich zu entspannen: ,,Ich entspanne die Füße (dreimal wiederholen). Ich ent spanne die Waden (dreimal). Ich entspanne die Oberschenkel ... "So den ganzen Körper durchgehen.
-
Visualisierung:Stelle dir eine wunderschöne Gegend vor, irgendwo in der Natur, wo du dich ganz geborgen und ganz wohl fühlen kannst. Male dir alle Einzelheiten aus. Die Natur um dich herum, den Himmel, spüre die Erde unter dir. Fühle dich eins mit deiner Umgebung.
-
Stille: Eeinfach Genießen.
-
Affirmation: Wiederhole eine oder mehrere Affirmationen: ,,Mein Rücken fühlt sich ganz wohl", ,,Meine Bandscheiben sind stark und flexibel", ,,Ich bin in Harmonie mit mir selbst", ,,Ich werde meine Aufgabe freudig und erfolgreich erledigen" o. ä. Finde das, was am ehes ten das ausdrückt, was du erreichen möchtest.
-
-
Aus der Entspannung kommen: Atme tief durch.Strecke und räkele dich.Setze dich (oder stehe) langsam auf.
187
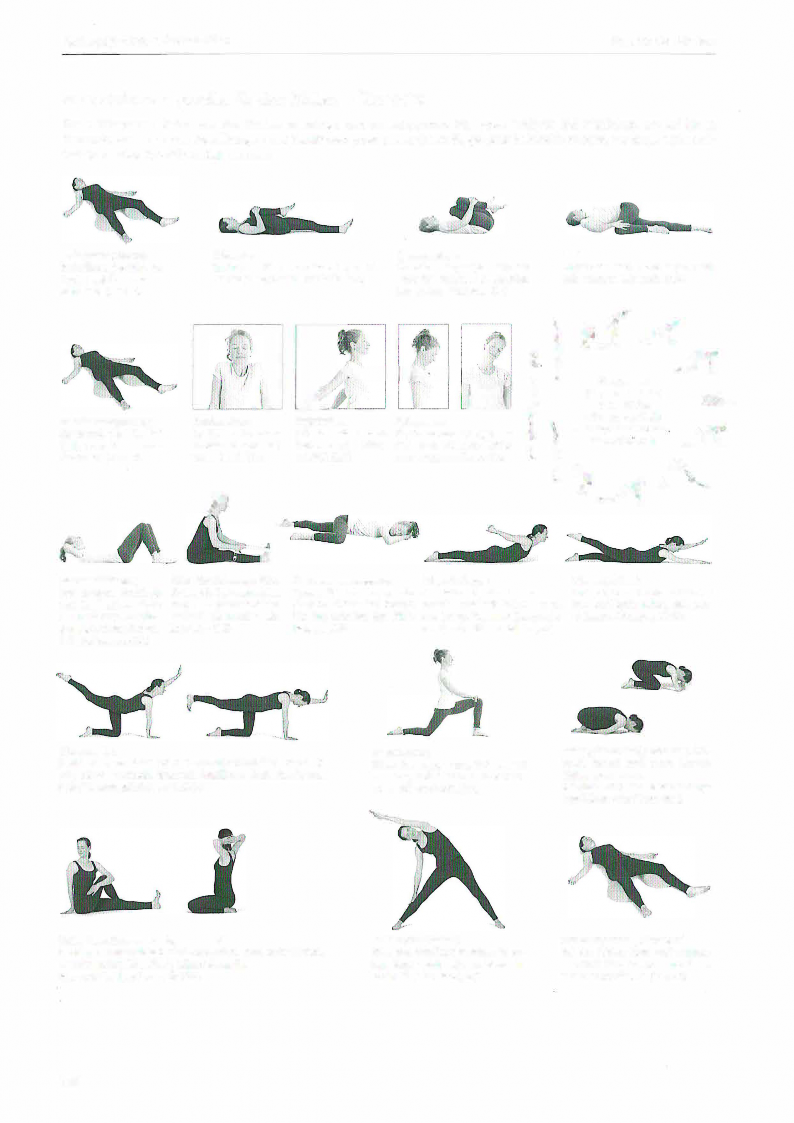
Hatha-yoga-U nterrichtstechniken Yoga für den Rücken
-
-
-
Einfache Yogareihe für den Rücken - Übersicht
Eine wirkungsvolle Reihe, um den Rücken zu stärken und zu entspannen. Für gutes Rückgrat und Flexibilität. Die Zahlen in Klammern geben an, wo diese Übungen und Variationen unter 11.7.1 (S.183 ff.) genauer behandelt werden. Für diese Reihe soll test du dir etwa 30-45 Min. Zeit nehmen.
Anfangsentspannung Kniebeuge
Kreuzstreckung
Drehübung
in saväsana 1-5 Min. Bei Bedarf mit Kissen unter den Knien. (1.1-1.2)
Ein Knie mit Händen zur Brust ziehen. 5-8 Atemzüge lang halten. Wechseln. (2.3)
übereinandergelegte Knie zur Brust hin ziehen. 5-8 Atemzüge lang halten. Wechseln. (2.4)
i
Linkes Knie nach rechts legen. Nach links schauen. Wechseln. (2.5)
�l �J· ,A
.6- �"
r.if
•
Sonnengruß
(sürya-namaskiira)
-�C
.....,_
Zwischenentspannung
(saväsana). 1-5 Min. Bei
Schulterübung
Im Stehen Schultern
Schulterübung
Schulterblätter nach
L .. ,
Halsdehnung
Kopf nach vorne hängen las
4-12 Runden . :· -�...
l
;'
1 oder auf der Stelle
Gehen/Laufen 2- 5 Min � �
_•
Bedarf mit Kissen unter
den Knien. (l.1-1.2)
hochziehen, 5 Sek. hal
ten. 1-3 Mal. (3.2)
hinten. 5 Sek. halten.
1-3 Mal. (3.3)
sen. 10-15 Sek. Das Gleiche
nach rechts und links. (3.5)
�!- �l
wm A"Fwa,mee ,.J [
.
') A_
...A_
,�
"'"'� "
l.;._ •.•
Bauchmuskelübung
Knie beugen, Brustkorb und Kopf heben. Hände am Hinterkopf. Ellenbo gen nach hinten. Halten. 5-12 Mal atmen. (5.4)
r'
. J
Halbe Vorwärtsbeuge Uonu s1r5iisana). Bei gestrecktem Rücken zu einem Fuß fassen. Eventuell mit Band. 1 Min. jede Seite. (6.2)
Bauchentspannungslage Rechtes Knie angezogen, rech te Hand unter linke Wange. Vor und zwischen den Rück beugen. (7.3)
Kobra-Vorübung
Gefaltete Hände hinter dem Gesäß. Brustkorb heben. 10-30 Sek. halten. VARIATION: Kissen unter den Bauch, Füße aufstellen. (7.4)
Diagonales Boot
Linken Arm und rechtes Bein he ben, Kopf leicht heben, Hals gera de lassen. Wechseln. (7.10)
Diagonale Katze
Rechtes Bein und linken Arm parallel zum Boden heben. 10-20 Sek. lang halten. Wechseln. VARIATION: Handfläche, Schädeldecke und Fußsohle senkrecht halten. (7.13,14)
Halber Drehsitz (ardha-matsyendräsana)
Rechten Fuß links neben das linke Knie geben. Nach rechts drehen. Gerader Rücken. 30-120 Sek. halten. Wechseln.
VARIATION: Aus dem Fersensitz. (8.3)
188
Psoasdehnung
Linkes Bein nach vorne. Knie parallel zum Fußgelenk halten. Hüfte senken. 10-30 Sek. Wechseln. (8.2)
Dreieck (tri-koniisana)
Füße eine Beinlänge auseinander ge ben. Nach rechts beugen. Wechseln. 30-60 Sek. jede Seite. (8.4)
Stellung des Kindes (garbhiisana, bii/ä sano). Kniend nach vorne beugen. Rücken entspannen.
VARIATION: Stirn auf übereinanderge legte Hände oder Fäuste. (8.1)
Tiefenentspannung (soviisono)
Auf den Rücken legen und entspan nen. 8-15 Min. Eventuell mit Kissen unter den Kniekehlen. (9.1-9.4)
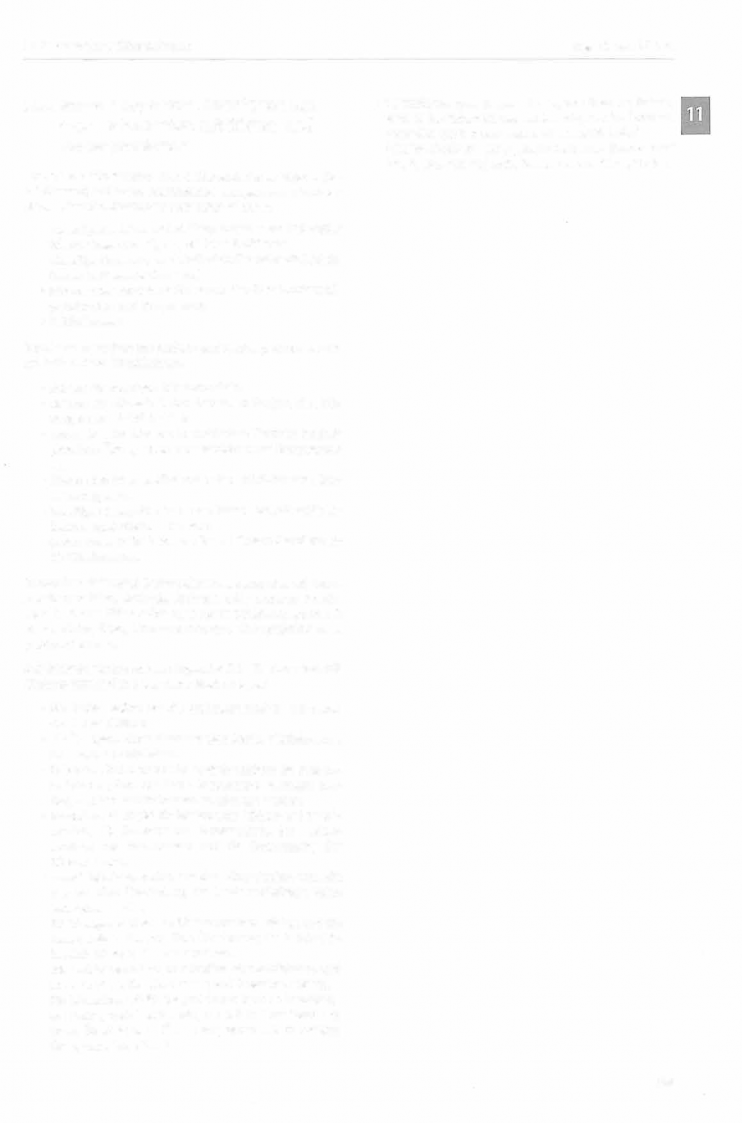
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
-
Anmerkungen zum Unterrichten von yoga für Menschen mit Rücken- und Nackenproblemen
Ursache von Rückenschmerzen (siehe auch das im Physiologie teil Gesagte) sind meist Muskelverspannungen. Diese kommen oft aus einer Kombination verschiedener Faktoren:
-
ungenügende Muskelentwicklung wegen mangelnder oder falscher bzw. einseitiger sportlicher Betätigung
-
einseitige Belastung am Arbeitsplatz (Schreibtischtätigkeit, Heben in Pflegeberufen usw.)
-
privater oder beruflicher Stress und damit verbundene all gemeine An- und Verspannung
-
Fehlhaltungen
Yoga kann Menschen mit Rücken- und Nackenproblemen sehr gut helfen. Denn Yogaübungen:
-
stärken die wichtigen Rückenmuskeln.
-
dehnen die Muskeln in den Beinen, im Nacken, die Hüft beuger und die Wirbelsäule.
-
haben den Charakter von isometrischen Übungen (statisch gehaltene Übungen), was ausgezeichnet zur Entspannung ist.
-
fördern das Körpergefühl und helfen, mit Schmerzen bes ser umzugehen.
-
beseitigen Energieblockaden und lassen den prär:,a (die Le bensenergie) wieder gut fließen.
-
geben neues Selbstbewusstsein und fördern das allgemei- ne Wohlbefinden.
In manchen Fällen sind Rückenschmerzen verbunden mit Band scheibenvorfällen, Arthritis, Arthrose oder anderen Proble men. In diesen Fällen sollte yoga nur in Zusammenarbeit mit einem Orthopäden, Krankengymnasten, Chiropraktiker o. ä. praktiziert werden.
Auf folgende Punkte ist beim Yogaunterricht für Menschen mit Rückenbeschwerden besonderer Wert zu legen:
-
Die Schüler sollten nur die Stellungen machen, bei denen sie sich wohlfühlen.
-
Die Übungen sollten gleichermaßen Stärke, Flexibilität und Entspannung entwickeln.
-
-
-
-
Bei akuten Problemen sollte zunächst nicht in die maxima le Dehnung bzw. maximale Anspannung gegangen wer den, sondern sehr behutsam angefangen werden.
-
Besonders wichtig ist die Stärkung der Rücken- und Bauch muskeln, die Dehnung der Psoasmuskeln, der Nacken muskeln und Beinmuskeln und die Entspannung der Rückenmuskeln.
-
Vorwärtsbeugen sollten aus den Hüftgelenken gemacht werden. Eine Überlastung der Lendenwirbelsäule sollte vermieden werden.
, Rückbeugen sollten die Rückenmuskeln stärken und die Psoasmuskeln dehnen. Eine Überlastung der Lendenwir belsäule ist auch hier zu vermeiden.
-
Man sollte vermeiden, den Schüler einzuschüchtern, und ihn vielmehr in Selbstvertrauen und Zuversicht stärken.
-
Für Menschen mit Rückenproblemen kann es besonders am Anfang vorteilhafter sein, nur 1-3 Mal pro Woche zu üben. übertriebenes Üben kann, genau v,,ie zu weniges Üben, unvorteilhaft sein.
Yoga für den Rücken
-
Da Rückenverspannungen oft komplexe Ursachen haben, kann es bei jedem Schüler anders sein, welche Übungen besonders gut tun und welche eher schädlich sind.
-
Alles im Abschnitt 11.8 „Typische Fehler und Korrekturen" (vgl. S. 192, Punkt 5) sollte besondere Beachtung finden.
189

Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
-
-
Typische Fehler und Korrekturen
-
Zu grundlegenden Übungen
-
Anfangsentspannung (saväsana)
Siehe auch 11.4 „YOGA V1DYA-Anfängerkurse".
Grundinstruktionen: ,,Lege dich auf den Rücken und entspanne dich. Gib die Fersen auseinander und die Handflächen nach oben. Einatmen, Bauch hinaus. Ausatmen, Bauch hinein."
Typische Fehler: Kopf nicht in der Mitte, Nacken durchgebo gen, Schultern zu den Ohren gezogen, Handflächen am Boden, Beine zusammen, Körper angespannt, falsche Atmung.
Korrekturen: Die Anweisungen wiederholen. Gehe hinter den Schüler und lege seinen Kopf mit den Händen sanft zur Mitte. Ziehe den Kopf nach hinten, um seinen Hals geradezumachen. Schiebe die Schultern weg von den Ohren. Korrigiere die Positionen der Hände und Füße. Hebe die Beine des Schülers ein wenig hoch und lasse sie fallen, um zu sehen, ob er ent spannt ist.
Bemerkungen: Alle Korrekturen müssen SANFT ausgeführt werden. Die Schüler/innen sollen Vertrauen entwickeln. Bleibe nicht zu lange bei einem Schüler. Die Korrektur ist keine Massage.
Atmung in der Entspannunglage: Atmung sollte tief, durch die Nase und aus dem Bauch sein. Einatmen, Bauch hinaus. Ausatmen, Bauch hinein. Lasse die Schüler ihre rechte Hand auf den Bauch legen. Sollte ein Schüler immer noch nicht kor rekt atmen, gehe zu ihm hin; lege deine Hand auf die seine und übe leichten Druck auf seine Hand aus, bis er ausatmet; dann sage ihm, er soll einatmen, und lasse im Druck nach (deine Hand liegt immer noch auf der seinen); dann ausatmen und den Druck erhöhen; einatmen und im Druck nachlassen usw. Dies fortführen, bis der/die Schüler/in es verinnerlicht hat.
-
Fersen auseinander geben. Füße nach außen fallen lassen.
t
-
Arme vom Körper weg. Finger entspannen.
190
Typische Fehler und Korrekturen
-
-
Kopf in die Mitte rücken. Nacken lang machen.
-
Schultern runter drücken.
-
-
-
-
Schnellatmung (kapäla-bhäti)
Grundinstruktionen: ,,Setze dich langsam auf zu einer Stellung mit gekreuzten Beinen. Rücken gerade, Schulterblätter zusam men. Einatmen, Bauch hinaus. Ausatmen, Bauch hinein. Einatmen, beginnen: Eins - zwei, eins - zwei ... (wiederhole dies etwa 40-100 Mal). Vollständig ausatmen - die ganze Luft ausatmen. Tief einatmen - neue, frische Energie. Vollständig ausatmen. Bequem einatmen und die Luft anhalten. Halte die Luft so lange an, wie es bequem ist. Konzentriere dich auf das Sonnengeflecht im Bauch, die Batterie deines Körpers. Fühle, wie er immer mehr und mehr aufgeladen wird. Und langsam ausatmen ... "
Typische Fehler: Schüler sitzen nicht gerade, der Rücken ist gebogen, Kopf nicht gerade. Körper zur Seite gebeugt. Falsche Atmung: Der Bauch geht beim Ausatmen hinaus anstatt hinein. Schüler heben die Schultern. Schüler atmen forciert ein. Schü ler verspannen das Gesicht und die Schultern während des Schnellatmens an. Schüler atmen durch den Mund anstatt durch die Nase. Schüler halten die Luft zu lange an.
Korrekturen: Lege deine Hände auf die Schultern und ziehe sie zurück, um den Rücken gerade zu ziehen. Hilf den Schülern, die Schultern zu entspannen. Erkläre, wie wichtig es ist, entspannt zu bleiben. Führe vor, wie der Bauch sich während kapäla-bhäti bewegt. Erkläre, dass nur die Ausatmung bewusst geschieht, die Einatmung geschieht von alleine, wenn der Bauch sich ent spannt. Erkläre, dass die Ausatmung nur ½ der Zeit der Ein atmung dauern sollte.
Der Schüler kann seine rechte Hand auf seinen Bauch legen, um die Bewegung zu überprüfen. Wenn der Schüler seine Schultern nach oben zieht, lege deine Hände darauf und drü cke sie nach unten. Du kannst auch deine Hand auf den Bauch des Schülers legen und ihn bei jeder Ausatmung hineindrü cken.
Vergewissere dich, dass die Schüler die Luft nicht zu lange an halten (Zittern, Verspannung usw.).
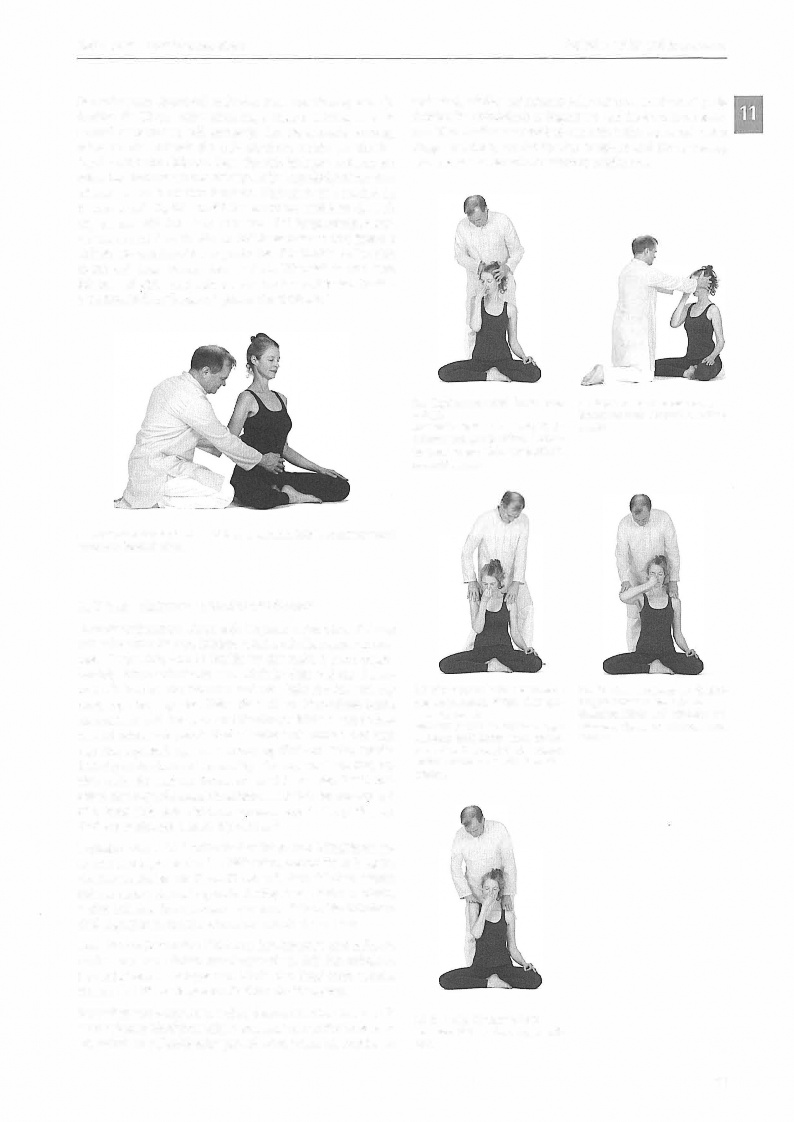
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
Bemerkungen: Unterbrich nicht den Fluss der Stunde, falls ein Schüler die Übung nicht kann. Sage diesem Schüler, dass er normal weiteratmen soll, und zeige ihm die korrekte Atmung, während die anderen die Luft anhalten. Sollte ein Schüler kapä/a-bhäti nicht können, lasse ihn sich hinlegen und sich auf seine Bauchatmung konzentrieren. Lehre kapäla-bhäti nicht zu schnell und auch nicht zu langsam. Normalerweise machst du
-
Runden mit 40, 60 und 80 Ausatmungen und lässt die Luft 45, 60 und 90 Sek. lang anhalten. Bei fortgeschritteneren Schülern machst du 60, 80 und 100 Ausatmungen und lässt die Luft 60, 90 und 120 Sek. lang anhalten. Die Schüler sollen sich zuerst auf ihren Bauch, dann auf die Wirbelsäule und zum Schluss auf äjnä- und sahasrära-cakra konzentrieren. Erwäh nen: Kapäla-bhäti bedeutet „Glanz des Schädels".
Typische Fehler und Korrekturen
weit sind, erhöhe auf 5:20:10 oder 6:24:12. Es ist wichtig, die Schüler für präf,)äyäma zu begeistern und die Vorteile zu erklä ren. Viele Anfänger verstehen den Sinn nicht. Du kannst deine Finger benutzen, um die Runden zu zählen und um zu wissen, durch welches Nasenloch geatmet werden soll.
-
Kopfhaltung schief (meist nach rechts).
KORREKTUR: Kopf zwischen die Hände nehmen und gerade richten. (Korrek tur kann vor und hinter der Schülerin gemacht werden.)
-
Kopf zu weit unten oder oben. KORREKTUR: Nach demselben Prinzip wie 3.1
2.1 HILFE: Hand auf die Hand des Schülers legen und mit jeder Ausatmung sanft gegen den Bauch drücken.
-
-
-
Wechselatmung (anuloma-viloma)
Grundinstruktionen: ,,Setze dich langsam auf zu einer Stellung mit gekreuzten Beinen. Rücken gerade, Schulterblätter zusam men. Beuge Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand (viJf.)U mudrä). Atme vollständig aus. Schließe dein rechtes Nasen loch mit dem rechten Daumen und atme links ein: 01!1 eins, 0fTI zwei, 0fTI drei, 0fTI vier. Halte die Luft an. Verschließe beide Nasenlöcher mit Daumen und Ringfinger, Rücken gerade hal ten, Schultern entspannt, Gesicht entspannt. Atme rechts aus: OfTI eins, 0fTI zwei, 0fTI drei, 0fTI vier, 0fTI fünf, 0fTI sechs, 0fTI sie ben, 0fTI acht. Atme rechts ein: 01!1 eins, 0fTI zwei, 0fTI drei, 0fTI vier. Halte die Luft an. Konzentriere dich auf den Punkt zwi schen den Augenbrauen. Visualisiere Licht. Wiederhole om gei stig. Atme links aus: OfTI eins, om zwei, 0fTI drei, 0fTI vier, 0fTI fünf, 0fTI sechs, 0fTI sieben, 0fTI acht ... "
Typische Fehler: Die Schüler halten Zeige- und Mittelfinger ge streckt und legen sie auf das äjnä-cakra, anstatt sie zu beugen. Schüler schließen die Nasenlöcher mit dem falschen Finger. Schüler setzen sich nicht gerade hin: Kopf nach rechts verdreht, rechte Schulter hochgezogen oder Rundrücken. Die Schultern sind angespannt. Schüler atmen zu schnell ein und aus.
Korrekturen: Lege deine Hände auf ihre Schultern und ziehe sie zurück, um den Rücken geradezumachen. Hilf den Schülern, ihre Schultern zu entspannen. Rücke den Kopf sanft gerade. Erkläre und führe die genaue Position der Finger vor.
Bemerkungen: Vergewissere dich, dass die Schüler dem von dir angegebenen Rhythmus folgen können. Falls 4:16:8 zu schwer ist, reduziere auf 4:8:8 oder gar auf 4:4:8. Wenn die Schüler so
-
-
Schultern sind zu weit nach vorne und hochgezogen. Rücken nicht opti mal aufgerichtet.
-
KORREKTUR: Hände auf Schultern legen und diese nach hinten, unten ziehen. Das rechte Knie sanft in den oberen Rücken zwischen die Schulterblätter drücken.
3.5 Die rechte Schulter zu hoch. KORREKTUR: Mit der Hand runter drü cken.
3.4 Schultern hochgezogen, Armhal tung ist verspannt und zu hoch. KORREKTUR: Hände auf Schultern und Ellenbogen legen und sie nach unten drücken.
191
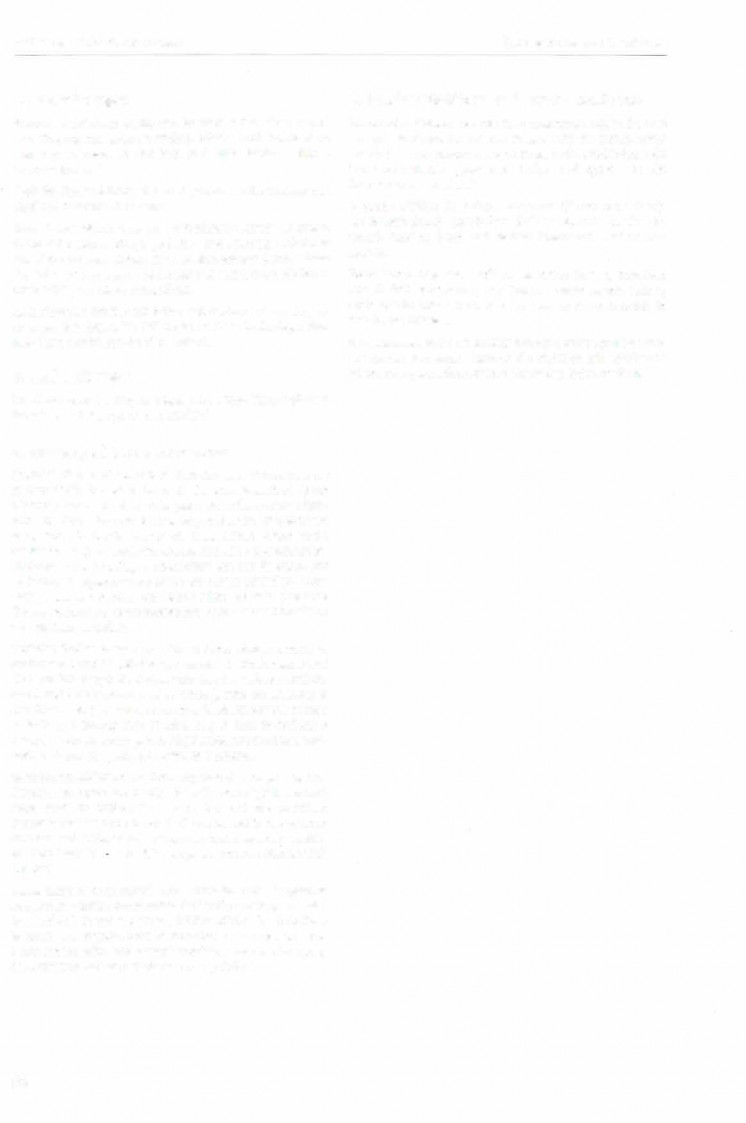
Hatha-yoga-U nterrichtstechniken
4.Augenübungen
Grundinstruktionen: ,, Setze dich langsam auf zu einer beque men Stellung mit geradem Rücken. Schaue nach rechts, ohne den Kopf zu bewegen und jetzt nach links. Rechts - links - rechts - links ... "
Typische Fehler: Schüler sitzt nicht gerade. Schüler bewegt den Kopf und nicht nur die Augen.
Korrekturen: Wiederhole die Aufforderung, gerade zu sitzen. Gehe hinter den Schüler, lege deine Hände auf seine Schultern und ziehe sie nach hinten. Erinnere den Schüler daran, seinen Kopf nicht zu bewegen. Drücke das Knie sanft gegen die Brust wirbelsäule, um diese aufzurichten.
Bemerkungen: Schüler mit Brillen sollen diese bei den Augen übungen abnehmen. Die Brillen nicht auf den Boden legen (Ge fahr, beim Korrigieren drauf zu treten).
-
Nackenübungen
Im Sitzen oder im liegen. Siehe 11.4 „YOGA V1ovA-Anfänger kurse" und 11.7 „Yoga für den Rücken"
-
Sonnengruß (sürya-namaskara)
Grundsätzliches: Gib deutliche Anweisungen. Wiederhole sie mehrmals für dich selbst, bevor du das erste Mal lehrst. Sprich nicht zu schnell und nicht zu langsam. Du solltest einen Rhyth mus vorgeben, dem die Schüler folgen können. Vergewissere dich, dass die Schüler durch die Nase atmen (wenn nötig, erkläre warum) und sage die Atmung mit den Bewegungen an. Anfänger sollen ihre Augen offenhalten, um das Gleichgewicht zu halten. Fortgeschrittene sollen die Augen schließen. Sorge dafür, dass die Schüler das ganze nicht als rein physische Übung betrachten. Sürya-namaskära bedarf einer Einstellung von fließendem Gebet.
Typische Fehler: Beugen aus dem unteren Rücken sowohl in Stellungen 2 und 11 (Rückbeuge) als auch in Stellungen 3 und 10 (Vorwärtsbeuge). Zu starkes Aufrollen des Halses in Stellun gen 4 und 9 (Halbmond) sowie 7 (Kobra). Füße auseinander in den Stellungen (sie sollten zusammen bleiben). Runder Rücken in Stellung 8 (Hund). Sehr Flexible neigen dazu in Stellung 8 (Hund) ins Hohlkreuz zu gehen. Abgehackte Bewegungen, stoß weises Atmen. Ausgestreckte Arme in 7 (Kobra).
Korrekturen: Während des Sonnengrußes sind wegen der flie ßenden Bewegung nur wenige Korrekturen möglich. Deshalb sollte man im Anfängerkurs besonders auf die wichtigen Details hinweisen und dies auch ab und zu mal in den offenen Stunden und Fortgeschrittenenkursen tun. Besonders wichtig ist, dass keine Vor oder Rückbeuge im unteren Rücken weh tun darf.
Bemerkungen: Sonnengruß kann schneller oder langsamer
-
ausgeführt werden. Sonnengruß darf ruhig anstrengend sein. Kreislauf soll angeregt werden, Schüler dürfen ins Schwitzen kommen. Da manche Schüler erwarten, dass yoga nur ent spannend ist, sollte man darauf hinweisen, dass eine Anregung des Kreislaufs und ein Aufwärmen sehr gut sind.
192
Typische Fehler und Korrekturen
-
Bauchmuskelübung (z. B. Boot - navasana)
Grundinstruktionen: ,,Gib die Füße zusammen. Beuge die Knie und gib die Fußsohlen auf den Boden. Falte die Hände hinter dem Kopf. Atme aus und hebe die Brust hoch. Drücke dabei die Lendenwirbelsäule gegen den Boden und spüre, wie die Bauchmuskeln arbeiten."
Typische Fehler: Zu hohes Aufsetzen (Sit-up statt Boot). Lendenwirbelsäule angehoben (beides ist schlecht für das Kreuz). Kopf zu hoch und Nacken überdehnt. Gesicht ver spannt.
Korrekturen: Sage den Schülern, sie sollen Nacken, Schultern und Gesicht entspannen, den Nacken relativ gerade halten, mehr den Brustkorb hochheben und die Lendenwirbelsäule in den Boden drücken.
Bemerkungen: Sollte ein Schüler trotzdem Schmerzen im unte ren Rücken verspüren, kann er die Variation mit erhobenen Füßen oder gestreckten Armen neben den Knien machen.
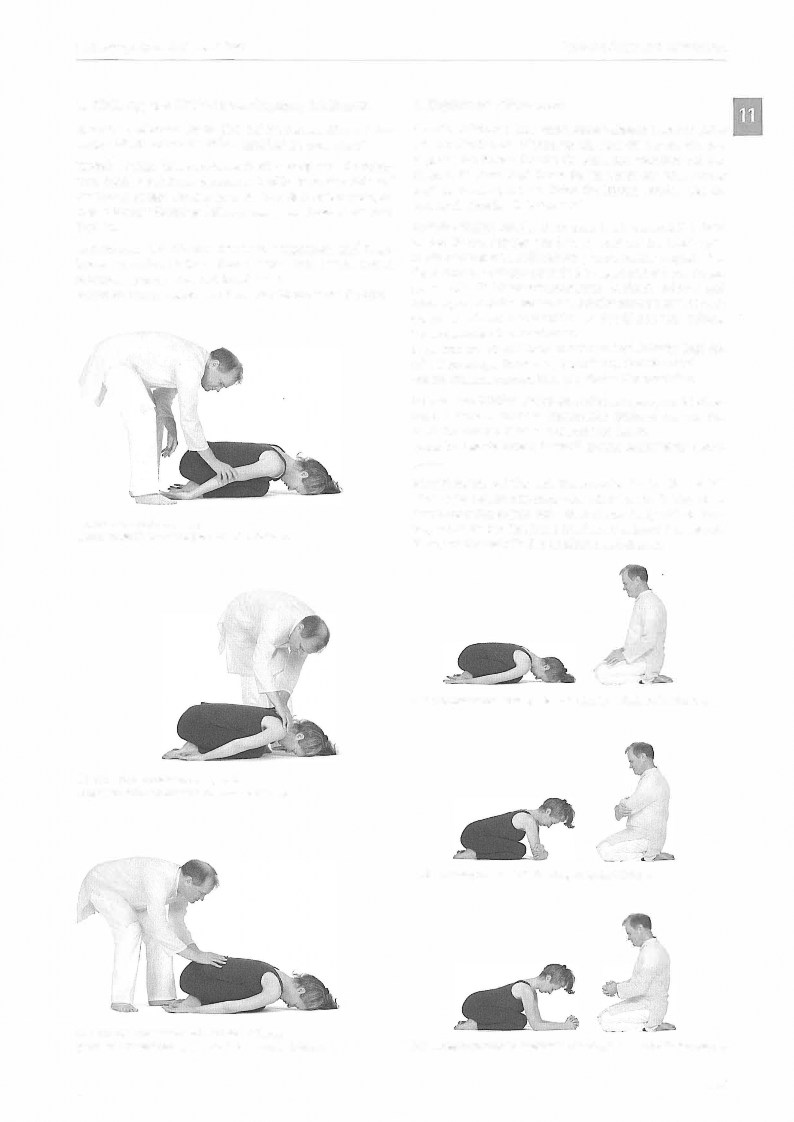
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
-
Stellung des Kindes (garbhäsana, bäläsana)
Grundinstruktionen: ,,Setze dich auf die Fersen. Stirn auf den Boden. Hände neben die Füße, Handflächen nach oben."
Typische Fehler bzw. Probleme: Schüler verspannt die Schul tern. Schüler hält Arme verspannt. Schüler kann sich nicht auf die Fersen setzen. Schüler kann Nacken nicht entspannen, da wegen kurzer Oberschenkellänge das ganze Gewicht auf dem Kopf ist.
Korrekturen: Mit Händen Schultern entspannen und Ellen bogen herunterdrücken. Kissen unter Knie legen. Kissen zwischen Oberschenkel und Bauch legen.
VARIATION: Hände neben den Kopf oder Fäuste unter die Stirn.
-
Arme sind nicht entspannt.
KORREKTUR: Sanft die Ellenbogen nach unten drücken.
-
Schülerin hält Schultern angespannt.
KORREKTUR: Sanft die Schulterblätter runter schieben.
-
HILFE ZUM ENTSPANNEN: Sanft mit beiden Händen
gegen das Kreuzbein bzw. gegen die Beckenknochen drücken.
Typische Fehler und Korrekturen
-
-
Kopfstand (sTr�äsana)
Grundinstruktionen (aus garbhäsana/bäläsana heraus): ,,Miss mit den Händen die Ellenbogen ab. Falte die Hände. Gib den Kopf auf den Boden. Strecke die Beine aus. Wandere mit den Füßen in Richtung Kopf. Beuge die Knie, hebe die Füße mit der Kraft der Ellenbogen hoch. Richte den Rücken gerade. Hebe die Knie hoch. Strecke die Beine aus."
Typische Fehler: Schüler zieht (zum Hochkommen) Schultern zu den Ohren. Schüler gibt kein Gewicht auf die Ellenbogen. Schüler springt mit zu viel Schwung hoch. Schüler vergisst, rich tig zu atmen. Anfänger schließt die Augen (mit offenen Augen gehen alle Gleichgewichtsstellungen leichter). Schüler gibt Ellenbogen zu weit auseinander. Schüler wandert zu weit nach vorne und nimmt alles Gewicht von den Ellenbogen. Schüler hat mangelndes Selbstvertrauen.
IN DER STELLUNG: Zu viel Gewicht auf dem Kopf. Schiefer Kopf, fal sche Nackenlage. Hohlkreuz, Rundrücken. Seitlich schief.
Aus DER STELLUNG KOMMEN: Unkontrolliertes Hinunterfallen.
Korrekturen: Schüler ermutigen. Auf Ellenbogen- und Schulter haltung achten. Schülern hineinhelfen (siehe Abb.). Auf den Punkt im unteren Rücken konzentrieren lassen .
IN DER STELLUNG: Behutsam Beinstellung und Rückenhaltung korri gieren.
Bemerkungen: Schüler mit Beschwerden in der Halswirbel säule, sehr hohem Blutdruck oder einer kurz zurückliegenden Augenoperation sollten sich mit Arzt oder Heilpraktiker bera ten, bevor sie den Kopfstand machen. Genügend den Delphin üben, um die Kraft für den Kopfstand aufzubauen.
9.la AusGANGSPOSITION: Schüler/in befindet sich in der Stellung des Kindes ...
9.lb ... Schüler/in umfasst die Ellenbogen mit den Händen ...
9.lc ... Ellenbogenabstand beibehalten! Hände gefaltet auf den Boden geben ...
193
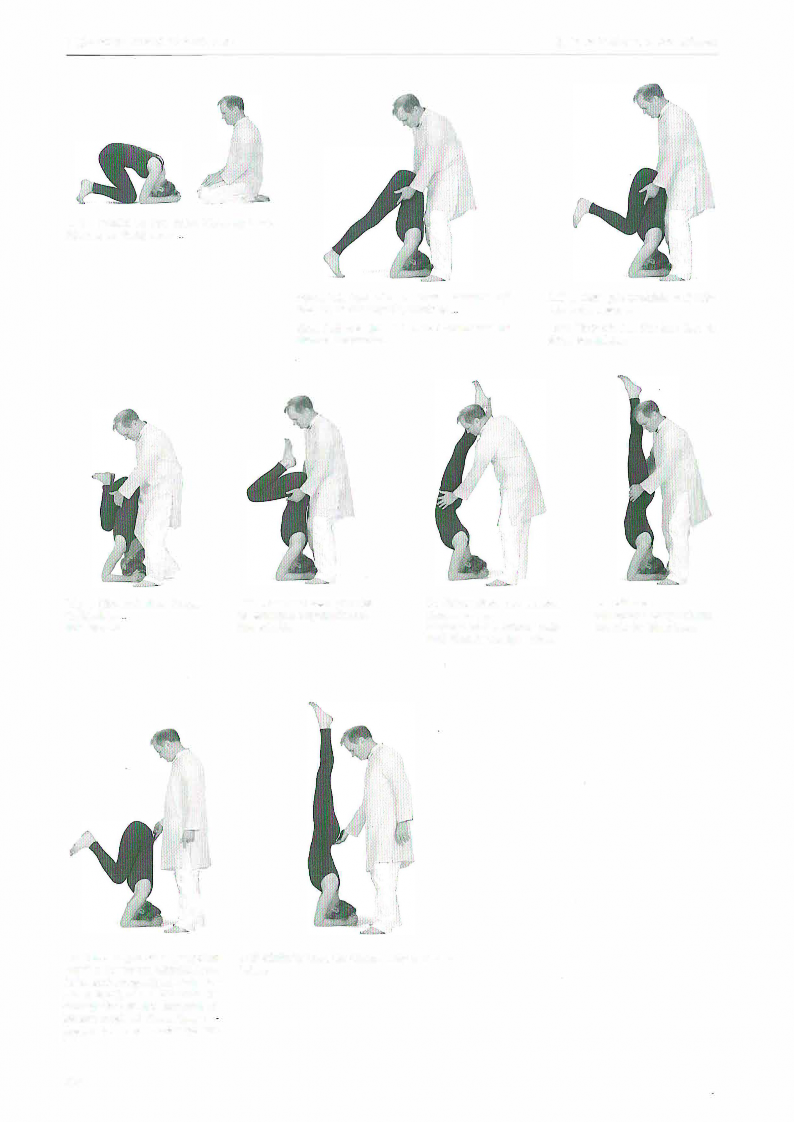
H a1;ha-yoga-U nterrichtstechn i ken Typische Fehler und Korrekturen
...,..--.
9.ld ... Scheitel auf dem Boden. Hinterkopf in die Hände legen. Gesäß heben .
9.le ... Knie durchdrücken. Mit Füßen Richtung Kopf trippeln, bis Abhebepunkt erreicht ist .
HILFE: Seitlich dahinter stellen. An der Hüftbeuge mit Händen unterstützen.
1
�
9.lf ... dann Knie anwinkeln und Füße vom Boden heben ...
HILFE: Hände wie 9.le Knie bzw. Bein als Stütze bereithalten.
9.lg ... Füße nach oben Richtung Gesäß geben .
HILFE: wie 9.lf.
-
lh ... Füße nach oben geben, bis die Beine ganz ausgestreckt sind. HILFE: wie 9.lf.
-
-
Ganzer Körper zu weit nach hinten gebogen.
KORREKTUR: Gerade richten. Füße und Hüften in eine Linie geben.
-
Hohlkreuz.
KORREKTUR: So weit gerade rich ten, wie der Körper kann.
-
a HILFE: Es gibt einen „magischen Punkt" in der unteren Wirbelsäule (an der 5. Lendenwirbelsäule/1. Steißbein wirbel, LS/Sl), der in der Höhe des Schwerpunktes ist. Hier kann man mit leichtem Druck mit einem Finger ver hindern, dass der/die Schüler/in um fällt.
-
194
9.4b Schüler/in lernt, das Gleichgewicht alleine zu halten.

Hatha-yoga-U nterrichtstechniken Typische Fehler und Korrekturen
-
-
Schulterstand (sarvängäsana)
Grundinstruktionen: ,,Gib die Füße langsam zusammen, Hände neben deinen Körper, Handflächen nach unten. Beine gerade. Einatmen, beide Beine heben, Hüften heben, komme hoch zum Schulterstand. Unterstütze den Rücken mit den Händen. Entspanne deine Füße, Waden und Gesicht. Stellung mehrere Atemzüge lang halten."
Typische Fehler: Die Schüler/innen spannen Füße, Waden, Schultern und Gesicht an. Der Kopf ist nicht in der Mitte. Die Schüler/innen können nicht hochkommen zum Schulterstand.
Korrekturen: Lasse die Schüler/innen mit den Füßen kreisen, um die Waden zu entspannen. Berühre ihre Füße und Waden, um auf Spannungen aufmerksam zu machen. Stehe hinter dem/der Schüler/in und ziehe seinen/ihren Kopf sehr sanft zur Mitte (NIEMALS mit Gewalt). Wenn jemand nicht hochkom men kann, versuche, ihn an den Füßen hochzuziehen. Wenn nötig unterstütze seinen Rücken mit deinem Knie.
Um dem/der Schüler/in mehr Dehnung zu ermöglichen, ziehe ihn/sie von den Waden aus hoch. Schiebe seine/ihre Ellen bogen mit deinen Füßen zusammen. Drücke dein Knie gegen das Kreuzbein, während du die Oberschenkel nach hinten ziehst.
Bemerkungen: Sorge dafür, dass die Schüler/innen sich nicht übernehmen. Sage ihnen, sie können jederzeit aus der Stellung kommen. Wer Nackenprobleme hat, sollte vorher den Arzt konsultieren. Lasse sie nur die Beine in die Luft heben mit ihren Armen unter dem Rücken. Eine vierfach gefaltete Decke unter die Schultern bzw. ein Handtuch in den Nacken zu legen, kann auch sehr hilfreich sein.
-
Kopf liegt schief.
KORREKTUREN: Kopf gerade rücken und Nacken lang ziehen. Vorsicht: Sehr sanft, niemals ruckartig!.
-
Schultern zu nahe an den Ohren. KORREKTUR: Schultern sanft von Ohren wegdrücken.
-
Waden sind verspannt und Füße zu sehr gestreckt. KORREKTUR: Lehrer fasst an Waden oder Füße, um Schülerin zu helfen, die Waden zu entspannen.
-
10.5 Beine und Rumpf nicht richtig aufgerichtet.
KORREKTUR: Leicht in die Knie gehen. Mit Knie das Kreuzbein wegdrücken, mit den Händen die Oberschenkel heranziehen. Füße bleiben weiterhin an den Ellenbogen.
10.7 Zehen zwischen Schulterblätter drücken, dabei eine Hand als Vor sichtsmaßnahme locker am Fußknö chel halten.
10.4 Ellenbogen zu weit auseinander. KORREKTUR: Mit Füßen die Ellenbogen sanft zusammendrücken. Vorsicht: Nicht näher als schulterbreitl
\
(
10.6 Beine und Rumpf noch mehr Aufrichten: Mit Knie Hüfte gerade richten. Sanft um die Unterschenkel (an die Fesseln) greifen und anheben.
10.8 Schüler/in drückt gegen die Hände des Yogalehrers und richtet sich dabei selbst auf
195

Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
-
Pflug (ha/äsana)
Grundinstruktionen (vom Schulterstand aus): ,,Bringe beide Beine langsam zum Boden. Halte die Beine gerade, Zehen Richtung Kopf, Fersen Richtung Boden. Wenn die Füße den Boden nicht berühren, lasse die Hände am Rücken. Wenn die Füße auf den Boden kommen, strecke die Arme hinter deinem Rücken aus, Handflächen flach am Boden ablegen. Wenn dies bequem möglich ist, falte die Hände. Die Hände bleiben am Boden. Tief durchatmen, Gesicht entspannen ... "
Typische Fehler: Schüler forciert zu sehr (siehe Gesichtsaus druck, Atmung). Schüler ist zu angespannt. Schüler beugt die Knie. Schüler dreht den Kopf, um zu sehen, was die anderen machen. Flexible Schüler ziehen Becken zu sehr nach hinten (sollte parallel zu den Schultern bleiben).
Korrekturen: Sage den Schülern, sie sollen in der Stellung ent spannen und immer tief atmen. Sobald die Atmung unregelmä ßig wird, sollen sie aus der Stellung kommen. Die Schüler müs sen verstehen, dass, wenn sie ihren Kopf im Schulterstand und Pflug drehen (um zu sehen, was die anderen machen}, sie ihren Nacken verletzen können.
Bemerkungen: Schüler mit Kyphose (Rundrücken) sollten nicht zu weit in den Pflug gehen und ihn nicht zu lange halten.
1,'
Typische Fehler und Korrekturen
-
Fisch (matsyäsana)
Grundinstruktionen (aus der Entspannungsstellung): ,,Gib die Füße zusammen. Lege die Hände unter das Gesäß, Handflä chen nach unten, Daumen berühren sich, Ellenbogen nahe zusammen. Einatmen, hebe die Brust, hebe die Schultern, gebe den Kopf nach hinten. Lege deinen Scheitel auf den Boden. Spanne die Rückenmuskeln an und schiebe die Brust so weit wie möglich nach oben. Schultern weg von den Ohren, Schulterblätter zusammenziehen. Entspanne Füße, Beine und Gesicht. Verteile das Gewicht �leichmäßig auf das Gesäß, die Ellenbogen und den Kopf. Tief atmen, dehne Bauch und Brust mit jedem Atemzug ... "
Typische Fehler: Ellenbogen zu weit auseinander. Hände zu weit oben nahe am Rücken (dadurch werden die Schultern in Richtung Ohren geschoben). Kopf nicht in der Mitte. Eine Schulter höher als die andere. Kopf nicht am Boden. Beine an gespannt. Gesicht angespannt. Atmung zu schnell, vor allem das Ausatmen.
Korrekturen: Sage den Schülern, sie sollen ihre Hände so weit wie möglich nach unten zu den Oberschenkeln bringen. Beide Hände sollen die gleiche Entfernung zum Knie haben. Gehe zu dem Schüler und hebe seine Brust nach oben, während du seine Ellenbogen mit deinen Füßen zusammenschiebst. Kon trolliere, ob die Füße des Schülers entspannt sind. Wiederhole die Atmungsanleitungen.
Bemerkungen: Schüler können ermutigt werden, sich in dieser Übung mehr anzustrengen, da sie die Rückenmuskulatur stärkt. Schüler mit Nackenproblemen sollen den Kopf nicht so weit nach hinten biegen und kein Gewicht darauf legen. Kopf kann auch auf den Hinterkopf gelegt und Nacken lang gemacht werden.
-
-
Unteren Rücken gerade richten. Becken gehört direkt über die Schul tern.
j
11.3 Fuß in den gefalteten Händen las sen und gleichzeitig Becken in der Hüftbeuge hochheben, um so den Rücken gerade zu richten.
-
Mit Fuß in die gefalteten Hände gehen. Mit der Ferse die Hände vom Körper wegziehen.
-
'v,' (·.
.
1 •
'
1 ,..
! . - -
11.4 Knie gerade richten.
-
' �
-
.,, i (
12,1 Beine gerade stellen.
12.2 Kopf gerade richten.
11.5 Füße zusammen geben, eventuell dabei Fersen sanft nach unten drücken.
196
12.3 Falls die Ellenbogen zu weit aus- 12.4 Ist eine oder beide Schultern zu einander sind, soll die Schülerin wie- nahe am Kopf, drücke sie Richtung der aus der Stellung kommen, die Füße.
Hände mehr Richtung Knie geben und die Ellenbogen zusammen geben.
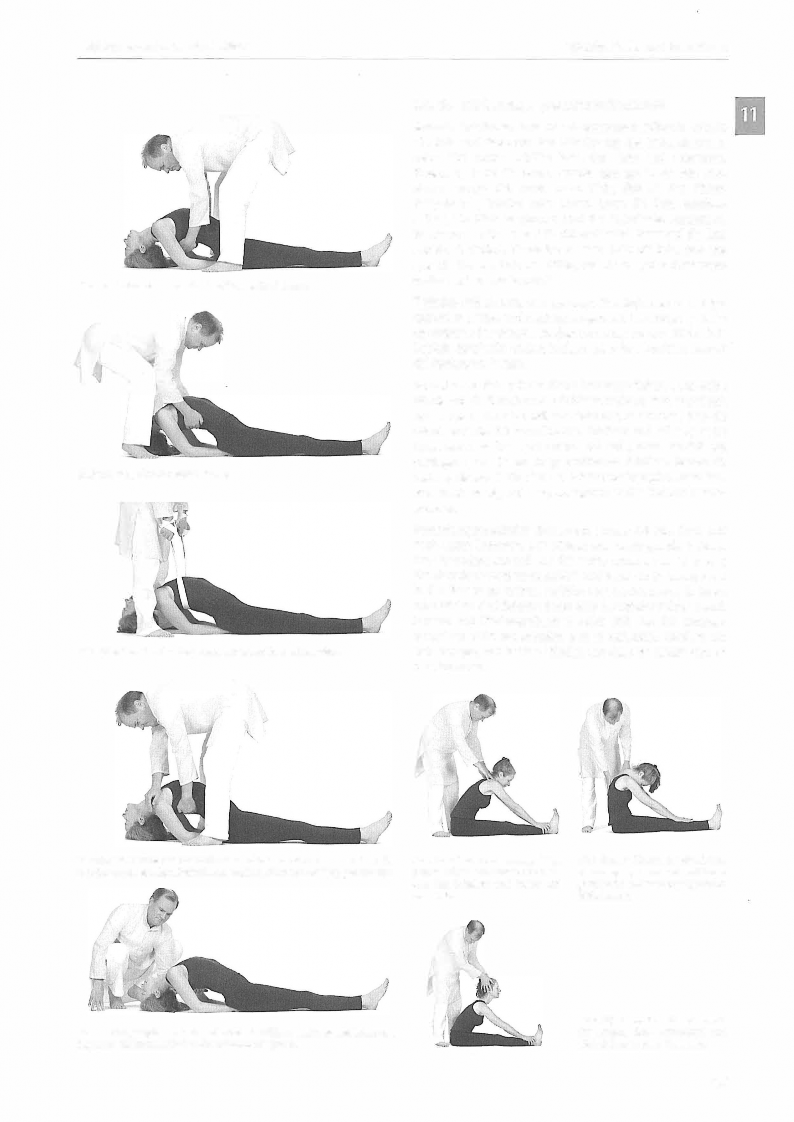
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
-
-
Brustkorb nach oben und hinten (Richtung Kopf) ziehen.
-
wie 12.5, aber von hinten ziehen.
-
Man kann den Brustkorb auch mit einem Yogagurt anheben.
Typische Fehler und Korrekturen
-
-
-
-
-
Vorwärtsbeuge (pascimottänäsana)
Grundinstruktionen (aus der Entspannungsstellung): 11 Beuge ein Knie und fasse mit den Händen um das Knie. Einatmen, setze dich unter Zuhilfenahme des Knies auf. Ausatmen. Einatmen, hebe die Arme, strecke dich zur Decke hin. Aus atmen, beuge dich nach vorne. Halte dich an den Füßen, Fußgelenken, Waden oder Knien. Lasse die Knie durchge drückt, die Füße angezogen und die Fußgelenke zusammen. Versuche den Bauch auf die Oberschenkel, Brust auf die Knie und Kopf auf die Schienbeine zu legen. Halte die Schultern ent spannt. Tief durchatmen. Fühle, wie du mit jeder Ausatmung weiter nach vorne kommst ... "
Typische Fehler: Knie sind gebeugt. Schüler/innen sind ange spannt. Die Füße sind nach innen gedreht. Die Beugung findet im oberen oder unteren Rücken und nicht aus der Hüfte statt. Der/die Schüler/in ändert laufend seine/ihre Position, anstatt die Stellung zu halten.
Korrekturen: Knie mit der Hand herunterdrücken. Lege deine Hände auf die Schultern des Schülers und sage ihm er soll sich entspannen. Um eine größere Dehnung zu erzielen, lege die Hände auf die Rückenmitte des Schülers und schiebe seine Brust etwas weiter nach vorne. Sei sanft, wenn es sich um Anfänger handelt; bei fortgeschrittenen Schülern kannst du mehr schieben. Sollte sich ein Schüler verkrampfen, sage ihm, er solle ein wenig loslassen oder ganz aus der Stellung heraus kommen.
Bemerkungen: Schüler können am Anfang 2-3 Mal hoch und nach unten kommen. Der Rücken soll relativ gerade bleiben. Die Hauptdehnung soll aus der Hüfte kommen. Es ist besser, den Brustkorb weniger zu senken und dafür die Dehnung mehr in den Beinen zu spüren. Jegliche Art von Schmerzen in Kreuz oder Rücken sind Zeichen dafür, dass der Schüler Fehler macht. Jemand mit Rückenproblemen sollte sich aus der Entspan nungslage nicht mit geraden Beinen aufsetzen, sondern ein Knie beugen, mit beiden Händen um das Knie fassen und so hochkommen.
-
-
Mit einer Hand den Brustkorb weiter anheben, mit der anderen Hand die Schulter runter drücken. Beide Seiten machen, damit die Stellung gerade wird!
-
Mit Fingerspitzen zwischen den Schulterblättern sanft gegendrücken, um Impuls zu stärkerem Anheben des Bustkorbs zu geben.
-
-
-
Schultern hochgezogen. Diese gerade richten und senken. Dafür sor gen, dass Schultern und Nacken ent spannt sind.
-
Oberer Rücken ist abgeknickt. Dafür sorgen, dass der obere Rücken gerade wird und die Beugung aus der Hüfte kommt.
-
Kopf zu weit nach hinten. Da für sorgen, dass Hinterkopf und Wirbelsäule in einer Linie sind.
-
197

Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
13.4a Bein- und Fußstellung des Schülers verbessern. HILFE: Füße zusammengeben ...
13.4b ... dann an den Fersen die Beine lang ziehen ...
-
-
c ... richte die Füße gerade.
-
Den Oberkörper des Schülers noch mehr nach vorne bringen: Hände am unteren Rücken legen und das Becken nach vorne schieben.
-
An den Handgelenken ziehen, mit den eigenen Fußballen die Füße des Schülers wegdrücken. Vorsichtig: Nur bei sehr flexiblen Schüler!
-
198
Typische Fehler und Korrekturen
13.7a FORTGESCHRITTENERE HILFESTELLUNG: Gegen den mittleren Rücken drü cken (dabei achtsam das Eigengewicht miteinsetzen) ..
13.7b ... mit der einen Hand testen, ob der Oberkörper noch ein wenig nachgibt und sich senken lässt, während die andere Hand die Fußballen und Zehen des Schülers Richtung Kopf drückt.
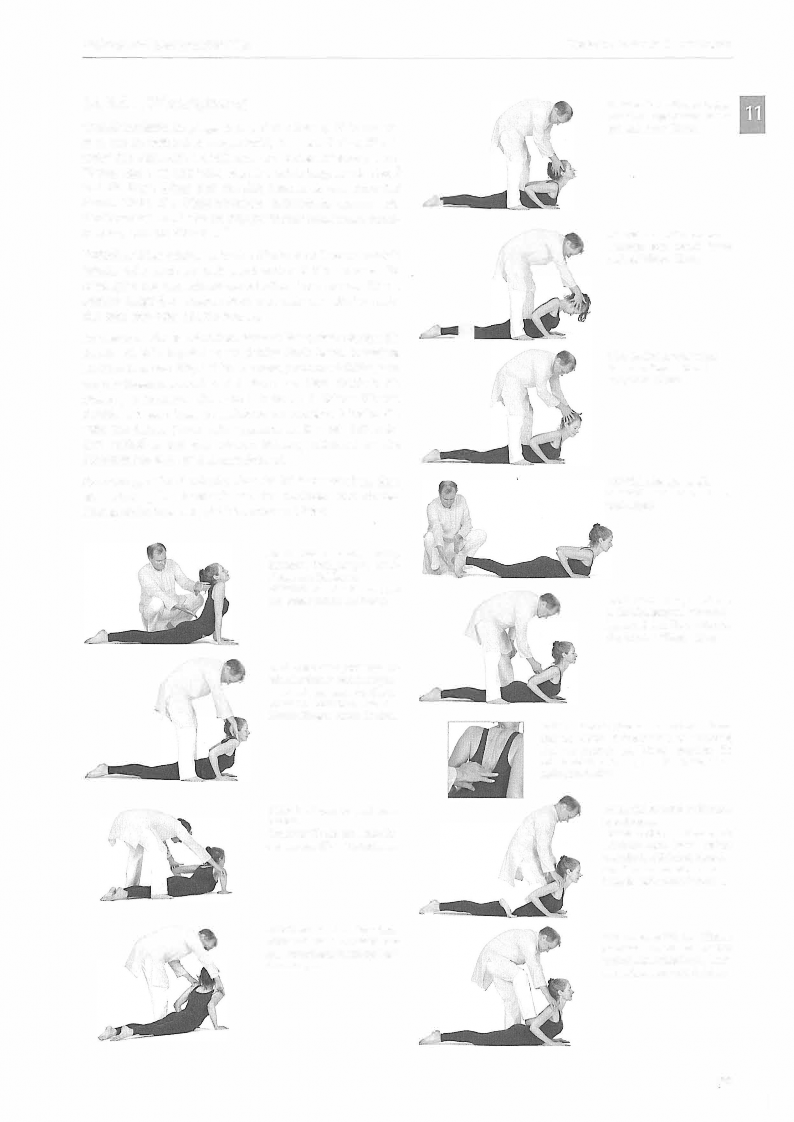
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken Typische Fehler und Korrekturen
-
-
Kobra (bhujangäsana)
Grundinstruktionen: ,,Lege dich auf den Bauch, Füße zusam men geben, Beine sind ausgestreckt, Stirn am Boden, Hände unter den Schultern, Handflächen am Boden, Ellenbogen am Körper. Atme ein und hebe wie eine Kobra langsam den Kopf und die Brust. Stütze dich mit den Händen ab und atme tief durch. Ziehe die Rückenmuskeln zusammen, spanne die Gesäßmuskeln an. Ziehe die Schulterblätter zusammen, Schul tern weg von den Ohren ... "
Typische Fehler: Schüler hat seine Hände zu weit vorne, zu weit hinten, oder auch zu weit auseinander. Schüler streckt die Arme ganz aus und schiebt die Schultern hoch zu den Ohren. Schüler beugt den unteren Rücken zu sehr und nicht so sehr den mittleren oder oberen Rücken.
Korrekturen: Mache deine Anweisungen klarer, dann werden die Schüler die Hände gleich an die richtige Stelle legen. Korrigiere die Einzelnen wo nötig. Oft ist es besser, wenn der Schüler ganz aus der Stellung kommt, und du ihm dann hilfst, richtig in die Stellung zu kommen. Ziehe die Schultern mit deinen Händen zurück, um eine bessere Dehnung zu erzielen. Schiebe die Füße mit deinen Füßen näher zusammen. Gib dein Knie oder den Fußballen auf den oberen Rücken, während du die Schultern mit den Händen zurückziehst.
Bemerkungen: Es ist wichtig, dass die Schüler verstehen, dass die Dehnung im Brustkorb und im mittleren und oberen Rücken stattfinden soll, nicht im unteren Rücken.
14.la Arme durchgedrückt, Schultern hochgezogen, Rund rücken und Hohlkreuz.
KORREKTUR: Aus der Stellung ge hen lassen und neu aufbauen.
14.lb Arme zwar jetzt angewin kelt, aber immer noch hochgezo gene und verspannte Schultern. KORREKTUR: Schultern mit den Händen/Fingern runter drücken.
14.lc Ellenbogen zu weit ausei nander.
KORREKTUR: Ellenbogen außen fas sen und zum Körper hinschieben.
14.ld Schiefstand der Schultern. KORREKTUR: Beide Schultern fas sen, begradigen, in richtige Posi tion bringen.
,,.....
�
.?
,,,
' dl:
14.2a Kopf zu weit nach hinten. KORREKTUR: Kopf seitlich fassen und nach vorne führen.
14.2b Kopf zu weit nach vorne. KORREKTUR: Kopf seitlich fassen
_,, und nach hinten führen.
-
-
c Kopfhaltung ist schief. KORREKTUR: Kopf seitlich fassen und gerade richten.
-
Füße sind aufgestellt. KORREKTUR: Fußrücken fassen und ablegen.
-
a Sanfte Hilfe, um stärker in die Rückbeuge zu kommen: Impuls mit dem Finger zwischen den Schulterblättern geben.
-
14.4b So sieht ein Rücken in der richtigen Kobra aus: Die oberen Rückenmuskeln (M. trapezius) sind angespannt. Mit Finger zwischen die Schulter-blätter tippen, und Brustwirbelsäule nach vorn drücken.
14.Sa Schultern sind noch etwas zu weit vorne.
KORREKTUR: Mit den Händen die Schultern nach hinten ziehen und mit dem Knie zwischen den Schulterblättern die Brustwir belsäule nach vorne drücken ...
-
Sb ... ODER: Mit den Händen die Schultern nach hinten ziehen und mit dem Fußballen die Brust wirbelsäule nach vorn drücken.
199
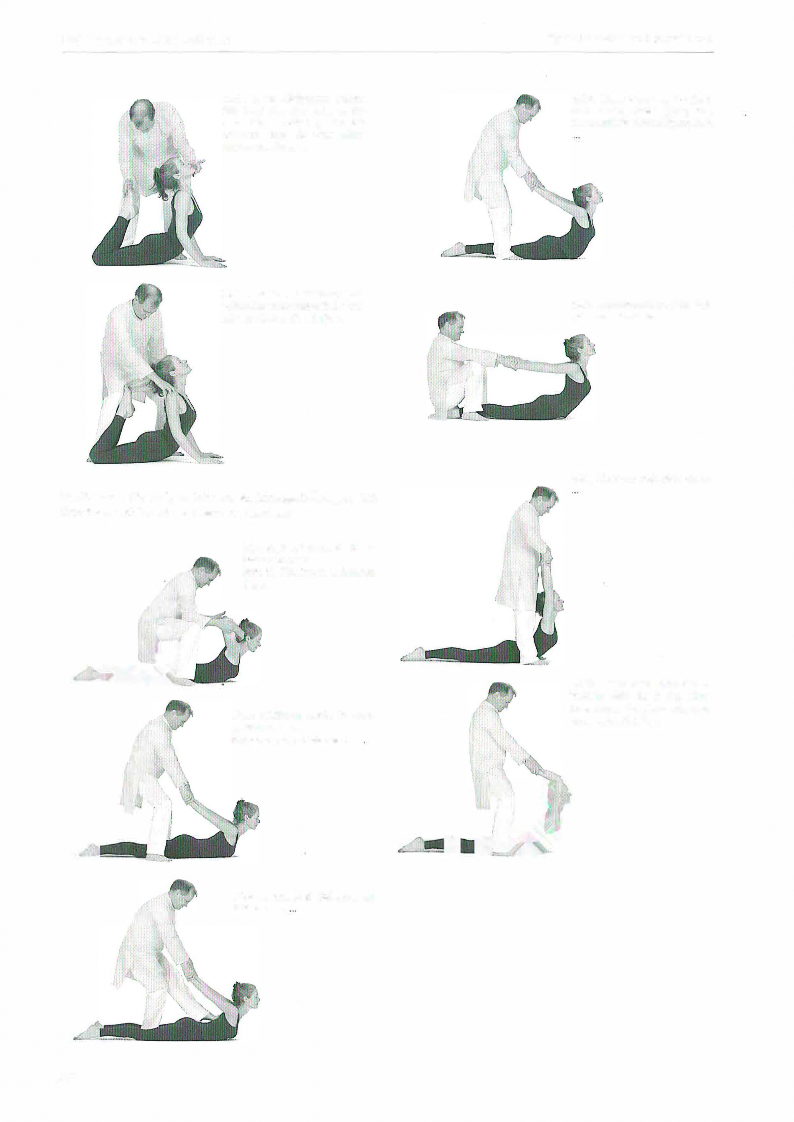
H atha-yoga-U nterrichtstechniken
14.6a In die Königskobra helfen: Mit Hand das Kinn (sehr sanft!) nach hinten schieben, mit der anderen Hand die Füße näher zusammenbringen ...
-
-
b ... oorn: Mit einem Knie die Füße näher zusammendrücken und mit den Händen die Schultern.
Vorübungen für for tgeschrittene Rückbeugestellungen, um Schultern und Brustkorb flexibel zu machen:
Typische Fehler und Korrekturen
-
d Wenn Schultern, Brustkorb und Rücken flexibel genug sind, ziehe sanft die Arme Richtung Füße
-
-
-
e ... und setze dich auf die Fuß sohlen der Schülerin.
-
a Die Arme nach oben ziehen
-
-
-�
' -
�-'
-
-
a Schüler/in faltet die Hände hinter dem Kopf.
HILFE: Die Ellenbogen nach hinten ziehen.
-
b ... dann nach hinten ziehen. Vorsicht: Falls das in den Ellen
-
L
200
14.7b Schüler/in streckt die Arme nach hinten aus.
HILFE: Arme nach hinten ziehen ..
14.7c ... eventuell Fußzehen zu Hilfe nehmen
• •!
bogen oder Schultern schmerzt, Arme gestreckt halten.
L
Jj

Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
-
-
Heuschrecke (salabhäsana)
Grundinstruktionen (aus der Bauchentspannungslage): ,,Lege langsam die Arme unter deinen Körper, mache Fäuste mit den Händen oder falte sie. Lege das Kinn auf den Boden und die Ellenbogen so nahe zusammen wie möglich. Hebe einatmend das rechte Bein hoch, senke es ausatmend wieder. Hebe ein atmend das linke Bein hoch, senke es ausatmend wieder. (Drei mal wiederholen ... ) Atme dreimal tief ein und aus, um die Muskeln im Rücken und in den Armen mit neuer Kraft zu füllen. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Jetzt atme ein und hebe beide Beine nach oben. Schiebe den Körper mit den Armen hoch und spanne den Rücken an. Halte die Stellung so lange wie möglich ... "
Typische Fehler: Stirn anstatt Kinn am Boden. Schüler gibt zu schnell auf.
Korrekturen: Ermutige die Schüler, sich mehr anzustrengen. Erzähle etwas über die Wirkungen, um die Schüler zu ermuti gen.
-
Knie sind angewinkelt. KORREKTUR: Schüler/in bitten, Beine auszustrecken.
-
HILFE: Fasse an die Fußgelenke. Füße und Beine zu dir ziehen und diese gleichzeitig mit Vorsicht anheben. So kommt der/die Schüler/in etwas höher, ohne dabei ein Hohlkreuz zu erzeugen. Vorsicht: Nicht einfach loslassen. Vor her Bescheid geben.
-
-
Bogen (dhanuräsana)
Grundinstruktionen (aus der Bauchentspannungslage): ,,Beuge deine Knie, fasse die Fußgelenke an. Hebe einatmend den Kopf, die Füße und die Knie ... "
Typische Fehler: Anfänger halten die Füße zusammen und kön nen ihre Fußgelenke nicht erreichen oder die Beine nicht hoch heben. Schüler lassen die Ellenbogen gebeugt anstatt gerade. Schüler heben den Bauch hoch und liegen auf Becken und Oberschenkeln, anstatt die ersten Rippen am Boden zu lassen.
Korrekturen: Ziehe die Füße mit deinen Händen auseinander, hebe die Füße hoch, strecke die Arme.
Bemerkungen: Vergiss den Schaukelbogen zum Schluss nicht.
Typische Fehler und Korrekturen
15.3a: NUR FÜR FORTGESCHRITTENE: An den Fußgelenken die Beine hochhe ben. Vorsicht: Das muss für den unteren Rücken und für den Nacken ange nehm bleiben. Nicht übertreiben „
15.3b: ... Füße weiter nach hinten ziehen, die Knie beugen lassen. Vorsicht: Nicht übertreiben. Nur bei sehr Flexiblen möglich.
... sehr Flexible können die Füße bis zum Kopf geben.
16.la HILFE: Den/der Schüler/in zeigen, wo sie greifen muss, nämlich oberhalb des Fußge lenks Richtung Schienbein.
201
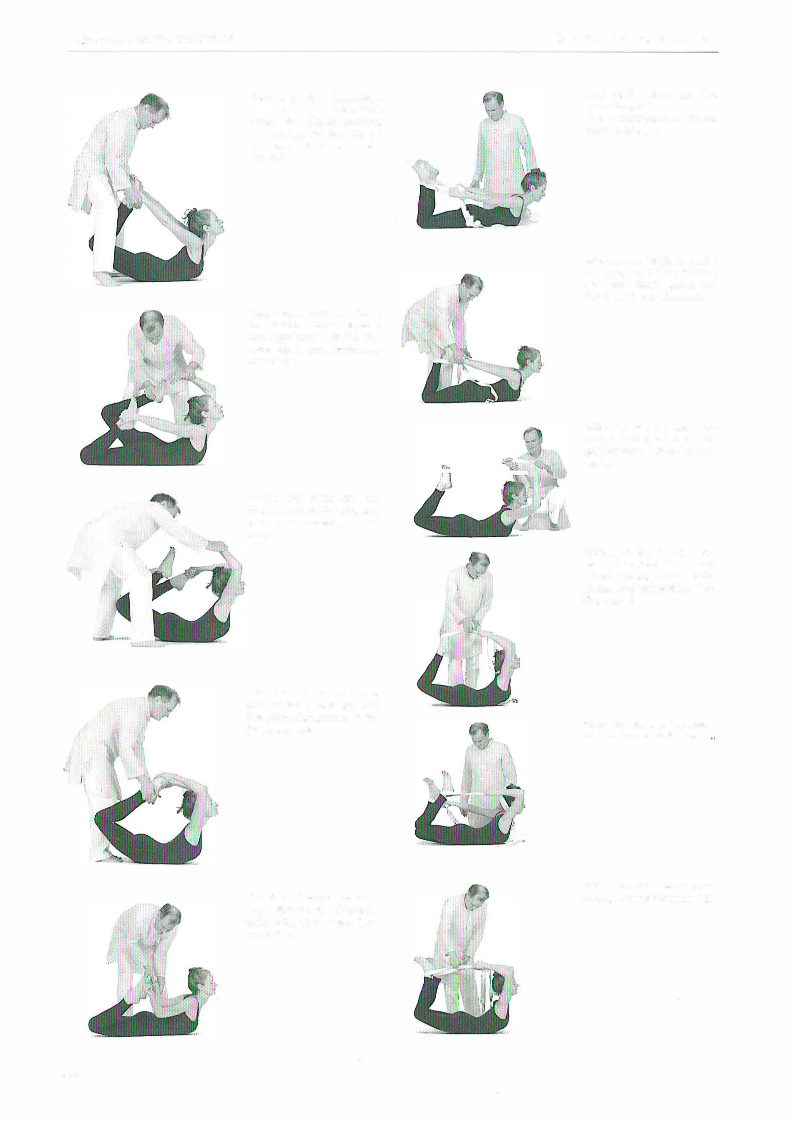
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken Typische Fehler und Korrekturen
16.lb ... um eine stärkere Deh nung zu erzeugen, kannst du die Fersen des Schülers umfassen und anheben. Vorsicht: Nur bei Menschen mit einem gesunden Rückenl
'" '
-
-..;.�: '
1 •
16.4a Schüler können ihre Füße noch nicht greifen .
HILFE MIT EINEM YoGAGURT: Gurt um
Fußgelenke geben.
. \...
... ...
. -·
-
16.2a FORTGESCHRITTENERE HILFEN:
Linke Hand des Schülers von oben an seinem/ ihrem linken Fuß plat zieren (siehe auch Vorübungen 14.7-14.8) '"
16.2b ... und rechte Hand von oben am rechten Fuß platzieren (siehe auch Vorübungen 14.7- 14.8)
-
-
c Wenn beide Hände von oben an die Füße fassen, wird dies pür,:ia-dhanurtisana, (voller Bogen) genannt.
-
Eine weitere Möglichkleit in pür,:ia-dhanurasana zu kommen. Achtung: Nur für besonders flexi ble Schüler/innen.
-
b ... wenn Schüler/in flexibel genug ist, kann der Yogalehrer an seine/ihre Hände fassen und ihn/sie sanft nach oben ziehen.
-
16.Sa Der Yogagurt kann auch genutzt werden, um in die fort geschrittenere Position zu kom men ...
16.Sb .., mit dem Gurt die Beine anheben. Vorsicht: Das muss für den unteren Rücken und für den Nacken angenehm bleiben. Nicht übertreiben!
16,6a HILFE MIT ZWEI YOGAGURTEN:
Ein Band um jeden Fuß winden.
16.6b ... der Yogalehrer zieht die Hand am Band entlang zum Fuß.
202
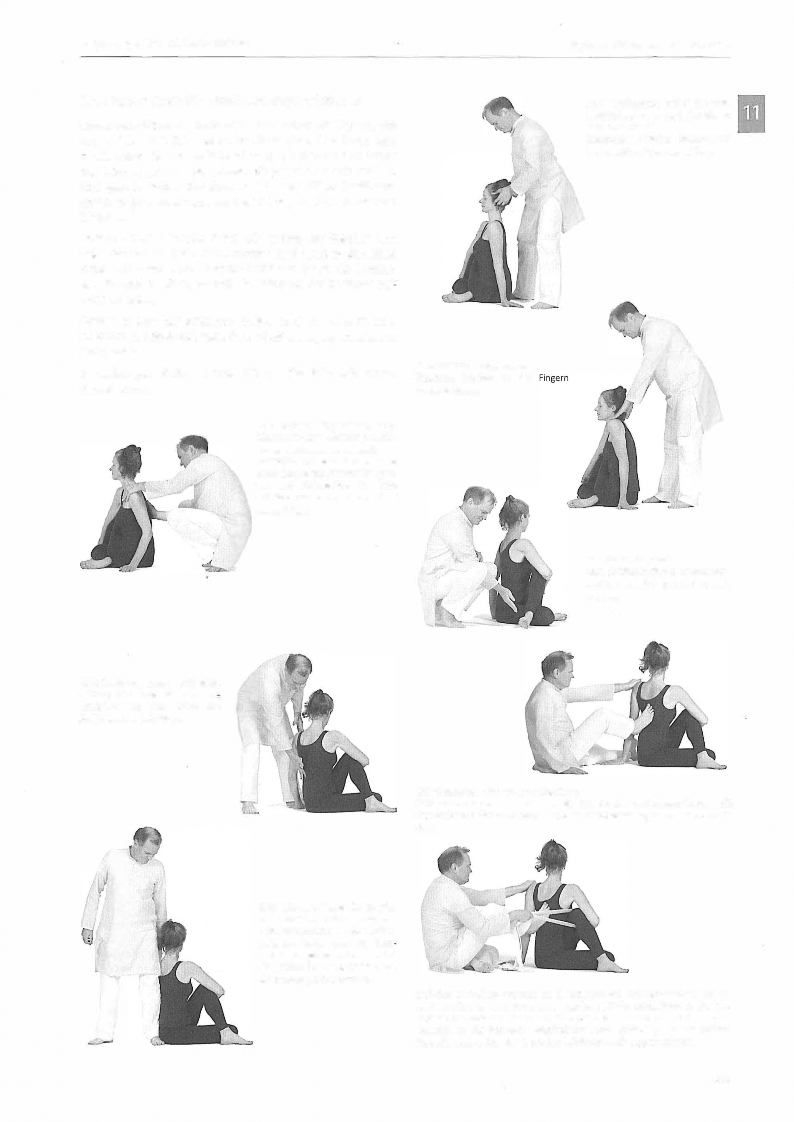
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken Typische Fehler und Korrekturen
17. Halber Drehsitz (ardha-matsyendräsana)
Grundinstruktionen: ,,Setze dich links neben die Fersen. Gib den rechten Fuß links neben das linke Knie. Den linken Arm rechts neben das rechte Knie bringen; den rechten Arm hinter den Rücken geben. Den ganzen Körper nach rechts drehen. Kopf gerade halten, Schultern auf gleicher Höhe; Gesäß ent spannen, linke Brust nach vorne schieben, rechte Schulter nach hinten ... "
Typische Fehler: Der/die Schüler/in nimmt den falschen Arm oder das falsche Bein. Die Schultern sind nicht in derselben Höhe und angespannt. Der/die Schüler/in beugt die Lenden und Brustwirbelsäule, anstatt sie während der Drehung auf recht zu halten.
Korrektur: Dem/der Schüler/in helfen, in die korrekte Stellung zu kommen. Hände auf seine/ihre Schultern legen, um diese zu entspannen.
Bemerkungen: Steifere Schüler können das linke Bein ausge streckt lassen.
17.5 Schulter hochgezogen. KORREKTUR: Schulter mit den runter drücken.
17.4 Kopfhaltung schief (zu weit nach hinten, vorne, zur Seite oder zu sehr in der Mitte).
KORREKTUR: Mit beiden Händen Kopf fassen und sanft gerade richten.
-
-
Rücken eingesunken, Kopf hängt nach vorne hinunter (auf Abb. nur ganz schwach angedeutet). KORREKTUR: Mit der flachen Hand unter das rechte Schulterblatt grei fen und gleichzeitig die linke Schulter mit der anderen Hand
gegenziehen.
17.6 Zehen verspannt.
HILFE: Schüler/in darauf aufmerksam machen, den Fuß bewusst zu ent spannen.
-
Sanft von unten nach oben entlang der Wirbelsäule hinauf streichen, um den Reflex des Aufrichtens zu aktivieren.
-
-
Oberkörper nicht genug aufgerichtet.
HILFE MIT Fuß: Mit der linken Hand an die linke Schulter des Schülers fassen. Mit dem rechten Fußballen rechts neben der Brustwirbelsäule gegen die Rippen drü cken.
-
-
-
Mit einer Hand die Schulter des Schülers Richtung eigenes Bein heranziehen. Mit der Außen seite .des Beins gegen die Brust wirbelsäule drücken. So kann sich der Rücken besser aufrichten und die Drehung sich verstärken.
-
-
-
HILFE MIT Fuß UND YOGAGURT, um Oberkörper noch mehr aufzurichten und lin kes Bein näher an den Körper heranzuziehen: Mit der linken Hand an die linke Schulter des Schülers fassen. Mit der rechten Hand sanft am Gurt ziehen (der Gurt wird um das linke Bein - oberhalb des Knies - gewickelt). Mit dem rechten Fußballen links neben der Brustwirbelsäule gegen die Rippen drücken.
-
203
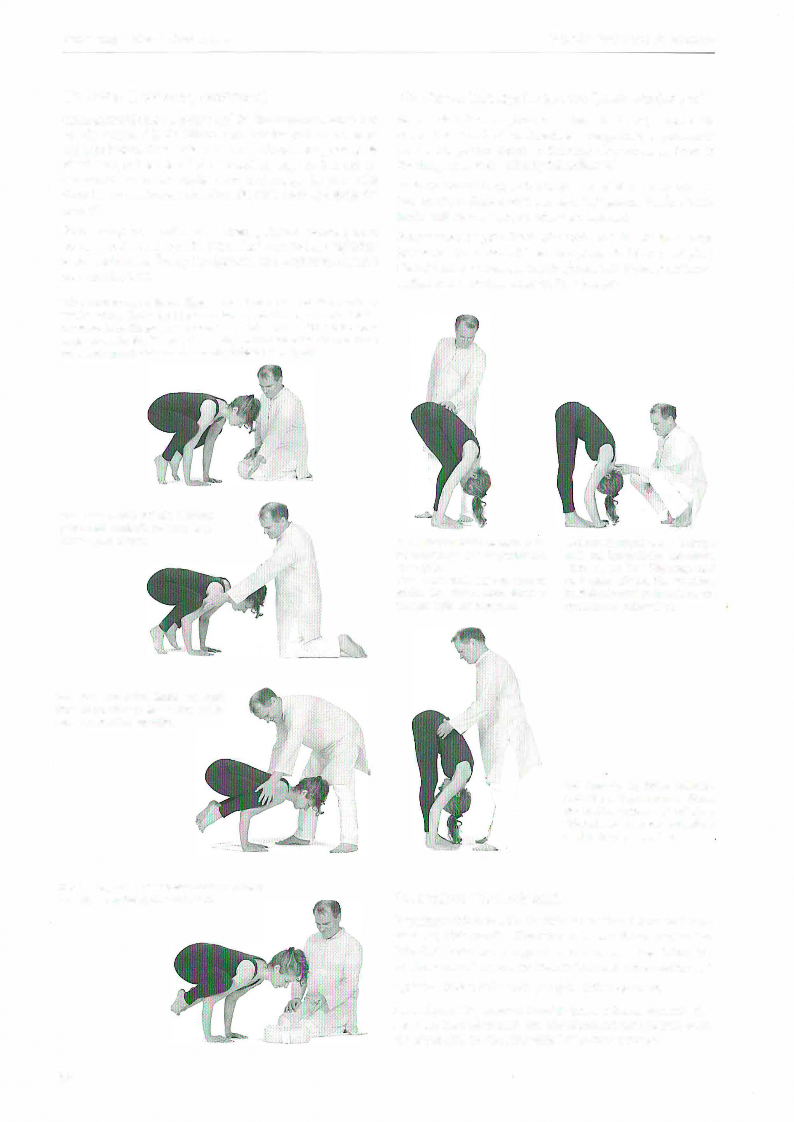
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
-
Krähe (kakasana, bakasana)
Grundinstruktionen: ,,Komme auf die Zehenspitzen. Setze dich auf die Fersen. Gib die Hände etwa schulterbreit auseinander auf dem Boden, Finger zeigen leicht nach innen. Beuge leicht die Ellenbogen, drücke sie dabei nach außen. Lege die Knie auf die Oberarme. Hebe das Gesäß hoch und bringe langsam alles Gewicht auf die Arme. Hebe dann die Füße hoch und atme tief durch."
Anmerkung: Kopf sollte nach oben gehalten werden; auch wenn der/die Schüler/in die Füße nicht vom Boden wegheben kann, stärkt diese Übung Handgelenke und Unterarme. Mache dem Schüler Mut.
-
AusGANGSPOSITION: Hocke. Hände auf den Boden, etwa schulterbreit ausei nander geben. Hände sind leicht nach innen gedreht. Finger eventuell dabei etwas spreizen. Ellenbogen leicht anwinkeln. Knie samt Gewicht auf die Ober arme geben. Zur Stabilisierung des Gleichgewichts Blick direkt auf den Boden (oder nach vorne) richten und während der Übung beibehalten.
Typische Fehler und Korrekturen
-
-
Vorwärtsbeuge im Stehen (pada-hastasana)
Grundinstruktionen: ,,Gerade stehen. Einatmen, strecke die Arme über dem Kopf aus. Ausatmen, beuge dich langsam nach vorne. Bringe den Bauch in Richtung Oberschenkel, Brust in Richtung Knie, Kopf Richtung Schienbeine."
Typische Fehler: Der/die Schüler/in beugt sich zu sehr aus der Lendenwirbelsäule anstatt aus dem Hüftgelenk. Der/die Schü ler/in hält Nacken und Schultern angespannt.
Anmerkung: Der/die Schüler/in sollte bei der Stellung keine Schmerzen im unteren Rücken verspüren. Es ist auch möglich, die Knie leicht zu beugen. Schüler/innen mit Rückenproblemen sollten beim Hochkommen die Knie beugen.
18.2 HILFE: Hände auf die Schultern geben und Schüler/in vor dem Nach vorne-Kippen sichern.
-
-
RüCKENSCHONENDE VARIANTE: In die Vorwärtsbeuge mit angewinkelten Knien gehen.
HILFE: Hand sanft auf den unteren
-
Knie durchgedrückt. Oberkörper und Arme hängen locker nach unten. H1LFE: Mit der Hand Hinterkopf sanft nach unten drücken. Dies veranlasst,
-
Rücken des Schülers legen, damit er im Nackenbereich noch mehr zu ent- mehr nachgibt und entspannt. spannen und nachzugeben.
18.3 HILFE: Knie außen fassen und sanft stützen beim Ablegen des Gewichts auf die Arme und Abheben der Füße.
19.3 HILFE: An den Hüften festhalten und mit den Unterarmen am Rücken des Schülers (Letzteres ist auf dieser Abb. nicht zu sehen) dem Oberkörper sanft nach unten verhelfen.
18.4 Bei ungeübten oder weniger starken Schülern ist ein Kissen in Kopfnähe sehr hilfreich.
204
-
Dreieck (tri-konasana)
Grundinstruktionen: ,,Gib die Füße etwa einen Meter weit aus einander, Füße parallel. Einatmen, hebe den linken Arm an das linke Ohr. Ausatmen, beuge dich nach rechts. Lasse dabei den rechten Arm entlang des rechten Beines nach unten gleiten ... "
Typische Fehler: Füße nicht parallel. Hüften verdreht.
Anmerkung: Die meisten Schüler/innen müssen sich mit der Hand am Bein abstützen, um Überdehnung der anderen Seite zu vermeiden. Es gibt sehr viele Dreiecksvariationen.

Hatha-yoga-Unterrichtstechniken Typische Fehler und Korrekturen
-
Darauf achten, dass die Füße parallel zueinander stehen.
-
Schultern und Oberkörper gerade richten.
-
-
Tiefenentspannung (saväsana)
Allgemein: Beeile dich nicht in der Endentspannung, sie ist sehr wichtig. Die Milchsäure wird aus den Muskeln abtransportiert und der Körper kann sich erholen. Der präfla kann jetzt frei flie ßen und der Energielevel erhöht sich. Auch der Geist kann sich entspannen und erholen. Die Endentspannung wird bestim men, ob der Schüler positive Erinnerungen an die Yogastunde hat. Manche Schüler machen außergewöhnliche Erfahrungen.
Die Stufen der klassischen Yogaentspannung {siehe auch offe ne Anfängerstunde, S. 162):
-
Saväsana einnehmen. Vergewissere dich, dass die Stellung korrekt ist.
-
Anspannen und lockerlassen der Körperteile.
-
Autosuggestion: Muskeln und eventuell innere Organe.
-
Geistige Vorstellung (z. B. See in den Bergen, oder Strand am Meer oder Sternenhimmel etc.).
-
Spirituelle Entspannung mit Ruhe oder Or(J.
Du kannst auch ab und zu das autogene Training (s.S. 109f.) als Tiefenentspannung ansagen oder Entspannung über das Füh len (s. S.110) etc.
20.3 Angewinkelten Arm gerade rich- 20.4 Hüften mit beiden Händen gerade ten. richten.
20.5 Ausgestreckten Arm zum Ohr füh- 20.6 SEITE STÄRKER DEHNEN: Dafür sorgen, ren. Schulter dabei halten und wenn dass Hüfte weiterhin in einer Linie zur nötig nochmal gerade richten. Hand bleibt, wenn Schüler/in tiefer in
die Stellung geht.
Typische Fehler/Probleme und Korrektur: Falsche Haltung (siehe Anfangsentspannung). Schüler/in kann sich im unteren Rücken nicht entspannen {HILFE: aufgerollte Decke unter die Knie schie ben oder Knie beugen lassen). Schüler kann im Nacken nicht entspannen (HILFE: kleines Kissen unter den Kopf). Schüler wer den unruhig (du sprichst wahrscheinlich zu leise, oder machst alles zu langwierig). Schüler schlafen ein {du sprichst vielleicht zu langsam) oder schnarchen sogar {bei lautem Schnarchen hinge hen und sanft die Füße bewegen, um denjenigen wieder aufzu wecken). Der/die Lehrer/in stampft durch den Raum (setze dich in Meditationshaltung) oder verlässt den Raum (schicke den Schülern Gedanken des Lichtes oder die Kraft deines mantros). Der/die Lehrer/in nimmt sich zu wenig Zeit für die Tiefenent spannung. Der/die Lehrer/in spricht Anweisungen mechanisch (bringe dein Herz in jedes Wort).
-
-
Meditation (dhyäna)
Am Ende der Stunde, nach der Endentspannung, kannst du die Schüler zu einer Meditation von 1-3 Min. anleiten.
Grundinstruktionen: ,,Setze dich langsam auf zu einer ange nehmen Stellung mit gekreuzten Beinen, Rücken gerade, Schultern und Gesicht entspannt. Atme 5-10 Mal tief ein und aus. Verlangsame deinen Atem. Atme 3-4 Sek. lang ein und 3- 4 Sek. lang aus. Atme ganz langsam ein und aus ... "
Die Schüler/innen auffordern, auf die innere Stille zu lau schen, ihre Atmung zu beobachten oder om zu wiederholen,
-
-
Den/die Schüler/in ermutigen, gegen die Hand des Yogalehrers zu drücken.
-
Dem/der Schüler/in noch mehr in die Stel-lung verhelfen, durch sanften Druck am oberen Arm Nähe Schulter und gleichzeitiges Führen an der unte ren Schulter.
-
Arm des Schülers mit flachen Händen ausstreichen (vom Oberarm bis zu den Fingerspitzen).
-
während sie sich auf den Punkt zwischen den Augenbrauen oder ihr Herz konzentrieren und sich einen hellen Lichtstrahl vorstellen. ALTERNATIVE: trätaka
Typische Fehler: Der/die Schüler/in ist angespannt; hat hohe Erwartungshaltung; bewegt sich während der Meditation bzw. versteht die Anleitungen nicht, da der/die Lehrer/in zu leise spricht.
Korrekturen: Gib die Meditationsanleitungen auf entspannen de Weise, sei aber trotzdem sehr klar. Bei den ersten Malen lasse die Augen offen, während du die Meditationsanweisun gen gibst, damit du der Versuchung widerstehst, zu leise zu sprechen und auch die W irkung deiner Worte siehst.
205

H a1;h a-yoga-U nterrichtstech niken Notizen
206
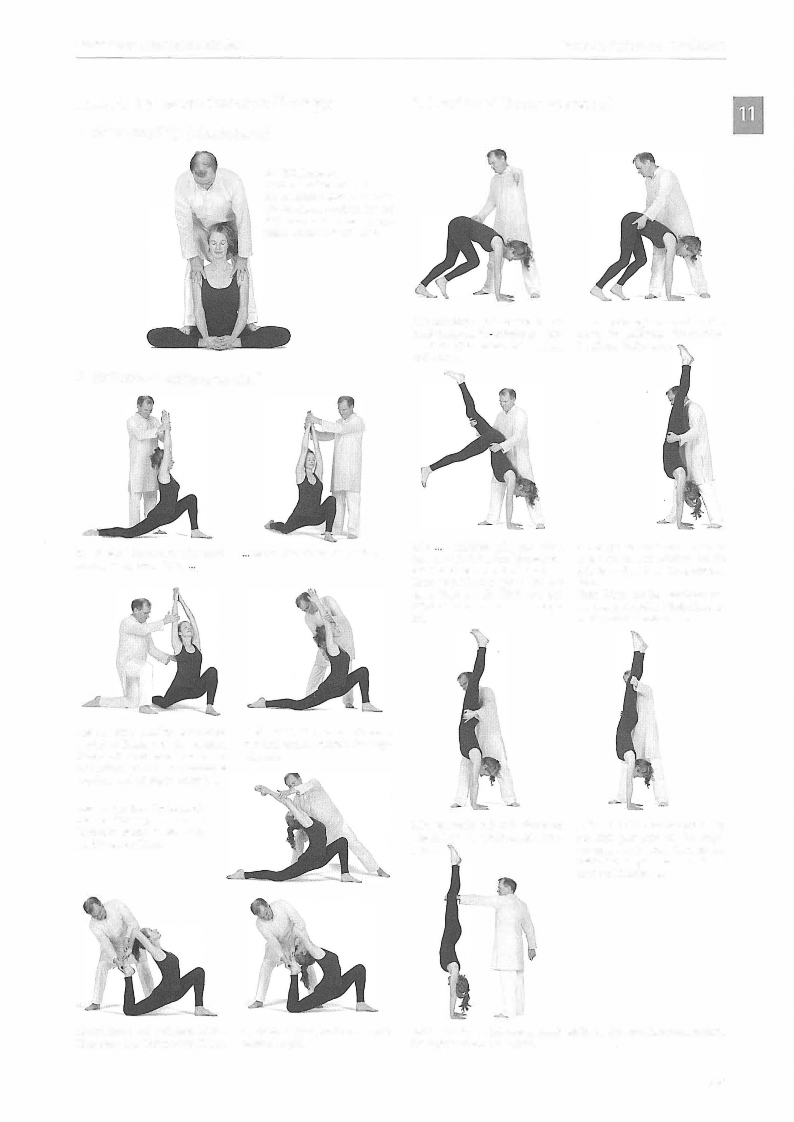
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
-
-
Zu fortgeschritteneren Übungen
-
-
-
Schmetterling (bhadräsana)
-
Hüftdehnung.
-
HILFE: Füße auf die Oberschenkel des Schülers stellen. Hände auf die Schultern. Vorsicht: Nur bei körperlich stabilen und sehr fle xiblen Schülern durchführen!
Typische Fehler und Korrekturen
-
Handstand (hasta-vrkJäsana)
-
Halbmond (äfijaneyäsana)
-
la Schüler/in geht zuerst in den Hund (adho-mukho svänäsona), dann wandert er/sie auf die Zehenspitzen nach vorne ...
-
3.lb ... Hrn: Yogalehrer/in hält Hän de an der Hüftbeuge des Schülers, bereit zum Auffangen ...
c:.-c,..,.
-
-
An den Unterarmen oder Hand gelenken nach oben ziehen
-
a Mit einer Hand im Brustwirbel bereich drücken, mit der anderen Hand sanft die Ellenbogen nach hin ten drücken. So wird die Dehnung in Brustkorb und Schultern verstärkt ...
-
wie 2.1 nur andere Perspektive.
2.2b ... wie 2.2a nur andere Perspek tive und andere Position des Yoga lehrers ...
3.lc Schüler/in gibt, mit etwas Schwung, die Beine kurz hintereinan der nach oben in den Handstand.
HILFE: Yogalehrer/in greift mit der einen Hand um die Hüftbeuge und mit der anderen um den Oberschen kel.
3.2 Es gilt für Schüler/in den Brust korb nach vorne zu schieben, bis die Schultern über den Handgelenken sind.
HILFE: Stütze den/die Schüler/in mit der eigenen Schulter. Hände dabei an Hüften oder Oberschenkeln.
-
-
c ... wie 2.2b. Fortgeschrit tene Hilfestellung, um den/die Schüler/in weiter in die Rück wärtsbeuge zu führen.
-
Fuß fassen und nach oben führen. 2.4 Wenn möglich, Kopf an den Fuß- Hände von oben Richtung Fuß führen. sohlen ablegen.
-
-
-
a Schüler/in soll sich allmählich 3.3b ... bis Beine (an der Kniekehle) selbstständig ins Gleichgewicht brin- nur noch ganz leicht an den ausge- gen ... streckten Arm lehnen. Hand an der Hüfte hat losgelassen und ist nur
noch zur Sicherheit da.
-
Faust zwischen Knie geben, damit Schüler/in sich daran festklemmen kann, bis es gänzlich ohne Hilfe geht.
-
207

Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
.4. Pfau (mayuräsana)
5. Rad (cakräsana)
,,..
l
,1
Typische Fehler und Korrekturen
-
-
VORÜBUNG: Frosch-Pfau. Kopf und Knie heben (Gleichgewichts- und Kraftübung).
-
b ... Kopf auf den Boden ...
-
4.2d ... zweites Bein aus strecken .
�
' _ l
,,•
......111111 ✓
_!:i..••--·
4.2a ANFANGSPOSITION: Hände zwischen Knie geben, Finger Richtung Füße .
4.2c ... erstes Bein ausstrecken
-
-
e ... Kopf vom Boden heben.
-
a HILFE: Über Schüler steigen und mit Unterschenkeln das Becken leicht festklemmen. Dies verhindert, dass er umfällt ...
-
-
la HILFESTELLUNG AUS DER STANDPDSITION:
Taille mit beiden Händen umfassen und Schüler/in so lange bei der Rück beuge unterstützen, bis seine/ ihre Hände den Boden berühren.
5.lc
5.lb
-
-
Um die Dehnung im Brustkorb zu optimieren, gib die Hände unter die Schultern des Schülers und ziehe acht sam nach oben hinten.
4.3b ... Beine des Schülers an den Oberschenkeln anheben.
5.3 HILFESTELLUNG MIT YOGAGURT: Statt der Hände kann man auch einen Gurt benut zen. VORTEIL: Man kann das eigene Körper gewicht gezielter einsetzen.
.!llt',..,,,.......
.,: � '
. .
-
,,. ,�" ·-. ..
,. ,,..,__,.
4.4 ALTERNATIVE: Vogelstellung auf
Kissen, als einfache Abwandlung.
208

Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
-
Skorpion (vrscikäsana)
-
Kamel (usträsana)
Typische Fehler und Korrekturen
-
Schüler/in greift selbst ständig an die Fersen oder Fußgelenke.
HILFE: Seitlich am oberen Rücken halten und nach oben ziehen. Oberschenkel bleiben senkrecht.
6.la AUSGANGSPOSITION ElLENBOGENSTAN0:
Mit etwas Schwung die Beine hinterei nander nach oben geben.
HILFE: Füße parallel zu den Unter armen des Schülers stellen, an den Hüften unterstützen ...
-
-
-
-
-
lb ... und halten, bis Schüler/in das Gleichgewicht gefunden hat.
-
-
Durch die stärkere Dehnung des Brustkorbs, können Kopf und Schultern etwas tiefer sin ken. Hände fassen in die Fuß sohlen.
-
-
a AUSGANGSPOSITION: Kopfstand. Knie 6.2b ... den rechten Fußballen zwischen anwinkeln und Füße nach hinten die Schulterblätter geben und den geben. Brustkorb noch etwas weiter nach HILFE: Fußgelenke/Fersen halten ... vorne drücken.
-
HILFE: Faust zwischen den Füßen halten, damit Schüler/in sich notfalls daran festklammern kann.
-
7.3a BEI SEHR FLEXIBLEN SCHÜLER: Mit
einer Hand an der Brustwirbelsäule den Brustkorb nach vorne schieben. Mit der anderen Hand den Ellen bogen nach hinten schieben (gut für Flexibilität in Schultern und oberem Rücken) ...
7.3b ... Schüler/in seitlich am oberen Rücken halten, wenn er/sie sich lang sam nach hinten lehnt ...
6.4 HILFE FÜR SPAGAT IM SKORPION: Linkes Bein loslassen. Schüler/in streckt es so weit wie möglich nach vorne aus, während das rechte Bein weiterhin unterstützt wird. Wechseln.
7.3c ... so lange halten, bis die Hände auf dem Boden, an den Fußsohlen oder Fußgelenken angelangt sind.
209
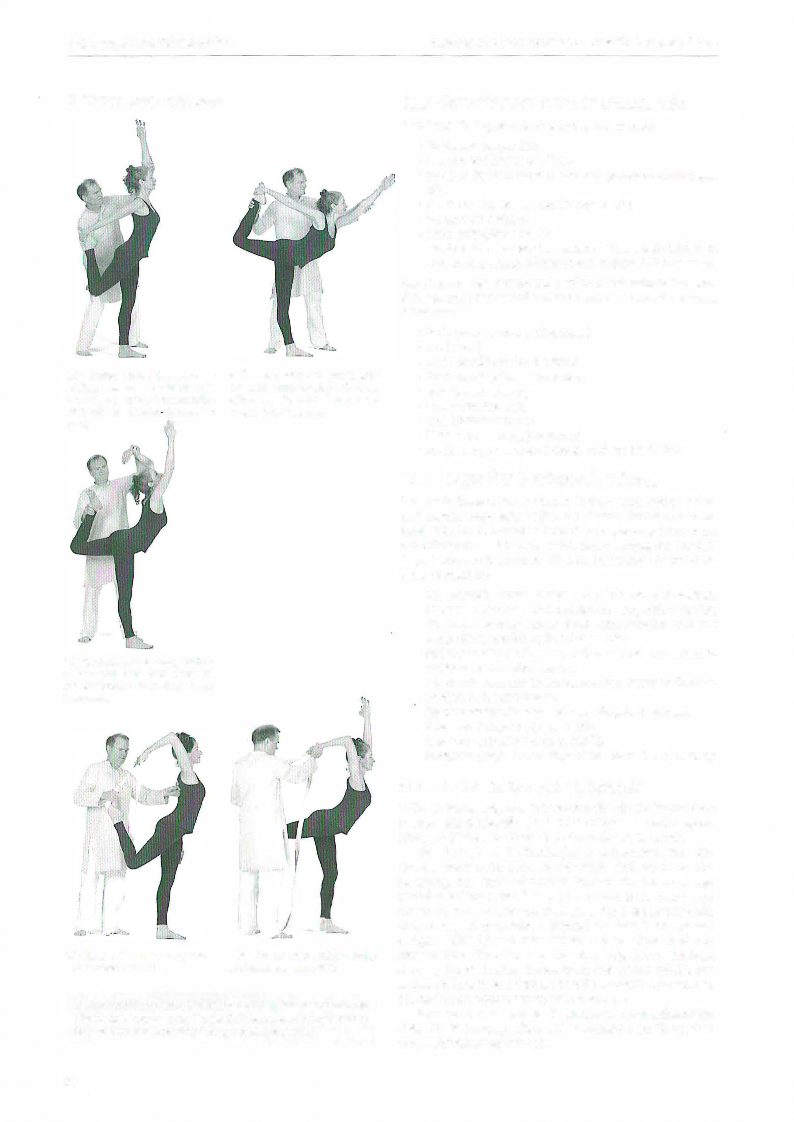
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken Variationen der Grundstunde • Yoga für Fortgeschrittene
8. Tänzer (nataräjäsana)
8.la Rechtes Knie und linken Arm des Schülers nach oben ziehen (hilft der Dehnung im Hüft-/Oberschenkelbe
reich und im Schulter /O' berarmbe-
-
-
-
lb ... Schüler/in verlagert Oberkör per nach vorne. Yogalehrer/in unter stützt am Fußknöchel und Ellen
bogen. Seite Wechseln.
-
-
Variationen der Grundstunde
Man kann die Yogastunden variieren, indem man:
-
Stellungen länger hält.
-
manche Stellungen weglässt.
-
zu einer Stellung (oder mehreren) genauere Erklärungen gibt.
-
am Ende eine längere Meditation macht.
-
Variationen einbaut.
-
-
mehr prä,:,äyäma macht.
-
die Stunde mit einem besonderen Thema verbindet, z. B. Atembeobachtung, Affirmationen, geistige Wirkungen etc.
Das Schema der Grundstunde sollte dabei beibehalten wer den. Folgende Bestandteile sollten immer bei einer Yogastunde dabei sein:
-
Anfangsentspannung (saväsana)
-
om (3 Mal)
-
eine Atemübung (prä,:,äyäma)
-
Sonnengruß (sürya-namaskära}
-
eine Umkehrstellung
-
eine Vorwärtsbeuge
reich) ... 1;
-
eine Rückwärtsbeuge
-
-
Tiefenentspannung (saväsana)
-
om {3 Mal}, Abschluss-mantra, Gruß an die Meister
-
-
-
Yoga für Fortgeschrittene
Fortgeschrittenere Schüler/innen können auch stärker gefor dert werden. Yoga kann helfen, die eigenen Grenzen zu trans zendieren. Durch besonders intensiven hatha-yoga können die verschiedensten spirituellen Erfahrungen ermöglicht werden. Es gibt mehrere Methoden, um eine Yogastunde fortgeschrit tener zu machen:
-
Die Grundstellungen können intensiver gemacht werden.
-
Fortgeschrittenere Variationen können eingeführt werden.
-
Stellungen können länger {5-10 Min.) gehalten und mit cakra-Konzentration verbunden werden
-
-
-
-
Hineinhelfen in die fortgeschritte ne Variation: Hand (von oben) und Fuß auf derselben Seite näher zusam men geben.
-
Stellungen können länger gehalten werden und mit Affir mationen verbunden werden.
-
-
-
Die Stunde kann mit einem besonderen Thema verbunden werden, z. B. Achtsamkeit.
-
Ein paar Partnerübungen können eingebaut werden.
-
YoGA V1DYA-Bodywork (s. S. 214ff.}
-
YOGA V1ovA-Fitnessreihe (s. S. 213ff.}
-
Sonnengrußvariationen (Yoga Vidya Asana-Buch", S. 62 ff)
11.10.1 Unterrichten von Variationen
Halte die Reihenfolge der YOGA V10YA-Reihe ein. Du kannst dann in einer Stunde jeweils einen oder mehrere Variationszyklen einbauen (siehe „Das Yoga Vidya Asana-Buch", S. 133ff.}.
Wichtig ist, dass die Schüler/innen aufgewärmt sind. Min destens zwölf recht flotte Sonnengrüße sind die beste Vor bereitung. Bei Fortgeschrittenen können die Entspannungs perioden zwischen den Übungen entfallen und die Anfangsent spannung sehr reduziert werden. Die Tiefenentspannung sollte
1. aber nicht gekürzt werden. Hilfsmittel wie Seile, Wand, gegen seitiges Helfen können unterstützend wirken. Aber nicht ver
8.3a Hineinhelfen in die fortgeschrit- 8.3b ... bis zur vollen Stellung. Fortge- tene Variation mit Gurt ... schrittene greifen den Fuß.
Merke: Vergiss trotz aller Korrekturen nicht den Fluss der Stunde, die allgemeine Stimmung in der Stunde, die Entspannung und die Atmung! Yoga ist nicht nur körperliche Übung, sondern viel mehr!
210
gessen: Eine Yogastunde sollte eine Yogastunde bleiben! Atmung, Konzentration, Bewusstheit und Halten mindestens einiger Stellungen sind wichtig. Der/die Lehrer/in braucht nicht alle Stellungen vorzumachen/ zu beherrschen.
BITTE BEACHTE: Ist der/die Yogalehrer/in nicht aufgewärmt, steigt die Verletzungsgefahr. Daher Vorsicht beim Vormachen fortgeschrittener Variationen.
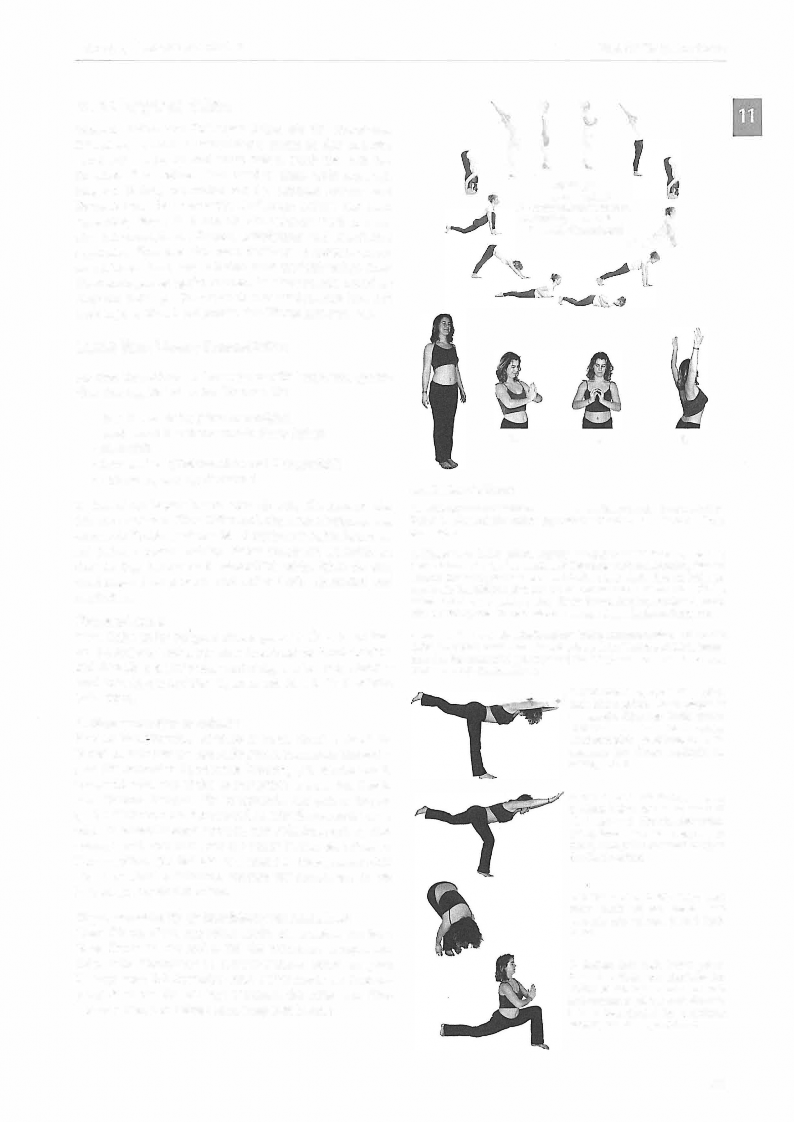
Hatha-yoga-U nterrichtstechniken
-
-
-
Längeres Halten
Längeres Halten der Stellungen bringt oft die intensivsten Erlebnisse. Um dies zu unterrichten, musst du dies natürlich selbst schon erfahren und erlebt haben. Durch theoretisches Sprechen über cakras allein werden diese nicht angeregt.
Längeres Halten, verbunden mit der richtigen Atmung und
[ff, ·, ff
r
,
f 1'.
,_ [ L....
Sonnengruß
Yoga für Fortgeschrittene
�-
Konzentration, ist notwendig. Stellungen sollten nur dann regelmäßig länger als 5 bzw. 10 Min. gehalten werden, wenn die Teilnehmer/innen äsanas, prä,:iäyäma und Meditation regelmäßig üben und eine reine Ernährung beachten. Anson sten können durch langes Halten auch ungleichmäßige Ener gieerfahrungen ausgelöst werden. In einer Stunde brauchen nicht alle Stellungen länger gehalten zu werden. Man kann sich auch in jeder Stunde auf jeweils eine Übung konzentrieren.
-
YOGA V1ovA-Fitness-Reihe
Die YOGA V1DYA-Fitness-Reihe angepasst für komplettes sportli ches Training. Sie beinhaltet Übungen für:
-
Konditionstraining (siJrya-namaskära)
-
Muskelkraft (der Schwerpunkt dieser Reihe)
-
Flexibilität
-
Koordination (Gleichgewicht und Körpergefühl)
-
Tiefenentspannung (saväsana)
1.
Grundstellung (tä(läsana)
(sürya-namaskära)
-
Runden klassische Variation.
f
Sehr wichtig zum Aufwärmen. :-' Keinesfalls überspringen!
&...,,,,,;,,,'\\._
2. 3.
So kannst du innerhalb von etwa 45 Min. alle Systeme des Körpers trainieren. Ohne Hilfsmittel, ohne Fitness-Studio! Das effektivste Training auf der Welt! Geringerer Zeitaufwand als bei jedem anderen Training. Dabei angenehm auszuführen. Und da Yoga immer auch feinstofflich wirkt, fühlst du dich anschließend aufgeladen und voller Kraft, Kreativität und Inspiration.
Übungsanleitung:
Diese Reihe ist für Fortgeschrittene gedacht. Übe sie am bes ten 1-2 Mal pro Woche. Für die Entwicklung von Muskelkraft ist tägliches Üben dieser Reihe nicht nötig, sondern sogar kontra produktiv. An den anderen Tagen kannst du z. B. die klassische Reihe üben.
1. SiJrya-namaskära-Grundreihe
Herz-Kreislauf Training. Mindestens zwölf Runden klassische Variation. Sehr wichtig zum Aufwärmen. Keinesfalls übersprin gen! Für optimales Herz-Kreislauf-Training gilt: Mindestens 61 besser 12 Min. lang zügige Sonnengrüße, welche den Puls in eine Zielzone bringen. Für Yogaübende mit gutem Körper gefühl gilt: Mache den Sonnengruß so schnell, dass es dir warm wird, du vielleicht sogar schwitzt, den Pulsschlag spürst, aber dennoch weiterhin ruhig und tief atmen kannst. Bei schnellen Sonnengrüßen gilt: Gehe in den einzelnen Bewegungen nicht bis zur maximalen Dehnung, sondern nur soweit, wie du die Dehnung nicht wirklich spürst.
SiJrya-namaskära für die Entwicklung von Muskelkraft
Diese Übung allein entwickelt schon die meisten Muskeln. Diese Übung ist der größte Teil des Kraftübungsprogramms. Keinesfalls überspringen! Normalerweise hältst du jede Stellung etwa 5-8 Atemzüge lang. Dabei maximale Anstren gung! Aber nur die Muskeln benutzen, die nötig sind. Alles andere auf yogische Weise ganz entspannt halten!
-
Hände vor dem Brustkorb zusammen geben. Etwas von der Brust weghalten. Dabei die Handgelenke kräftig gegeneinanderdrücken. Dies stärkt die Brust muskulatur.
-
Hände etwas höher geben. Fingerspitzen gegeneinanderdrücken, dabei die Finger leicht einkrallen. Fingerspitzen kräftig so gegeneinanderdrücken, dass die Unterarmmuskeln gefordert werden. Wichtig: Handgelenke sind nur leicht ge beugt, die Handflächen sind nur 2-4 cm voneinander entfernt! Diese Übung stärkt die Unterarmmuskeln, welche für die äsanas Skorpion, Handstand, Krähe, Pfau so wichtig sind. Und natürlich für gesunde Handgelenke am Computer!
-
Arme heben und die Schulterblätter kräftig zusammenziehen. Du solltest dabei die oberen Rückenmuskeln gut spüren. Keine Rückbeuge! Stärkt beson ders den Kapuzenmuskel (M. trapezius) und beugt so Beschwerden im oberen Rücken und Schulterbereich vor.
-
Nach vorne beugen, dabei linkes Bein
�__..--r::iff nach hinten geben. Ganzer Körper ist
waagerecht. Stärkt das Gesäß, untere, mittlere und obere Rückenmuskeln, Schultermuskeln (M. deltoideus, Delta muskeln). Und fördert natürlich das Gleichgewicht!
-
Das Standbein bis 90 Grad beugen, die Ferse heben. Dies stärkt zusätzlich die Unter- und Oberschenkelmuskeln (M. gastrocnemius, M. quadriceps fe moris). Eine große Herausforderung für das Gleichgewicht!
-
Ferse senken, beide Beine nach vorne, Hände auf den Boden. Beine gestreckt oder gebeugt, je nach Flexi bilität.
-
Rechtes Bein nach hinten geben. Knie etwa 10-25 cm oberhalb des Bodens halten. Hände vor dem Brust korb zusammen geben. Stärkt die Mus keln in Oberschenkel (M. quadriceps femoris) und Gesäß (M. gluteus).
211
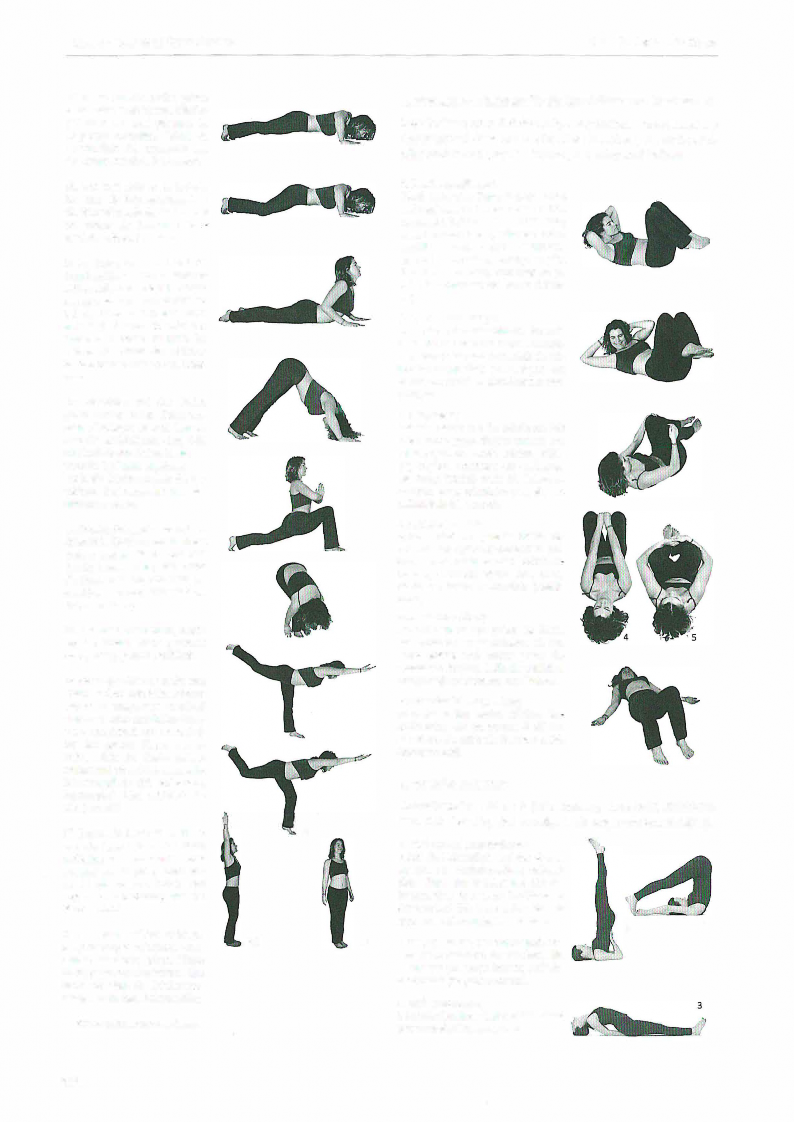
H atha-yoga-Unterrichtstechniken
Ba. Hände auf den Boden geben, beide Beine nach hinten. Ellenbo gen etwa 90 Grad gebeugt. Im Liegestütz verweilen. Stärkt die Brustmuskeln (M. pectoralis) und die Oberarmmuskeln (M. trizeps).
8b. Wer noch nicht so starke Arme hat, kann die Knie aufsetzen. Aber die Brust oberhalb des Bodens hal ten, sodass die Arme und Brust muskeln gefordert werden.
-
Zur Kobra kommen. Dabei die Schulterblätter kräftig zusammen ziehen (stärkt die oberen Rücken muskeln, M. trapezius). Stemme da bei die Hände fest in den Boden und stelle dir vor, du willst den Boden nach hinten zur Hüfte hin ziehen. Das stärkt die seitlichen breiten Rückenmuskeln (M. latissi mus).
-
Fußsohlen auf den Boden geben. Becken heben, Beine stre cken. Ellenbogen so weit beugen, dass die Schädeldecke etwa 5-10 cm oberhalb des Bodens bleibt. Vorsicht: Kopf nicht au(setzen! Stärkt die Schultermuskeln (M. del toideus, Deltamuskeln) und die Oberarmmuskeln.
-
Rechten Fuß nach vorne geben. Linkes Knie 10-25 cm oberhalb des Bodens halten. Hände vor dem Brustkorb zusammen geben. Stärkt die Muskeln in Oberschenkel (M. quadriceps femoris) und Gesäß (M. gluteus maximus).
-
Beide Beine nach vorne, Hände auf den Boden. Beine gestreckt oder gebeugt, je nach Flexibilität.
-
Oberkörper heben, parallel zum Boden. Rechtes Bein heben. Ganzer Körper ist waagerecht, eventuell Arme und Beine auch höher (Men schen mit Rückenbeschwerden hal ten den ganzen Körper waage recht). Stärkt das Gesäß, untere, mittlere und obere Rückenmuskeln, Schultermuskeln (M. deltoideus, Deltamuskel). Und natürlich das Gleichgewicht!
-
Das Standbein bis 90 Grad beu gen, die Ferse heben. Dies stärkt zusätzlich die Unter- und Ober schenkelmuskeln (M. gastrocnemi us, M. quadriceps femoris). Eine große Herausforderung für das Gleichgewicht!
Yoga für Fortgeschrittene
2. Näväsana-Variationen für die Entwicklung von Muskelkraft
Jede Stellung etwa 5-8 Atemzüge lang halten. Dabei maximale Anstrengung! Aber nur die Muskeln benutzen, die nötig sind. Alles andere auf yogische Weise ganz entspannt halten!
-
Bauchmuskelübung 1
Hände hinter dem Kopf falten, Fußsohlen flach auf dem Boden oder Füße heben. Lendenwirbelsäule in den Boden stem men. Brustkorb heben, dabei die Bauch muskeln stark anspannen. Gesicht ent spannt lassen. Halten, so lange es geht. Dann langsam senken. Entwickelt die ge raden Bauchmuskeln (M. rectus abdomi nis).
-
Bauchmuskelübung 2
Linke Hälfte des Brustkorbs und die rech te Hälfte des Beckens heben. Anschlie ßend die andere Seite. Entwickelt die seit lichen Bauchmuskeln (M. Obliquus und rectus abdominis). Weitere Bauchmuskel übungen.
-
Bizepsübung
Mit den Händen um die Knie fassen. Mit den Händen gegen die Knie und mit den Knien gegen die Hände drücken. Kräftig gegenhalten. Entwickelt die Armbeuger (M. biceps brachii) sowie die Unterarm muskeln. Etwas schwächer auch die Ge säßmuskeln (M. gluteus).
-
Adduktorenübung
Auf dem Rücken liegend die Fäuste zwi schen die Knie geben. Mit den Knien kräf tig gegen die Fäuste drücken (nicht über treiben, wenn du starke Beine hast). Stärkt die innere Beinmuskeln (Adduk toren).
-
Abduktoren-Übung
Die Arme um die Knie geben, die Hände falten oder die Finger verhaken. Mit den Knien kräftig nach außen gegen die Unterarme drücken. Stärkt die seitlichen Beinmuskeln (Abduktoren und Gluteus).
-
Oberschenkel-Bizeps-Übung
Füße fest in den Boden drücken. Ver suche dabei, den Boden zum Gesäß hin zu ziehen. Dies stärkt die Beinbeuger (M. biceps femoris).
3. Flexibilitäts-äsanas
Normalerweise hältst du jede Stellung etwa 8-12 Atemzüge
14 lang. Dabei sanfte, gleichmäßige Dehnung ohne Anstrengung.
-
Schulterstand (sarväilgäsana)
Dehnt die Halsmuskeln und den oberen Rücken. Als Umkehrstellung aktiviert diese Übung den Kreislauf und hilft der Regeneration. Wer nach Kraftübungen Schulterstand übt, hat weniger Muskel
-
Beide Beine auf den Boden ge ben, Oberkörper aufrichten. Hand flächen zusammen geben. Hände kräftig gegeneinanderdrücken. Dies stärkt vor allem die Schultermus keln (M. deltoideus, Deltamuskeln).
-
Arme senken. Zwischenatmen.
212
15 16
kater und größeres Muskelwachstum!
2
1
-
Pflug (ha/iisana; mit Armen nach hin ten) Dehnt zusätzlich die Schultern, die Beinbeuger (M. biceps femoris) und Wa denmuskeln (M. gastrocnemius).
-
Fisch (matsyäsana)
Dehnt den Brustkorb und den Hals. Stärkt aber auch die Rückenmuskeln.

H atha-yoga-Unterrichtsteehniken
-
Vorwärtsbeuge (pascimottiiniisano) Dehnt die Beinmuskeln (M. biceps femo ris, M. gastrocnemius) und Gesäßmus keln (M. gluteus).
-
Schmetterling (bhadriisona)
Hände um die Füße geben. Die Knie nach unten senken. Noch wirksamer: Ellenbo gen auf die Knie oder mit den Händen die Knie runter drücken (ohne Abb.). Dehnt die Adduktoren.
-
Grätschbeinige Vorwärtsbeuge
(upa-vistha-ko,:iiisana)
Füße, so weit es geht, auseinander ge ben. Dann Oberkörper mit geradem Rücken nach vorne lehnen. Fußknöchel mit den Händen umfassen. Acht Atem züge lang halten. ODER: Jemand drückt, etwas oberhalb der Knie des Schülers mit den Füßen an die Innenseite der Oberschenkel und zieht dabei sanft an seinen Händen (siehe S. 217, 8). Diese Übung dehnt die Innenseite (die Adduktoren) der Beine.
-
Kobra (bhujarigiisana)
Hände auf den Boden geben, Brustkorb und Kopf heben. Gesäß anspannen, um unteren Rücken zu schützen.
Vorsicht: Nur so weit gehen, wie es im unteren Rücken angenehm ist! Dehnt Brustkorb, Bauch und die Kehle. Stärkt auch alle Rückenmuskeln.
-
Bogen(dhanuriisana)
An die Fußgelenke fassen, Füße und Brustkorb heben. Stärkt die Oberschenkel und die Rückenmuskeln. Dehnt die Ober schenkelmuskeln, die Lendenmuskeln (M. psoas), Bauch, Brust und Kehle.
-
Halbmond (iinjaneyiisana)
Einen Fuß nach vorne, einen nach hinten. Knie am Boden, Fuß gestreckt. Brustkorb und Arme nach hinten. Beide Seiten üben. Dehnt Oberschenkelmuskeln (M. quadriceps femoris), Lendenmuskeln (M. psoas), Bauchmuskeln (M. rectus abdo minis), Brustkorb, breite Rückenmuskeln (M. latissimus dorsi) und Kehle.
10a. Halber Drehsitz (ardha-matsyendrii sana) Dehnt Hüftgelenke, Gesäß- und Brustmuskeln. 10b. VARIATION: Drehsitz Hände greifen einander.
11. Tiefenentspannung (saviisana)
10 Min. Tiefenentspannung führen zu einer umfassenden Regeneration. So be kommst du weniger (oder gar keinen) Muskelkater selbst nach einer anstren genden Yogasitzung. Du fühlst dich nach dem Training/der Yogasitzung voller Kraft und Energie, leicht und beschwingt.
Anleitung für die nefenentspannung Füße etwas auseinander geben, Arme vom Körper weg, Handflächen nach oben. Kopf in der Mitte. Falls diese Haltung im unteren Rücken nicht ganz angenehm ist, kannst du ein Kissen, eine Rolle oder eine gerollte Decke unter die Knie legen. Kör perteile von unten nach oben anspannen, 5 Sek. angespannt lassen, loslassen, nach spüren.
Yoga für Fortgeschrittene
AurosuGGESTION: Körperteile von unten nach oben bitten, sich zu entspannen:
,,Ich entspanne die Füße (dreimal wiederholen). Ich entspanne die Waden (drei mal). Ich entspanne die Oberschenkel ... "
V1suAus1ERUNG: Stelle dir eine wunderschöne Gegend vor, irgendwo in der Natur, wo du dich ganz geborgen und ganz wohl fühlen kannst. Male dir alle Einzelheiten aus. Die Natur um dich herum, den Himmel, spüre die Erde unter dir. Fühle dich eins mit deiner Umgebung.
AFFIRMATION: Wiederhole eine oder mehrere Affirmationen: ,,Mein Rücken fühlt sich ganz wohl", ,,Meine Bandscheiben sind stark und flexibel", ,,Ich bin in Harmonie mit mir selbst", ,,Ich werde meine Aufgabe freudig und erfolgreich erledigen" o. ä. Finde das, was am ehesten das ausdrückt, was du erreichen willst.
LETZTE ANSAGE: ,,Atme tief durch. Strecke und räkele dich. Setze dich auf/ stehe auf. Wie fühlst du dich jetzt? Ich wünsche dir (euch) einen schönen Tag!"
-
-
-
Sukadevs Fitness-Reihe
-
-
(auch bekannt als Hanuman-Fitness)
Eine Variation der YOGA VIDYA-Reihe. Ideal für die Gesundheit
7 und Flexibilität aller Körperteile. Beugt allen Rücken-, Hals- und sonstigen Beschwerden vor. Erweckt die Lebensenergie und führt zu einem freudigen Gemüt für den ganzen Tag.
Diese Übungsreihe ist für fortgeschrittenere Schüler gedacht, die mit der YOGA VIDYA-Reihe vertraut sind. Sie erfordert zwar
8 keine große Flexibilität, aber gute Koordinationsfähigkeit. Es rentiert sich in jedem Fall, sie zu erlernen! Du kannst sie täglich üben oder im Wechsel mit der YOGA V1ovA-Fitness-Reihe und der
klassischen YoGA V1DYA-Reihe.
DAUER: Rund 65 Min. mit und rund 30 Min. ohne prä(läyäma und Tiefenentspannung. Diese und andere Übungsreihen kannst du in den Yoga-Bodywork-Seminaren und Yogalehrer ausbildungen im Haus YOGA V1DYA lernen.
Schnellatmung (kapiila-bhiiti) und Wechselatmung (anuloma-viloma)
Drei Runden kopiilo-bhiiti und 20 Min. onuloma-vilama-p. Besonders wirksam sind diese prii,:iiiyiimas in Verbindung mit bandhas und samanu-Konzentra tionstechniken.
Sonnengruß (surya-namaskiira)
Zwölf flotte Runden. Sehr wichtig zum Aufwärmen.
Yogastellungen (iisanas) werden ruhig und gleichmäßig gehalten. Wichtig ist:
-
ein gleichmäßiger, ruhiger und tiefer Atem (Bauchatmung oder vollstän dige Yogaatmung).
-
Bewusstheit und Konzentration, am besten auf das bei der betreffenden Übung angesprochene cakra.
-
eine entspannte Geisteshaltung. Auch wenn das iisana mal anstrengend ist, bleiben dennoch der Geist und alle nicht benötigten Körperteile voll kommen entspannt.
-
Bauchmuskelübung
Zwölfmal mit dem Atmen Brustkorb heben und senken: Ausatmen, dabei
11 Brustkorb heben. Einatmen, dabei Brust korb senken.
-
Spagat (Vorübung mit Yogagurt)
auf dem Rücken liegend. Fuß zum Kopf ziehen. Acht Atemzüge lang halten. Seite wechseln.
OHNE YOGAGURT: Mit beiden Händen an den Fuß fassen (Rest wie mit Gurt).
213

Hatha-yoga-Unterrichtstechniken Yoga für Fortgeschrittene
3, Skorpion (mit gegrätschten Beinen) Alles Gewicht ist auf den Ellenbogen. Kopf dabei locker nach unten hängen lassen. Oder, wenn möglich, leicht anheben und nach hinten geben. Zwölf Atemzüge lang halten. Seite wechseln. Das schwerste asana dieser Reihe, aber besonders wirk sam gegen alle Arten von Rückenbe schwerden.
4. Schulterstand (sarvatigasana)
1-3 Min. halten.
5, Pflug (halasana; mit Armen nach hin ten) Acht Atemzüge lang halten.
-
Fisch (matsyasana) im Lotos
\'-
4
-
Stehende Vorwärtsbeuge
.,,,,, (pada-hastäsana) acht Atemzüge lang halten.
-
Tänzer (nataräjasana) senkrecht Jeweils acht Atemzüge lang halten.
-
Dreieck (tri-kol}äsana)
Jede Seite acht Atemzüge lang halten.
-
Tiefenentspannung (savasana)
5
5-8 Min. Schon 5 Min. Tiefenentspan nung führen zu einer umfassenden Regeneration. So bekommst du weni ger (oder gar keinen) Muskelkater selbst nach einer anstrengenden Yogasitzung. Du fühlst dich nach dem Training/der Yogastunde voller Kraft und Energie, leicht und beschwingt.
�.:-.._.:-,_...
Zehn Atemzüge lang halten.
-
-
Vorwärtsbeuge (pascimattanasana)
1-5 Min. lang halten.
-
Schmetterling (bhadrasana)
Hände um die Füße geben. Die Knie nach unten senken. Noch wirksamer: Ellen bogen auf die Knie oder mit den Händen die Knie runter drücken (o. Abb.). Acht Atemzüge lang halten.
-
Grätschbeinige Vorwärtsbeuge
(upavi�tha-ka(lasana)
Füße so weit es geht auseinander geben. Dann Oberkörper mit geradem Rücken nach vorne lehnen. Fußzehen mit den Händen umfassen. Acht Atemzüge lang
�
/�7
8
•
9
;t
.r
Anleitung für die Tiefenentspannung Füße etwas auseinander geben, Arme vom Körper weg, Handflächen nach oben. Kopf in der Mitte. Falls diese Haltung im unteren Rücken nicht ganz angenehm ist, kannst du ein Kissen,
eine Rolle oder eine gerollte Decke unter die Knie legen. Körperteile von unten nach oben anspannen, 5 Sek. angespannt lassen, loslassen, nachspüren.
AUTOSUGGESTION: Körperteile von unten nach oben bitten, sich zu entspannen:
,,Ich entspanne die Füße (dreimal wiederholen). Ich entspanne die Waden (drei mal). Ich entspanne die Oberschenkel ... "
V1suAus1ERUNG: Stelle dir eine wunderschöne Gegend vor, irgendwo in der Natur, wo du dich ganz geborgen und ganz wohl fühlen kannst. Male dir alle Einzelhei ten aus. Die Natur um dich herum, den Himmel, spüre die Erde unter dir. Fühle dich eins mit deiner Umgebung.
Atme tief durch. Strecke und räkele dich. Setze dich auf bzw. stehe auf. Am
halten. ODER: Jemand drückt etwas ober halb der Knie des Schülers mit den Füßen an die Innenseite der Oberschenkel und zieht dabei sanft an seinen Händen (siehe
-
besten gleich die Meditation folgen lassen (5-45 Min.).
LETZTE ANSAGE: Atme tief durch. Strecke und räkele dich. Setze dich auf bzw. stehe auf. Wie fühlst du dich jetzt? Ich wünsche dir einen schönen Tag!
S. 21'7, 8). Diese Übung dehnt die Innen ��
seite (die Adduktoren) der Beine.
-
-
Kobra (bhujatigasana)
Hände auf den Boden geben, Brustkorb und Kopf heben. Gesäß anspannen, um unteren Rücken zu schützen. Zehn Atem züge lang halten.
Vorsicht: Nur soweit gehen, wie es ange
nehm im unteren Rücken ist!
11.Bogen(dhanurasana)
An die Fußgelenke fassen, Füße und Brustkorb heben. Zehn Atemzüge lang halten. Anschließend in dieser Stellung zwölfmal vor und zurück schaukeln.
-
Halbmond (änjaneyasana)
Einen Fuß nach vorne, einen nach hinten. Knie am Boden, Fuß gestreckt. Brustkorb und Arme nach hinten. Beide Seiten üben.
-
Drehsitz (matsyendrasana)
Dehnt Hüftgelenke, Gesäß- und Brustmus keln. Jeweils 1-2 Min. lang halten.
-
Pfau (mayüräsana)
Gewicht auf die Ellenbogen geben. Zehn Atemzüge lang halten.
214
),�A,, )
... ,
-
11.10.s YOGA V10YA-Bodywork
Gegenseitiges Helfen in fortgeschrittene äsanas
Schnelle Fortschritte für Flexibilität und Körperbeherrschung durch Partnerübungen. Für fortgeschrittenere Yogaübende und Yogalehrer. Dieser Übungsplan baut auf der YOGA VIDYA Reihe auf, die optimal Körper, Geist und Seele entwickelt. Die
-
Übungen dieser Reihe kannst du in den YOGA-VIDYA-Bodywork
Seminaren mit Partner-äsanas im Haus YOGA VIDYA in Work shops für fortgeschrittene in den YoGA V1DYA-Zentren sowie in den Yogalehreraus- und Weiterbildungen YOGA V1DYAS lernen. Diese Seite ist nicht zum Erlernen der Übungen gedacht, son dern als Gedächtnisstütze, wenn du die Übungen schon kennst. Sie können auch einzeln an der entsprechenden Stelle der YOGA V1DYA-Reihe eingefügt werden.
-
liegender Spagat (eka-päda-siräsana)
-
Skorpion (vrscikäsana)
-
Schulterstand (sarvärigäsana)
-
Pflug (ha/äsana)
-
Rad (cakräsana)
-
Fisch (matsyäsana)
-
14 7. Vorwärtsbeuge (pascimottänäsana)
-
Grätschbeinige Vorwärtsbeuge (upaviJtha-kol)äsana)
-
Schmetterling (bhadräsana)
-
Kniende Rückbeuge (vojräsana)
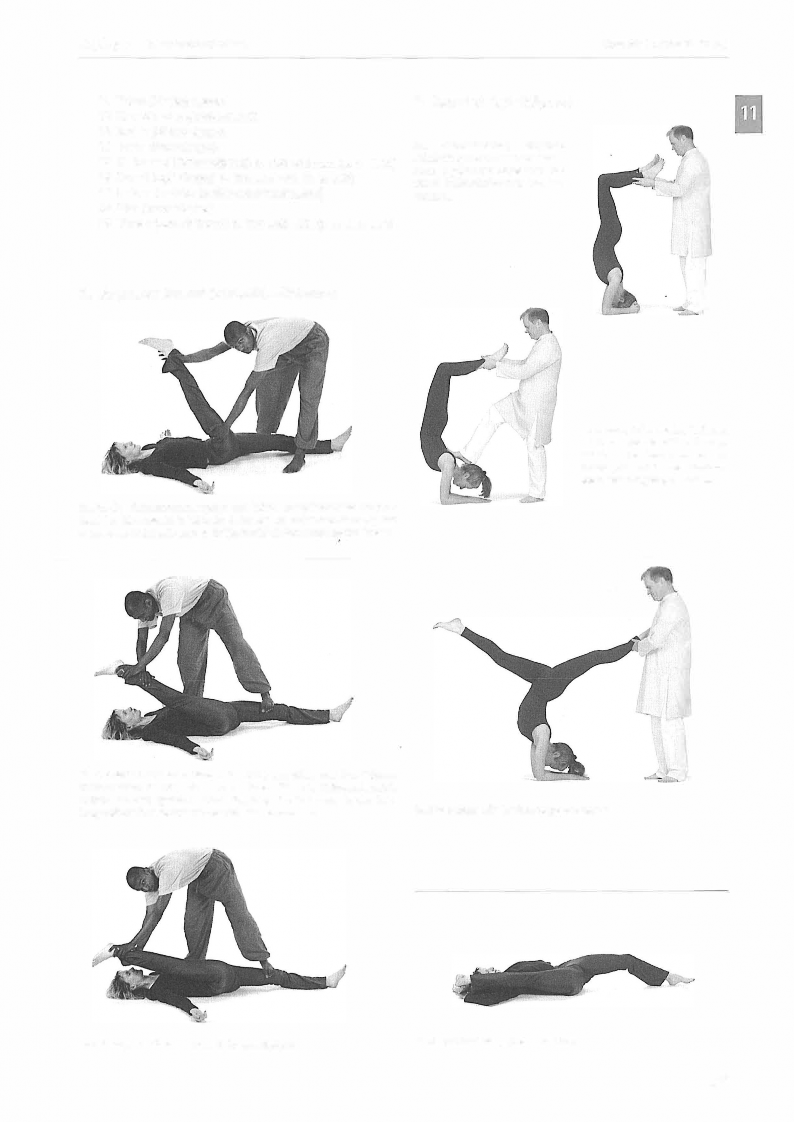
H atha-yoga-Unterrichtstechniken
-
Kobra (bhujarigäsana)
-
Heuschrecke (salabhäsana)
-
Bogen (dhanuräsana)
-
Taube (kapotäsana)
-
Halbmond (äfijaneyäsana) o. Text und Abb. (s, S. 213f)
-
Kamel (u�thräsana) o. Text und Abb. (s. S. 209)
-
Halber Drehsitz (ardha-matsyendräsana)
-
Pfau (mayuräsana)
-
Tänzer (nataräjäsana) o, Text und Abb. (s. S. 210, 214)
-
liegender Spagat (eka-päda-siräsana)
la, Aus der Rückenentspannungslage Bein heben. Der Helfende zieht mit einer Hand den Oberschenkel in Nähe der Hüfte weg, um mehr Raum im Hüftgelenk zu erzeugen. Gleichzeitig kann er die Wade oder die Ferse zum Kopf hin drücken,
-
Skorpion (vrscikäsana)
2a. AUSGANGSPOSITION KOPFSTAND:
Schüler/in gibt die Füße nach hinten, HILFE: Yogalehrer/in stützt bzw. hält dabei Fußknöchel/Fersen mit den Händen ,,,
Yoga für Fortgeschrittene
2b und gibt den rechten Fußballen
zwischen die Schulterblätter. Dies ver anlasst den Brustkorb nach vorne zu kommen, dadurch kann der Kopf vom Boden etwas angehoben werden.
lb. Mit einer oder beiden Händen den Fuß immer näher zum Kopf drücken. Vorsicht: Wenn die liegende ein Ziehen in der Nähe des Hüftgelenks spürt, besteht Verletzungsgefahr. Nur so weit gehen, wie die Dehnung in den Knie beugersehnen bzw. im unteren Oberschenkel zu spüren ist
lc, Bei Fortgeschrittenen geht das Bein ganz hinunter.
2c, Eine weitere Hilfe für den Spagat im Skorpion.
◄ ld.Der letzte Teil geht besser alleine,
215
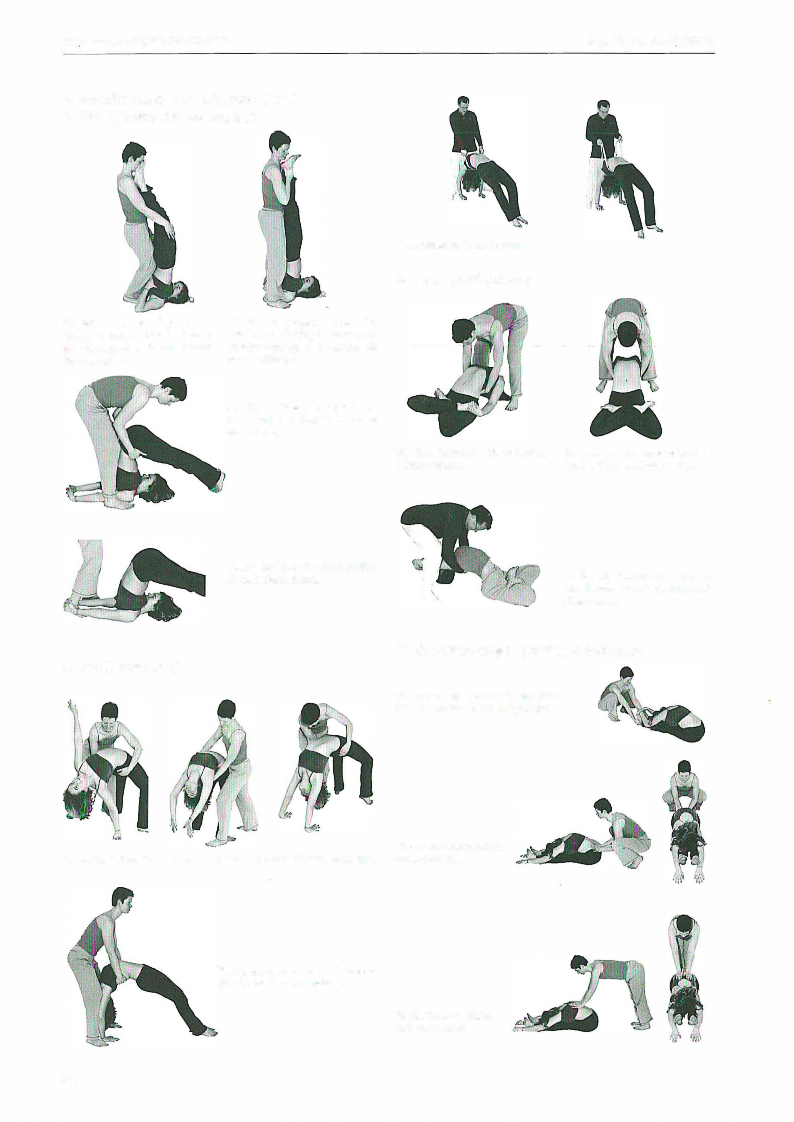
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken Yoga für Fortgeschrittene
-
Schulterstand (sarvängösana) und
-
Pflug (haläsana) kombiniert
Sc. Eventuell auch mit Yogagurt.
6. Fisch (matsyäsona)
3a. Knie gegen das Becken, das Becken wegdrücken. Mit den Händen die Oberschenkel in die andere Richtung ziehen.
3b. Andere Möglichkeit: Mit den Füßen die Ellenbogen zusammen drücken und mit den Händen die Füße hochheben.
4a. Mit den Händen in die Hüftbeuge fassen und den Rumpf etwas nach oben ziehen.
4b. Mit der Ferse die gefalteten Hän de nach hinten ziehen.
6a. Den Brustkorb mit gefalteten Händen heben ...
6b bis der Brustkorb so hoch ist,
dass der Kopf den Boden verlässt.
6c. Um die Dehnung zu verstärken, kann der/die Übende die Arme nach hinten geben.
-
Rad (cakräsano)
Sa. Von der Stehposition in das Rad helfen, bis die Hände auf dem Boden sind.
7. Vorwärtsbeuge (pascimottönäsana)
7a. An den Fersen die Beine lang ziehen. Dies schafft Raum in den Hüftgelenken.
7b. Am Beckenkamm nach vorne schieben.
Sb. Weiterhelfen, um die Dehnung vor allem im Brustkorb zu erreichen.
7c. Am mittleren Rücken nach vorne unten.
216
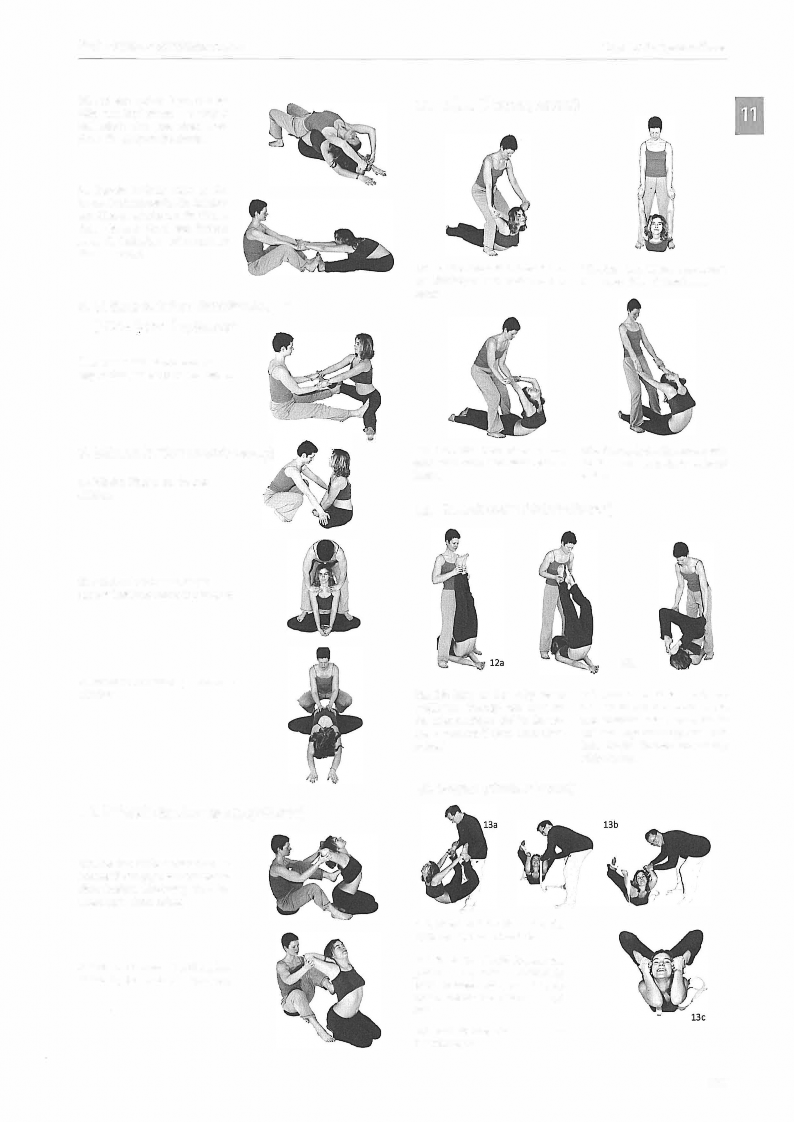
H atha-yoga-U nterrichtstech niken
7d. Auf den Rücken legen und die Füße zum Kopf ziehen. Für den/die Helfende/n eine gute Flexibilitäts übung für die Brustwirbelsäule.
11. Kobra (bhujarigasana)
Yoga für Fortgeschrittene
7e. Der/die Helfende zieht an den Armen. Dadurch werden die Schulter und Ellbogengelenke und die Wirbel säule gedehnt. Durch das Drücken gegen die Fußballen werden auch die Waden gedehnt.
8. Grätschbeinige Vorwärtsbeuge
( upa-vistha-ko,:,asana)
-
Mit den Füßen die Oberschenkel wegdrücken, um die Hüften zu öffnen.
-
Schmetterling (bhadrasana)
9a. Mit den Händen auf die Knie drücken.
9b. Auf die Oberschenkel steigen.
Nur bei flexibleren Menschen möglich!
9c. Aus dem Schmetterling nach vorne schieben.
lla. Hände hinter dem Kopf falten. llb. Arme nach hinten ausstrecken. Die Ellenbogen nach hinten ziehen Dann nach hinten ziehen lassen. lassen.
llc. Die Arme nach oben ausstre- lld. Falls das in den Ellenbogen oder cken. Dann sanft nach hinten ziehen Schultern schmerzt: Arme gestreckt lassen. halten.
12. Heuschrecke (salabhasana)
12b
12a. Die Beine an den Fußgelenken 12b. Nur bei sehr Flexiblen möglich: hochheben. Wichtig! Das muss für Füße weiter nach hinten ziehen, die den unteren Rücken und für den Na- Knie anwinkeln. Füße senken, bis sie cken angenehm bleiben. Nicht über- auf dem Kopf angelangt sind. Nun treiben! kann der/die Übende die Stellung
alleine halten.
10. Kniende Rückbeuge (vajrasana)
10a. Mit dem Fußballen zwischen die Schulterblätter gegen die Brustwirbel säule drücken. Gleichzeitig die Ellen bogen nach hinten ziehen.
10b. Passive Dehnung. Der/Diejenige, dem/der geholfen wird, lässt ganz los.
13. Bogen (dhanurasana)
13a. Erfordert beim Helfenden viel Kraft: An den Armen hochheben.
13b. Winde jeweils ein Yogagurt um jeden Fuß. Der/die Helfende führt die Hand am Band entlang zum Fuß, bis beide Hände an den Füßen angelangt sind.
13c. Dies ist pürna-dhanurtisana - der volle Bogen.
217
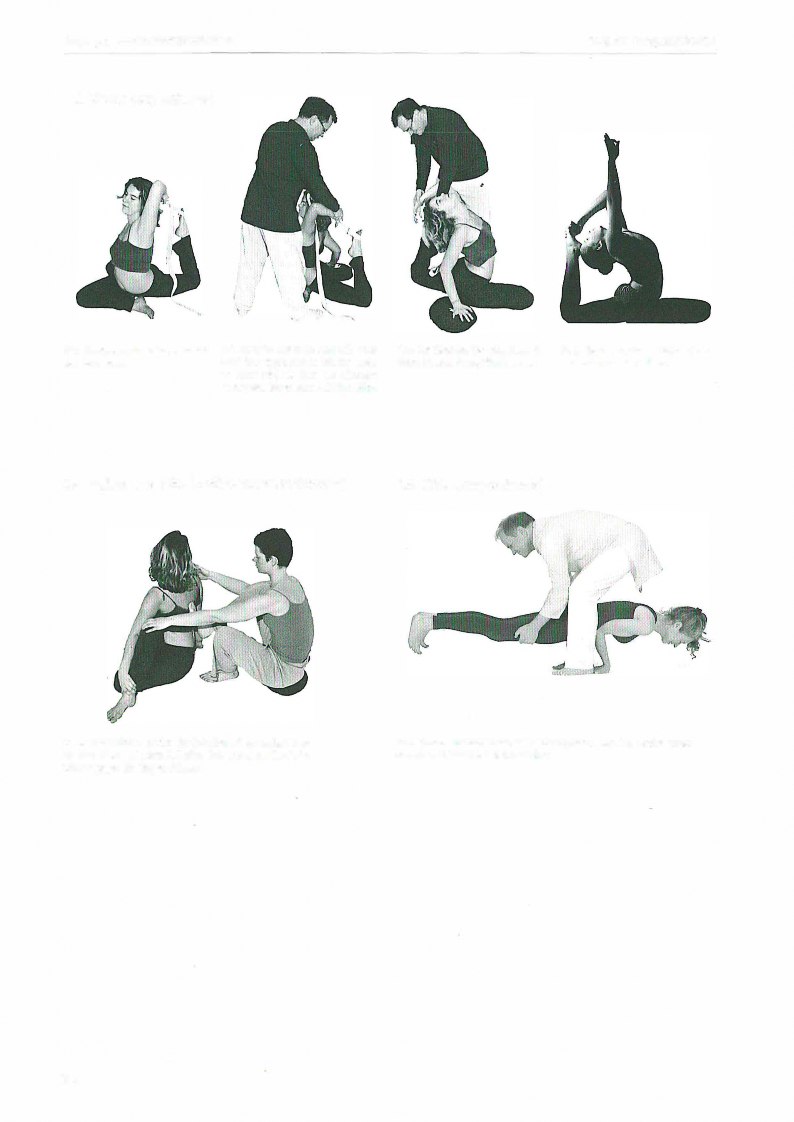
Hatha�yoga-Unterrichtstech n i ke n
14. Taube (kapotäsana)
14a. AUSGANGSSTELLUNG: Yogagurt um 14b. Der/die Helfende hält mit einer den Fuß geben. Hand den Yogagurt fest. Mit der ande ren Hand wird die Hand des Übenden
entlang des Gurtes zum Fuß hingeführt.
17. Halber Drehsitz (ardha-matsyendräsana)
17. Mit der rechten Hand an der Schulter, mit der linken Hand am Knie ziehen. Mit dem Fußballen links neben der Brustwir belsäule gegen die Rippen drücken.
218
Yoga für Fortgeschrittene
14c. Bei flexiblen Übenden kann die 14d. Fortgeschrittene können die Hand bis zum Fuß geführt werden. Taube dann alleine halten.
18. Pfau (mayuräsana)
18. Mit den Unterschenkeln das Becken fixieren. Mit den Händen unter den Oberschenkeln die Beine anheben.
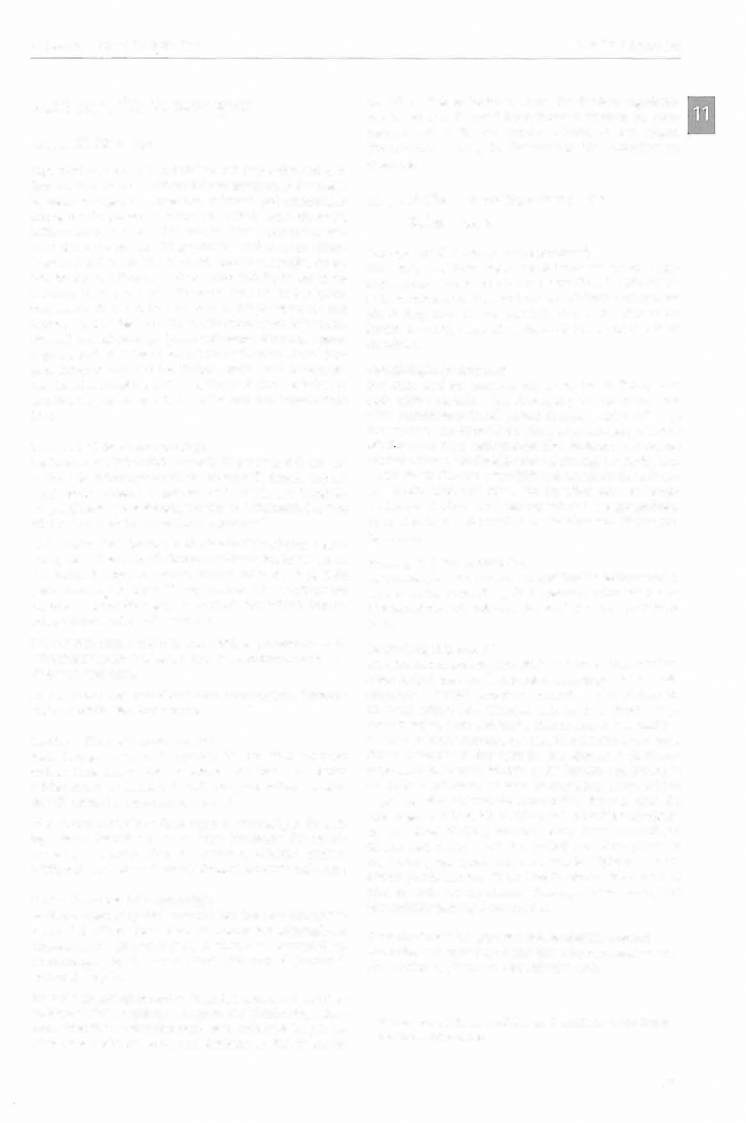
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
-
-
Yoga für Schwangere
-
Einführung
Yoga führt zu Harmonie und Einheit mit dem Selbst und dem Kosmos. Gerade in der Zeit der Schwangerschaft, in der massi ve Veränderungen im physischen, geistigen und emotionalen Körper vor sich gehen, ist es von großer Bedeutung, die innere Mitte zu finden und zu halten, sich an seinen Ursprung zu erin nern, sich zu erden und sich gleichzeitig nach oben zu öffnen. Werdende Mütter sind in dieser Zeit besonders sensibel für die Wiederkehr und Einheit von Geburt und Tod. Sie brauchen be sonderen Schutz, um Liebe für sich selbst und für das heran wachsende Kind entfalten zu können. Schwangerschaft und Muttersein sind das beste Umfeld für karma-yoga (selbstloses Dienen) und bhakti-yaga (immerwährende Hingabe). Hatha yoga bereitet die Schwangere mit Körperübungen, Atemübun gen, Entspannung und Meditation sowie einer bewussten, vegetarischen Ernährung ideal auf ihre zukünftige Aufgabe vor und führt zu Harmonie mit sich selbst und dem ungeborenen Kind.
Erstes Drittel der Schwangerschaft
Veränderungen (körperlich, mental): Körper stellt sich auf den Zustand der Schwangerschaft ein. Hormonelle Umstellung be dingt starke physische, geistige und emotionale Verände rungen (Übelkeit, Gereiztheit, Traurigkeit, Müdigkeit). Die Frau wird auf den verschiedenen Ebenen „weicher".
In den ersten drei Monaten ist die Gefahr eines Abortes beson ders groß. Daher sollte die Schwangere keine Stellungen üben, bei denen Sturzgefahr besteht. Ebenso sollte der Pfau nicht geübt werden und keine Übung, die besonders anstrengend
_ist. Insbesondere Übungen, die stark die Muskelkraft fordern, sollten etwas sanfter geübt werden.
Worauf man achten muss: Keinen kräftigen prä,:,äyäma mehr. Luftanhaltephasen weglassen (die Sauerstoffversorgung des Kindes ist gefährdet).
Zu empfehlen: Anuloma-viloma ohne Atemanhalten, bhrämarT
und die vollständige Yogaatmung.
Zweites Drittel der Schwangerschaft
Veränderungen (körperlich, mental): Die Frau fühlt sich meist wohler. Erste äußere Zeichen werden sichtbar - der Bauch wächst. Zwischen ca. 16. und 24. Schwangerschaftswoche wer den die ersten Kindsbewegungen gespürt.
Worauf man zusätzlich achten muss: Entspannung in der Seit lage, keine Bauchlagen mehr. Keine Kräftigung der Bauch muskeln, besonders nicht der geraden. Wichtig: Rücken kräftigende und beckenöffnende äsanas! Betonung auf Atem!
Letztes Drittel der Schwangerschaft
Veränderungen (körperlich, mental): Das Ende der Schwanger schaft rückt näher. Oberer Rand des Uterus liegt unterhalb des Rippenbogens. (Kurzatmigkeit, Sodbrennen, Krampfadern, Schwellungen der Beine und Hände (Ödeme), Karpaltunnel syndrom). Ängste.
Worauf man zusätzlich achten muss: Alle äsanas müssen völli ge Bauchfreiheit gewähren. langsam und gleichmäßig sürya namaskära üben. Bei Sodbrennen keine Umkehrstellung. Keine Rückenlage mehr, da Aorta und Hohlvene an der Innenseite
Yoga für Schwangere
der Wirbelsäule verlaufen u. durch das Gewicht abgedrückt werden können. Keinerlei Bauchübungen. Vorsicht bei Über beweglichkeit - die Frau kommt plötzlich in den Spagat. (Symphosenlockerung im Beckenring). Viel Zwischenent spannung.
-
Aufbau einer Yogastunde für Schwangere
-
-
Anfangs- und Tiefenentspannung(saväsana)
Die Anfangs- und Endentspannung wird in der Seitlage mit Unter stützung durch Kissen oder Decken ausgeführt. Die Rückenlage sollte vermieden werden, auch wenn die Teilnehmerinnen erst am Anfang ihrer Schwangerschaft stehen. So können sie bereits die richtige Lage für spätere Zeit lernen und sich daran gewöhnen.
Atemübungen(prä,:,äyäma)
Der Atem wird nur kurz und angenehm (bei Geübten) oder auch nicht angehalten (bei Anfängern) und es werden vor allem harmonisierende, ruhige Atemübungen geübt: vollständige Yogaatmung, anuloma-viloma ohne Atemanhalten, einfache ujjäyTAtmung ohne u<;J<)Tyäna-bandha, bhrämarT und Atmen mit tiefen Tönen. Kapä/a-bhätT(Schnellatmung) nur sanft, wenn es sich für die Übende gut anfühlt und diese bereits seit länge rem kapä/a-bhätT praktiziert. Für Ungeübte oder im fortge schrittenen Stadium der Schwangerschaft keine kapä/a-bhätT, da die rhythmische Kontraktion des Bauches evtl. Wehen aus lösen kann.
Sonnengruß(sürya-namaskära)
Der Sonnengruß kann langsam und gleichmäßig geübt werden in einer speziellen Abwandlung für Schwangere. Achte hier beson ders darauf, dass die Teilnehmerinnen nicht aus der Puste kom men.
Yogastellungen (äsanas)
Die einzelnen äsanas werden nicht ausdauernd lang gehalten. Achte darauf, dass die Übungsreihe ausgewogen ist und kein ständiger Wechsel zwischen sitzenden und stehenden Übungen erfolgt. Alle Übungen müssen dem Bauch völlige Freiheit geben. Fortgeschrittene äsanas können von Geübten so lange praktiziert werden, wie sie sich dabei sicher und wohl fühlen. Achte darauf, dass nicht zu viele Übungen in die Stunde aufgenommen werden. Wichtig ist die korrekte Ausführung in Verbindung mit einem ruhigen gleichmäßigen Atem. Erhalte insgesamt eine entspannte Atmosphäre. Betone, dass die Schwangere auf ihren Körper hören soll und ruhig auch vorzei tig aus einer Stellung kommen kann. Lasse ausreichend Zwischenentspannung mit Gelegenheit zum Nachspü-ren in die Wirkung des äsana und zum Zum-Kind-Spüren. Je nach Schwangerschaftsfortschritt und bei Problemen (Warnzeichen) müssen evtl. entsprechende Stellungen ausgelassen und Alternativübungen angeboten werden.
Konzentrationshilfen, Entspannung, Meditation (dhyäna)
Hier sollte auch immer der Bezug zum Baby hergestellt werden (Affirmationen, Hinatmen, Visualisierung etc.).
Merke: Genügend Kissen bereitlegen zur Unterstützung in den äsanas
und für die Entspannung.
219

H atha-yoga-U nterrichtstech n i ken Yoga für Schwangere
11.11.3 Yoga für Schwangere (Mittelstufe auf Basis der YoGA V1ovA-Grundreihe) - Übersicht
ifh::..�,
Rücken- oder Seitlage, 5-10 Min.
1. Anfangsentspannung ( saväsana)
(ORfü!)c. kMenalnatgrea.nur am Anfang der Schwangerschaft)
,, �,,J,;!';;;:;:,�:ro, , �
2(a: nWuefocmhsae-vlaiftommuan-gprär:iäyäma bzw. nädi-fodhana)
Oder 3:6, 5:10.
A10TE-M20RHRYuTHnMdeuns:o4hnSeekA. nehinal:te8pSheaks.ea.us.
(-
10-20 Mal ausatmen.
3bz. wBi. eAntemnetonnm-AiteTmön(ebnhrämari) ABitemneennsmumit mTöennen(m(am-om-um-m) ).
4in. SEenittslapgaennoudnegr (Mo.eAdibtabt.i)on, 1-3 Min.
lff,J
..-'tf
·
-
l1a2ngRsuanmdeesnTgelmeicphom. Säeßiimges, i'(l
�J
i
-
"-
�-.
VoRrwücäkrwtsäbretusbgeungaeunsaetimnaetnm.eSneim
S6e. iZtwlaigsecheondeenrtsSptaenllnuunngg des
sKainndae) smi(tggaeröbfhfnäestaenna,Knbieänlä.
J7e. Hnuanchd (Sacdhhwoa-mnguekrhsac-hsavfiitsnmäsoannaat) die Füße gzuesbaemn,m1enMiond. elranghühftabltreenit. Aanusscehinlieaßnednedr ZKwinidsechs e(nsienhtespAabnbn. u6n)g. in der Stellung des
-
..:.•...:..I. '(
-
-
und/oder auseinander gegeben werden.
sitz). 1-2 Min.
8H.aSlbcehrultSecrhsutaltnedrs(tsaanrdvämilgitiisKainssae) n unter dem Becken, Beine einzeln AheLTbEeRnNA, TFIüVß: AenzudsearmWmaennd gmeibt eKnis, s3e0n-.6D0ieSeFkü.ßheakltöennn. en dabei zusammen
A9.LTFEiRscNhAT(IVm: aItmsyäFesarsnean) sitz oder Stehen Hände hinter dem Rücken falten oder agbehstoübtezenn, .GBelsicäkß zleuirchDteacnkege, sBpraunsnt tö. fZfenheenn, SinchdueltnerBbolädtetenr dzruüscakmenm(eimn, FBeercskeenn
als Zwischenentspannung dienen.
1Rü0.ckKeronklaogdeil,-DBereinheübauufngges(mteallkt,abräesidaenaK)nie nach rechts zum Boden brin Jgeewn,eiKlsop3f0n-6a0chSelink.ksDdierseeheÜnb,udnagnakacnhnKninieleniacchhtelrinAkus,sfKüohprfunnagcjhedreecrhzetsit.
1b1re.itBgeecökeffnnhete,bBeenckaeunsmdietrEiRnüactmkeunnlagghee. bHeänn,dme iftlaAcuhsatumf duenmg sBeondken,, B1e0inMeahl.üft
220
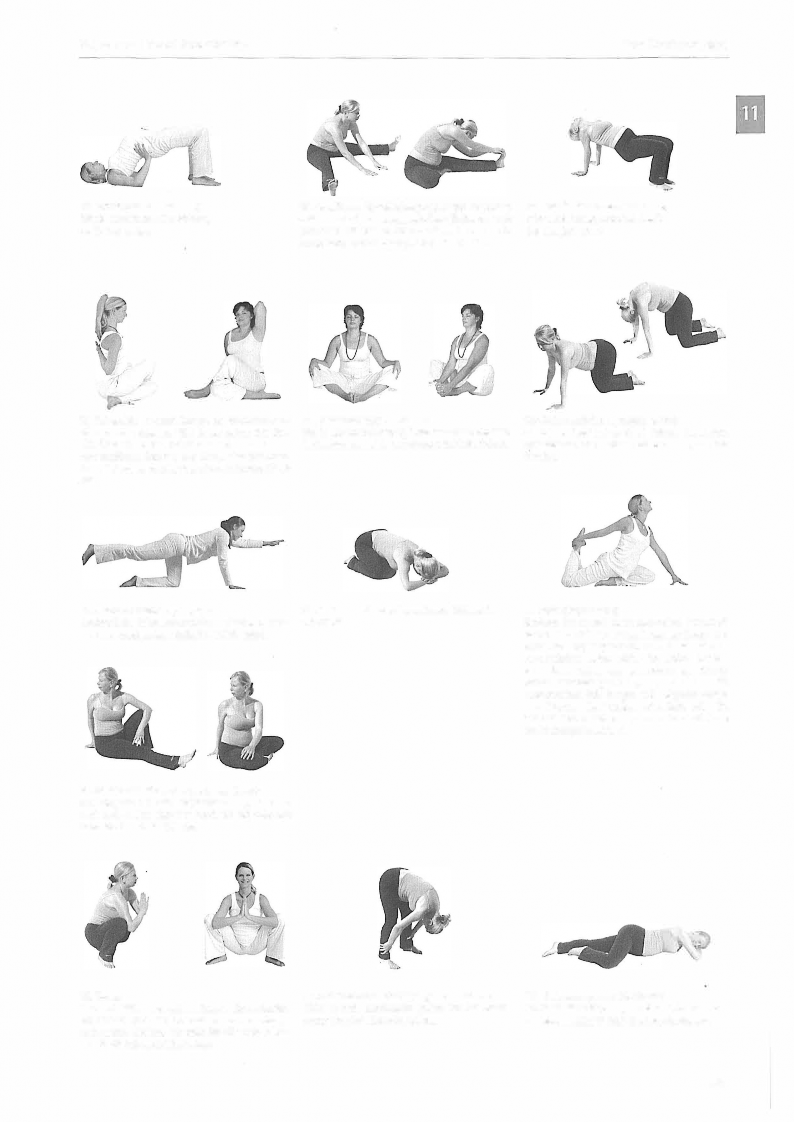
Hatha-yoga-U nterrichtstechn i ken Yoga für Schwangere
-
Brücke (setu-bandhäsana) Hände unterstützen den Rücken, ca. 30 Sek. halten.
15. Kuhgesicht (go-mukhäsana) Aus Fersensitz Beine übereinanderschlagen. Füße liegen neben den Ges äßhälften am Boden. Hände auf Wirbelsäule fassen oder annähern. Rechtes Bein oben, linker Arm oben. Linkes Bein oben, rechter Arm oben. Jede Seite 30-60 Sek.
17.2 Katzenvariation 2 (märjäry-äsana)
Rechtes Bein, linken Arm strecken. Linkes Bein, rech ten Arm strecken. Jede Seite 20-45 Sek. halten.
-
Halber Drehsitz (ardha-matsyendräsana)
aus Langsitz: Ein Bein angewinkelt aufgestellt (so weit nach außen, dass der Bauch frei ist) oder aus Lotossitz. Jede Seite 1-2 Min.
-
Hocke
Knie und Füße nach außen richten. Oberschenkel innenseiten mit den Oberarmen bzw. Ellenbogen nach außen drücken, mit müla-bandha oder asvini mudrä. 45 Sek. bis 2 Min. halten.
-
-
Gegrätschte Vorwärtsbeuge (upa-vista-kof}äsana) ALTERNATIV: Ein Bein angewinkelt Uänu-sirsäsana), nach vorn zur Mitte beugen (über das lange Bein ab ca. 5. Monat nicht mehr möglich). Jede Seite 1-2 Min.
16. Schmetterling (bhadräsana)
Tief in das Becken atmen, beim Ausatmen bewusst Beckenbodenmuskeln entspannen, 2-3 Min. halten.
18. Stellung des Kindes (garbhäsana, bäläsana)
30-60 Sek.
22. Stehende Vorwärtsbeuge (päda-hastäsana) Füße so weit auseinander geben, bis der Bauch genug Platz hat. 1-2 Min. halten.
14. Schiefe Ebene (pürvottänäsana) oder Tisch (catu5-päda-pithäsana) 1-2 Mal, je 5-10 Sek.
17.1 Katzenvariation 1 (märjäry-äsana)
Einatmen, Kopf heben, Brust öffnen. Ausatmen, Katzenbuckel. Das Becken führt die Bewegung. 5-8 R�nden.
19. Taube (kapotäsana)
Vorderes Knie so weit nach außen geben, dass Bauch frei ist. Beide Hände auf dem Boden abstützen, hin teres Bein lang ausgestreckt. Wenn Gesäßseite des angewinkelten Beines nicht den Boden berührt, dann Kissen unterlegen. Kopf heben, aus oberem Rücken zurückbeugen. Bei genügender Flexibilität ausgestrecktes Bein beugen und Fußgelenk umfas sen, Richtung Kopf ziehen. Jede Seite 1-2 Min. Anschließend Zwischenentspannung in der Stellung des Kindes (siehe Abb. 6).
-
Tiefenentspannung (saväsana)
-
Meditation (dhyäna), om (3 Mal), Abschluss
mantra, Of(I sänti (3 Mal) Gruß an die Meister.
221
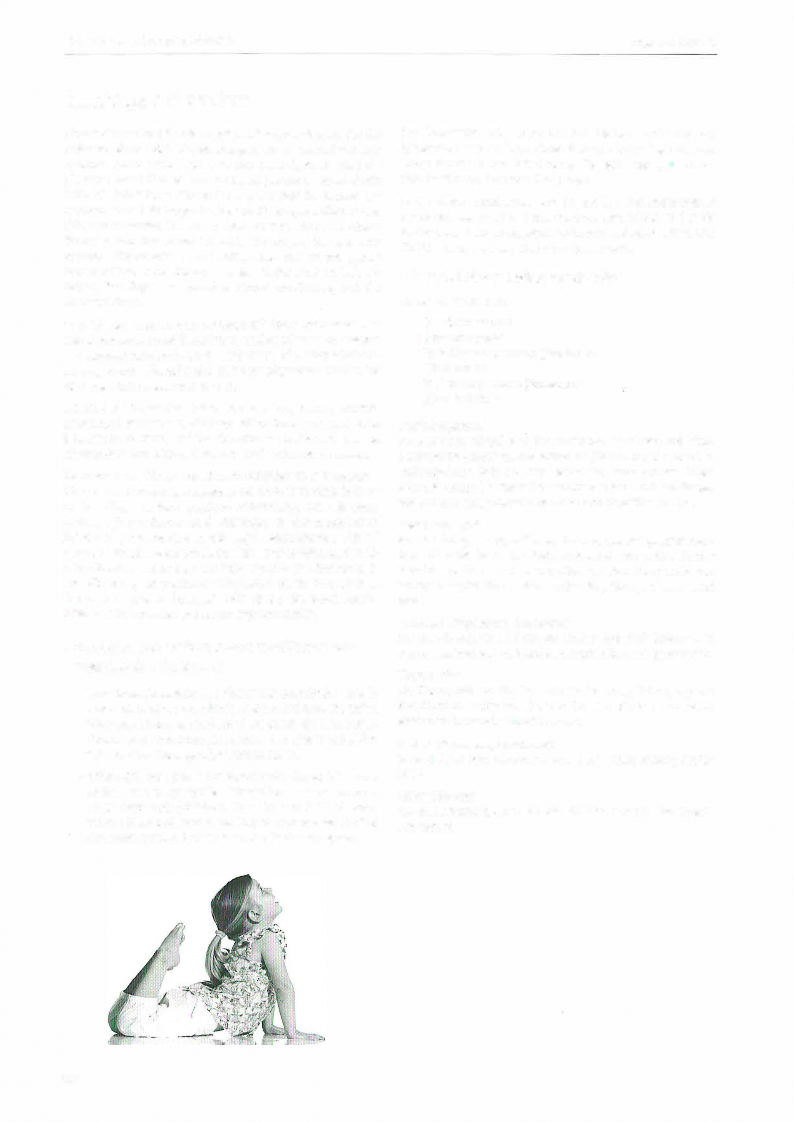
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
11.12 Yoga mit Kindern
Kinder können so früh wie möglich mit yoga anfangen. Für die Kleinsten eignen sich Körperübungen, die in Geschichten ein gebettet werden und Spiele. Zu berücksichtigen ist, dass die Kleinsten recht flexibel sind, es ihnen jedoch an Muskelkraft fehlt. Die Schulkinder können tiefer in die Welt der asanas ein tauchen, wobei ein langes Halten der Stellungen aufgrund des sich entwickelnden Hormonsystems zu vermeiden ist. Atem übungen sind besonders hilfreich. Sie sorgen für eine ent spannte Körperhaltung und dafür, dass der Körper genug Sauerstoff bekommt. Allerdings sollen Kinder nicht die Luft an halten. Das Singen von mantras fördert die Atmung und die Ausdruckskraft.
Was ist der Nutzen von Kinderyoga? Yoga verbessert das Selbstbewusstsein; ist beruhigend und ausgleichend; steigert die Konzentrationsfähigkeit; verbessert die Körperbeherr schung; weckt Lebensfreude; hilft dem physischen Körper, ins Gleichgewicht zu kommen u. v. m.
Ziel ist, den Kindern den Unterschied von Anspannung und Ent spannung beizubringen, die Gegensätze Bewegung und Ruhe bewusst zu machen, soziales Verhalten zu kultivieren und sie die Ganzheit von Körper, Geist und Seele erfahren zu lassen.
Selbsterfahrung findet bei Kindern zunächst über Bewegung, Körper- und Sinneserfahrung statt. Die motorische Entwicklung ist Grundlage für jede kognitive Entwicklung. Das gilt umso mehr, je jünger Kinder sind. Störungen in der motorischen Entwicklung verursachen in der Regel weitreichende Mängel und/oder Probleme im intellektuellen, emotionalen und seeli schen Bereich. Daher liegt der Schwerpunkt im Kinderyoga in der Förderung körperlicher Fähigkeiten durch Sonnengruß, asanas und andere. Übungen oder Spiele, die durch Atem-, Stille- und Entspannungsübungen ergänzt werden.
-
Verschiedene Weisen des Durchführens von Yogastunden für Kinder
-
Traditionell/klassisch: Der Ablauf der Grundreihe wird in etwa beibehalten, aber kindgerecht vermittelt. Die tiefen Wirkungen kommen insbesondere durch die klassischen asanas und Atemübungen, sodass die Kinder möglichst früh an diese herangeführt werden sollen.
-
Offen: Offener Ablauf der Yogastunde, Yogaspiele, auch andere Bewegungsspiele, Integration anderer motori scher Fördermöglichkeiten. Der Unterricht ist kindzen triert: Ablauf und Inhalte der Yogastunde werden flexibel den momentanen Bedürfnissen der Kinder angepasst.
Yoga mit Kindern
Der Unterricht sollte yogaorientiert bleiben und nicht zur Spielstunde werden. Yoga bietet Kindern einzigartige Hilfe und Unterstützung in der Entwicklung. Die Wirkungen, also auch tiefe Berührung, kommen durch yoga.
In der Praxis vermischen sich die beiden Unterrichtsweisen normalerweise zu einer harmonischen Verbindung, in der die Kinder ihrer Entwicklungsstufe entsprechend yoga lernen und die Erfahrung machen, dass yoga Spaß macht.
-
-
Beispiel einer Kinderyogastunde
Dauer ca. 45-60 Min.
-
Begrüßungsritual
-
Bewegungsspiel
-
Zwischenentspannung (savasana)
-
Übungsreihe
-
Tiefenentspannung (savasana)
-
Abschiedsritual
Begrüßungsritual
Als Begrüßungsritual kann das Anzünden einer Kerze mit einer bestimmten Intention, das namas-te (Hände vor der Brust in Gebetshaltung bringen und verneigen), eine andere Geste oder eine kurze Übungsreihe genutzt werden. Auch das Singen von OfT/ und eines mantras gehören zum Begrüßungsritual.
Bewegungsspiel
Vor der Entspannung sollte ein Bewegungsspiel gespielt wer den. Eventuell kann das Bewegungsspiel sehr aktive Kinder anheizen, sodass sie noch unruhiger werden. Dann sollte das Bewegungsspiel durch eine ruhige Begrüßungsreihe ersetzt werden.
Zwischenentspannung (savasana)
Vor der Übungsreihe sollten die Kinder körperlich loslassen, in dem sie in savasana (d. h. auf dem Rücken liegend) entspannen.
Übungsreihe
Die Übungsreihe sollte Elemente der Dehnung, Kräftigung und Koordination enthalten. Auch sollte den Kindern der Atem spielerisch bewusst gemacht werden.
Tiefenentspannung (savasana)
Je nach Alter wird eine kurze oder lange Entspannung einge leitet.
Abschiedsritual
Für das Abschiedsritual gilt das Gleiche wie für das Begrü ßungsritual.
222
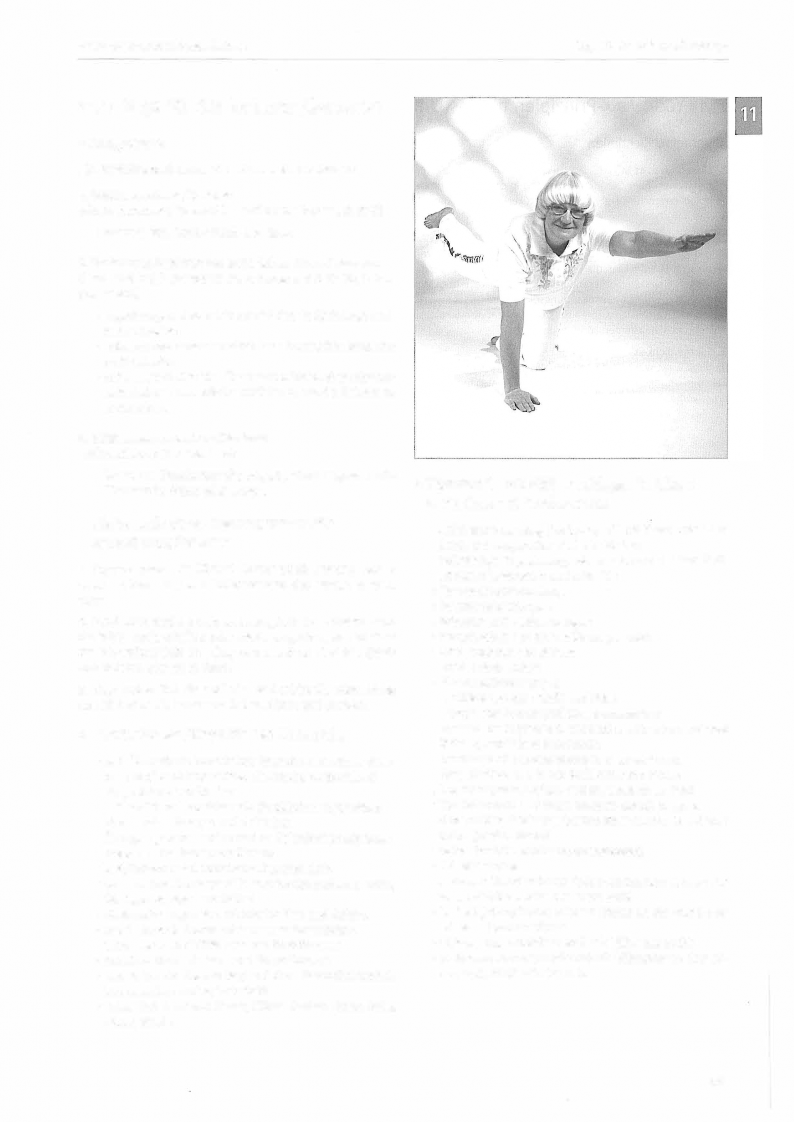
Ha1;ha-yoga-Unterrichtstechniken
11.13 Yoga für Seniorinnen/Senioren
-
Zielgruppen
Als Yogalehrende/r kannst du unterscheiden zwischen:
-
fitten Seniorinnen/Senioren
(ältere Menschen, die sportlich und normal beweglich sind)
-
normale YoGA VIDYA-Grundreihe üben
-
-
Seniorinnen/Senioren mit körperlichen Einschränkungen (Herz- und Kreislauf-Problemen, Arthrose und Arthritis, Osteo porose etc.)
-
Yogaübungen abwandeln gemäß den Bedürfnissen und Möglichkeiten
-
Osteoporose: Alles vermeiden, was Sturzgefahr birgt. Nur sanft belasten.
-
Arthrose/Arthritis: Viel Üben ganz wichtig, aber schmerz haft. Daher immer wieder motivieren, um die Gelenke zu mobilisieren.
-
-
behinderten Seniorinnen/Senioren
(Rollstuhlfahrer, Amputierte etc.)
-
Meist nur Einzelunterricht möglich. Stark abgewandelte Übungen im Sitzen oder liegen.
-
-
-
Die Vorteile eines Yogaprogramms für Seniorinnen/Senioren
l. Yoga verbessert die Körperhaltung und die Atmung, was zu einer Verbesserung des Funktionierens des ganzen Körpers führt.
-
Durch yoga wird die normale Beweglichkeit der Gelenke und der Wirbelsäule erhalten oder wiederhergestellt, was zu einer Funktionstüchtigkeit im Alltag und somit zu Unabhängigkeit von anderen Menschen führt.
-
Yoga unterstützt die seelische und spirituelle Entwicklung und fördert so ein bewusstes Leben, Altern und Sterben.
-
-
Empfehlungen/Tipps für den Unterricht
-
evtl. Überschuhe bereithalten (manche Seniorinnen/Sen- ioren sind es nicht gewöhnt, die Schuhe auszuziehen)
-
einige Stühle bereithalten
-
evtl. weichere Unterlagen als die üblichen Yogamatten
-
Helfen beim Hinlegen und Aufstehen
-
Übungen generell sanfter und an Belastbarkeit anpassen
-
Freude an der Bewegung fördern
-
prär:iäyäma: meist reduziertes Atemanhalten
-
vereinfachter Sonnengruß (s. Yoga für den Rücken, S. 183ff.}
-
Übungen weniger lang halten
-
Umkehrstellungen sind wichtig für Herz und Gefäße.
-
Brust öffnende äsanas wirken gegen Rundrücken.
-
Wirbelsäulenflexibilität erhalten: Drehübungen
-
Schulter-, Hals-, Nacken- und Fingerübungen
-
Der Fokus der äsanas liegt auf dem Gesundheitserhalt und nicht im Trainingsfortschritt.
-
Hilfsmittel einsetzen: Kissen, Klötze, Decken, Gurte, Seile, Wand, Stühle
-
Yoga für Seniorinnen/Senioren
-
-
-
Yogastunde mit Hilfsvorschlägen für ältere Menschen mit Beschwerden
-
Anfangsentspannung (saväsana) evtl. mit Kissen unter den Knien und aufgerollter Decke im Nacken
-
vollständige Yogaatmung, Wechselatmung auf dem Stuhl
-
Rückenrolle vorwärts und seitwärts
-
Knie-Brust-Stirn-Stellung
-
Bauchmuskelübungen
-
Schulter- und Nackenübungen
-
Rumpfdrehung im Stehen (Arme pendeln)
-
Wadendehnung im Stehen
-
auf der Stelle gehen
-
Gleichgewichtsübungen
-
Mobilisierung der Hände und Füße
-
angepasster Sonnengruß (sürya-namaskära)
-
angepasster Kopfstand (sTr?äsana) z. B. Schultern auf zwei Stühlen, Kopf hängt dazwischen
-
Schulterstand (sarvängäsana) z. B. an der Wand
-
Pflug (ha!äsana) z. B. mit Stuhl unter den Füßen
-
Bauchentspannungslage (mit angewinkeltem Knie)
-
Vierfüßlerstand und Katze (märjary-äsana), diagonal
-
sitzende Vorwärtsbeuge (pascimottänäsana) z. B. mit Gurt
-
Kobra (bhujangasana)
-
halber Drehsitz (ardha-matsyendrasana)
-
Seitwärtsbeuge
-
stehende Vorwärtsbeuge (pada-hastäsana): evtl. an der Wand abstützen oder auf einem Stuhl
-
Dreieck (tri-kor:iäsano) mit dem Rücken an der Wand oder mit einer Hand abstützen
-
hinlegen und aufstehen: evtl. mit Hilfe eines Stuhls
-
Tiefenentspannung (savasana) mit Affirmationen über Ge sundheit, Wohlbefinden u. Ä.
223
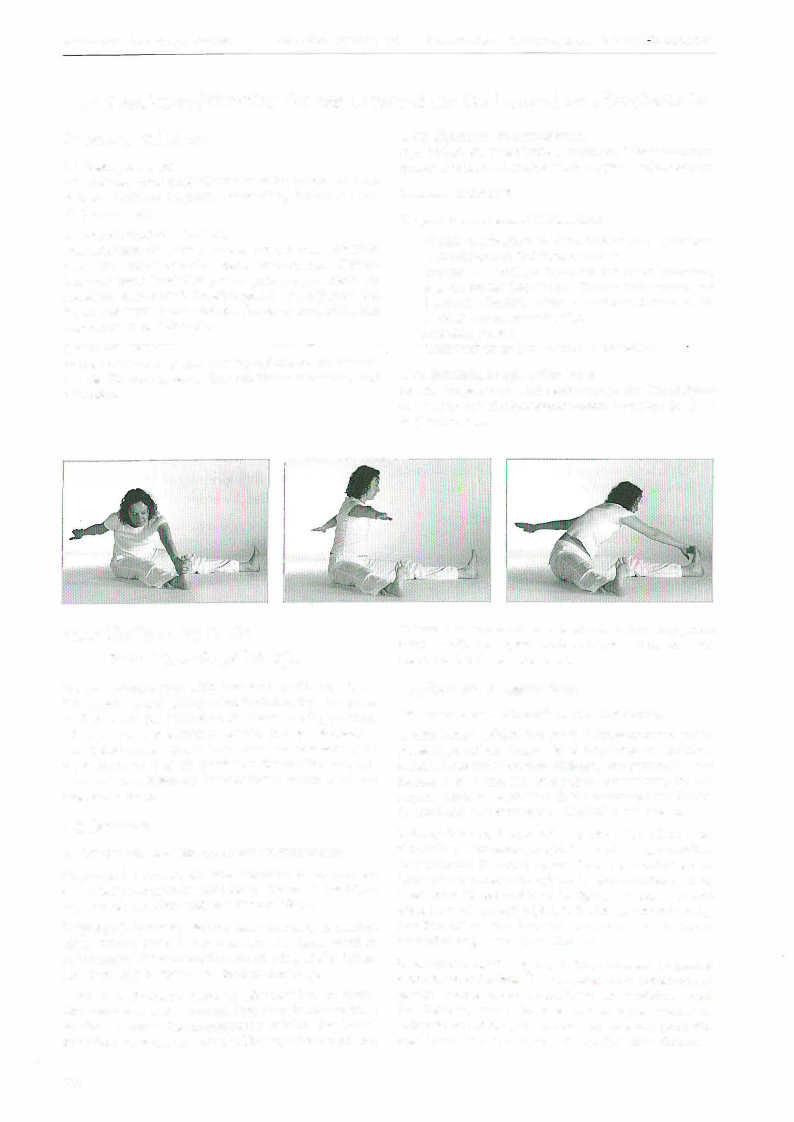
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken YOGA V1ovA-Prinzipien bei bes. Beschwerden • Einführung in die YOGA V1ovA Yogatherapie
11.14 YoGA V1ovA-Prinzipien für das Unterrichten bei besonderen Beschwerden
Allgemeine Richtlinien
-
Wissen, ,,was es ist"
Informationen über Gesundheitszustand in der ersten Stunde einholen (ärztliche Diagnose, Heilpraktiker, Physiotherapeut, Bücher, Internet).
-
Non nocere (,,nicht schaden")
Man unterlässt alles, was potenziell schadet oder Schmerzen verursacht. Hierbei kann die Diagnose eines Arztes, Heilprakti kers oder eines Physiotherapeuten gute Dienste leisten. Im Zweifelsfall dem Arzt ein Yogaübungsblatt zeigen (lassen) und fragen, was vermieden werden soll. Asanas so abwandeln, dass Teilnehmer sie ausführen können.
3:-Ganzheitlichkeit
Im yoga wirkt weniger eine einzelne Stellung, als die Gesamt heit der Übungen in Verbindung mit Tiefenentspannung und pra0äyäma.
-
Das allgemeine Anpassungsprinzip
Yoga fördert die Regeneration. Genügend Zwischenentspan nungen einbauen. Übungen sinnvoll anpassen und abwandeln.
-
Schüler entscheidet
-
Eigene Grenzen kennen und beachten
, Grenzen des Yogalehrers: Wenn nötig an Arzt, Physiothera peut oder andere Fachleute verweisen.
-
Grenzen des Schülers: immer wieder darauf hinweisen, dass die Schüler ihre eigenen Grenzen wahrnehmen und beachten, allmählich achtsam erweitern. Achtsamer, lie bevoller Umgang mit sich selbst.
, Juristische Fragen.
-
Leiden haneinen Sinn - nicht alles ist heilbar.
-
-
Die kosmische Energie wirken lassen
Bei aller Fachkenntnis: Mache dich während des Unterrichtens zum Instrument. Guru-paramparä-stotra (Anrufung der Mei ster). Positiv sein.
.----------
11.1s Einführung in die
YoGA V1ovA-Yogatherapie
Der ganzheitliche yoga wirkt insgesamt positiv auf körper liches, geistiges und seelisches Wohlbefinden. Yogatherapie ist darüber hinaus die Anwendung der klassischen Yogapraktiken mit dem Ziel, auf bestimmte Krankheitsbilder einzuwirken bzw. Disharmonien auszugleichen. Hauptcharakteristikum der Yogatherapie ist, dass die klassischen Standardübungen ent sprechend dem jeweiligen Beschwerdebild abgewandelt und angepasst werden.
-
-
Zielgruppen
Es gibt vorrangig zwei Zielgruppen von Praktizierenden:
Zielgruppe 1: Personen, die einer normalen Yogastunde aus gesundheitlichen Gründen nicht folgen können. Sie benötigen Yogatherapie, um überhaupt yoga üben zu können.
Zielgruppe II: Personen, die zwar einer normalen Yogastunde folgen können, deren Beschwerden sich aber leider trotzdem nicht bessern. Hier kann Yogatherapie oft mit speziellen Anpas sungen zu einer Besserung der Situation verhelfen.
Ist das zu bearbeitende Thema aufgelöst oder hat sich zumin dest ausreichend weit entwickelt, dann ist meist der Anschluss an eine „normale" Yogaübungsgruppe möglich. Die Betrof fenen üben entweder ein normales Übungsprogramm mit den
224
anderen Teilnehmern mit oder sie wissen, welche Übungen sie durch spezifische, eigene ersetzen können, ohne dass der Ablauf der Stunde darunter leidet.
-
Aufbau einer Yogatherapie
Der Aufbau einer Yogatherapie umfasst drei Schritte:
-
Entspannung auf allen Ebenen: Tiefe Entspannung wirkt har monisierend auf das gesamte Körper-Geist-System, blockierte Selbstheilungskräfte werden aktiviert, Verspannungen und Blockaden lösen sich. Dies ist die erste Voraussetzung für Hei lung. Je nachdem, welcher Art die Verspannungen und Blocka den sind, kommen verschiedene Methoden zum Einsatz.
-
Energetisierung des gesamten Systems: Das Anheben der allgemeinen Lebensenergie gleicht Defizite aus, ermöglicht weitergehende Heilungsprozesse, die vorher blockiert waren. Damit die zunehmende Energie frei im gesamten System zirku lieren kann, ist systematische Reinigung mit äsanas, prä0ä yäma, Meditation (dhyöna), kriyäs, Ernährung usw. notwendig. Dies führt oft zu einer Änderung des Lebensstils: vom konsu mierenden weg, zum aktiven Leben hin.
-
Spezifische Aktivierung von Heilungsprozessen im geschä digten Bereich: Spezielle Übungen leiten die vorbereitend auf gebaute Energie an bestimmte Stellen und verstärken gezielt den Heilungsprozess. Dabei kommt es immer wieder zu erstaunlichen Erfolgen, die ihre Basis im integralen, ganzheitli chen Ansatz haben: der Arbeit mit allen fünf Hüllen (ko.fos).
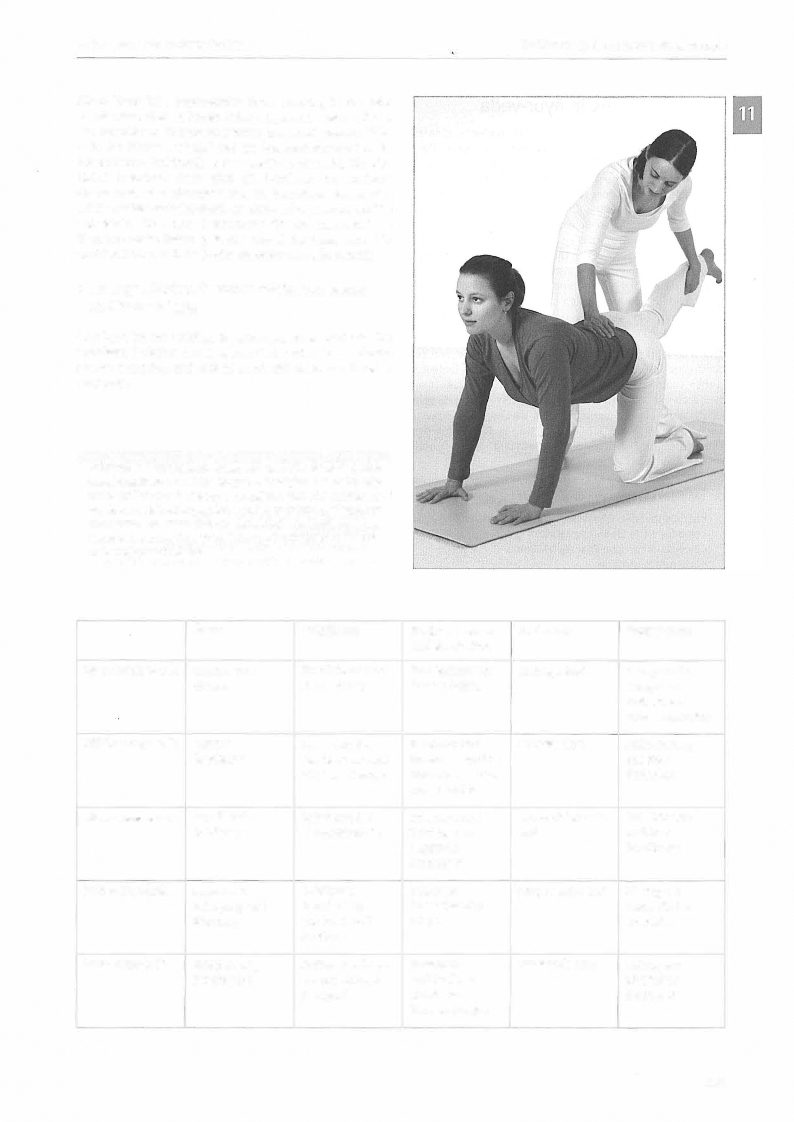
Hatha-yoga-Unterrichtstechniken
Wenn körperliche Beschwerden ihren Ursprung in den fein stofflicheren Ebenen haben (oder umgekehrt), dann müssen alle betroffenen Ebenen zusammen behandelt werden. Wird
z. B. der Körper „geheilt" und die krankheitsverursachende, feinstoffliche (spirituelle oder geistig-emotionale) Struktur bleibt bestehen, dann wird die Krankheit bei nächster Gelegenheit wiederkommen und die betroffene Person wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein chronisches Beschwerdebild entwickeln. Eine gute Orientierung für die therapeutische Vorgehensweise liefern z. B. das Modell der kosas (drei Kör per/fünf Hüllen, s. S. 21f.) oder die cakra-Lehre (s. S. 92ff.).
-
Therapeutisches Zusammenspiel von kosas und Yogapraktiken
-
Was kann ich mit welchen Yogaübungen erreichen? Aus den jeweiligen Praktiken der einzelnen Felder wird der Yogathera pieplan entwickelt und laufend an die sich ändernde Situation angepasst.
Achtung! In Deutschland, Österreich und der Schweiz gelten unterschiedliche rechtliche Vorgaben bezüglich des Gebrauchs von Begriffen wie Therapeut, Therapie und Heilkunde sowie zur Angabe von Heilwirkungen des yogo. Die rechtliche Auslegung ist momentan im Fluss (Stand: 1.4.2017}. Auskunft gibt der Berufsverband der Yoga Vidya Lehrer/Lehrerinnen e. V. (berufs verband@yoga-vidya.de).
Äsana Prä,:iäyäma
Änanda-maya-kosa Erleben von Entwicklung von
Wonne Ausstrahlung
Vijfiäna-maya-kosa geistige Reinigung der
Reinigung geistigen und spi- rituellen Energie
M ano-maya-kosa emotionale Reinigung der
Reinigung Herzensenergie
Prä,:ia-maya-kosa allgemeine Reinigung,
Reinigung und Entwicklung
Stärkung von Kraft und Ausdauer
Anna-maya-kosa Entspannung, Aufbau von inne-
Beruhigung rer und äußerer Festigkeit
Einführung in die YOGA VIDYA-Yogatherapie
Positives Denken Ernährung Entspannung und Meditation
Entwicklung von sattwige Kost unbegrenzte innerer Stärke Energie und
Freiheit von Stressempfinden
Erkennen und sattwige Kost Stabilisierung Ersetzen negativer positiver
Gedankenmuster Gedanken durch positive
Erkennen und harmonisierende Stabilisierung Befreien von Kost positiver
negativen Emotionen
Emotionen
bewusste prär:ia-reiche Kost Lösung von Steuerung des energetischen
prär:ia Blockaden
Erkennen reinigende Kost Lösung von und Auflösen physischen
physischer Blockaden
Verspannungen
225
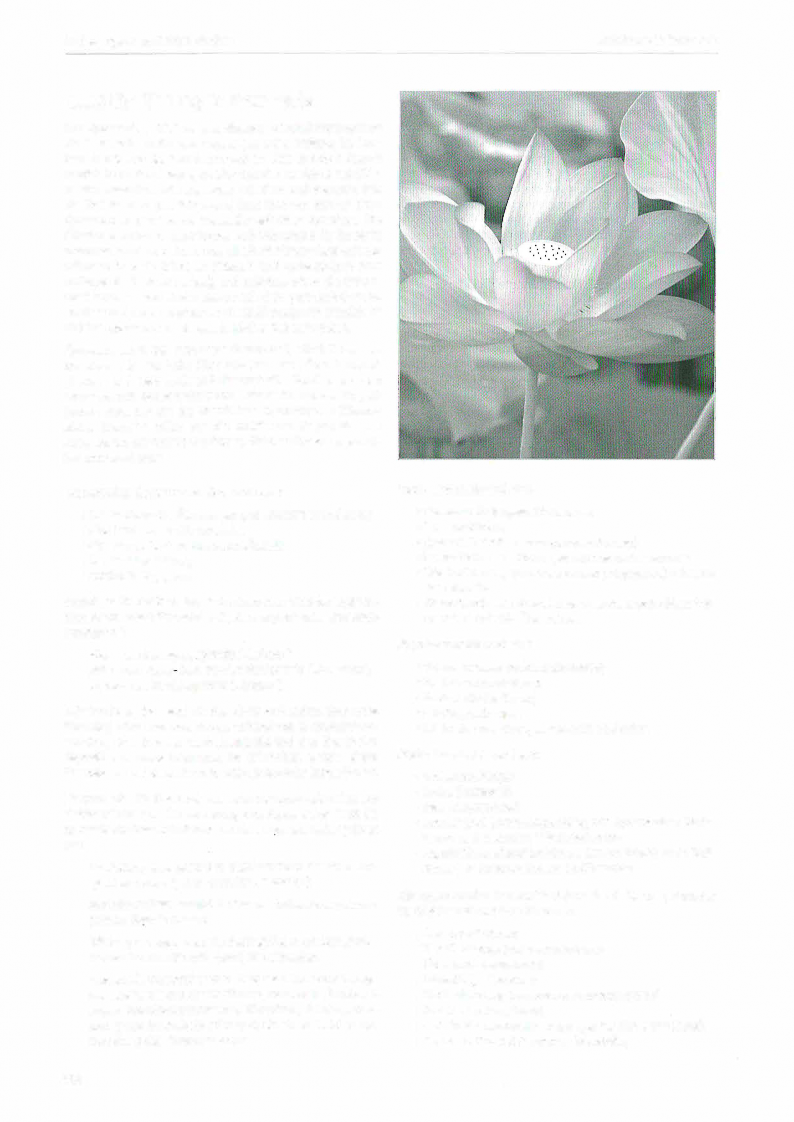
Ha1;ha-yoga-Unterrichtstechniken
-
-
Einführung in äyur-veda
Der öyur-veda gehört zu den ältesten Gesundheitssystemen der Welt. Wie im Fall des yoga liegen seine Anfänge im Dun keln. Funde aus der Induskultur zeigen, dass es schon damals medizinische Kenntnisse gab. Die vedische Medizin beschäftig te sich besonders mit magischen Praktiken und mantras. Seit der Zeit Buddhas (ca. 500 v. Chr.) kann man von den heutigen öyur-veda vergleichbaren Behandlungsformen sprechen. Die ältesten erhaltenen schriftlichen Aufzeichnungen (in Sanskrit) stammen aus dem 6. Jh. n. Chr. Die Überlieferung fand anfangs teilweise in buddhistischen Klöstern und Universitäten statt (solange sie Bestand hatten), und teilweise bis in die Gegen wart innerhalb von Arztfamilien nach dem guru-ku/a-System. Im Gegensatz zum westlichen Gesundheitssystem handelt es sich bei öyur-veda um ein ganzheitliches Lebenskonzept.
Äyur-veda lehrt, wie man seine Gesundheit, Vitalität und Le bensfreude bis ins hohe Alter erhalten kann. Äyus bedeutet
„Leben" und veda „Wissen/Wissenschaft". Somit kann man öyur-veda mit „Wissenschaft vom Leben" übersetzen. Es geht jedoch nicht nur um die Vermittlung theoretischen Wissens allein. Vielmehr sollen uns die praktischen Regeln für den Alltag helfen, die Einheit von Körper, Geist und Seele herzustel len und zu erhalten.
Die zentralen Elemente von äyur-veda sind:
, Manualtherapie, Ölmassagen und Kräuterbehandlungen
-
eine fundierte Ernährungslehre
-
eine kenntnisreiche Pflanzenheilkunde
-
Lebensstilgestaltung
-
-
spirituelle Yogapraxis
Grundlage für das Verständnis des äyur-veda sind die sogenan nten dO$OS, meist übersetzt mit „Bioenergien" oder „Konstitu tionstypen":
-
vöta - das Bewegungsprinzip (,,Lufttyp")
, pitta - das Feuer bzw. Stoffwechselprinzip (,,Feuertyp")
-
kapha - das Strukturprinzip {,,Erdtyp")
In jedem Menschen sind alle drei dO$OS vorhanden, aber meist überwiegt eine oder zwei davon. Anhand von Charaktereigen schaften, dem äußeren Erscheinungsbild und den Krankheits dispositionen eines Menschen ist erkennbar, welche dO$OS überwiegen und ob er eher ein vöta-, pitta- oder kapha-Typ ist.
Hauptursache für Krankheit sind nach der äyur-veda-Lehre Un gleichgewichte und Übersteuerung von dO$OS. Daher setzt die ayurvedische Gesundheitslehre an den dosas an. Dabei geht es um:
, Herstellung eines gesunden Gleichgewichts der dO$OS ent sprechend der eigenen Grundnatur (prakrti)
-
Vermeidung bzw. Ausgleich einer zu starken bzw. patholo gischen dosa-Dominanz
, Stärkung von agni, dem Verdauungsfeuer, um Krankheit verursachende Giftstoffe (äma) zu vermeiden
, individuelle Gesamttherapie: do$a-gerechte Ausrichtung des Lebensstils und der Ernährung, eventuelle Ölbehand lungen (Ganzkörpermassagen, Stirngüsse, Kräuterpulver bzw. Kräuterbeutelbehandlungen) bis hin zu individueller Gestaltung des Yogaprogramms
Einführung in äyur-veda
Väta-harmonisierend sind:
-
stehende Gleichgewichtsübungen
-
Pflug (haläsana)
, (halber) Drehsitz (ardha-matsyendräsana)
-
langes Halten der Stellungen mit bewusster Atmung
, Wechselatmung (anuloma viloma präl)äyäma) - beson ders effektiv!
-
-
Sürya-bheda und etwas kürzere sanfte kapöla-bhötT har monisiert bei vöta-Überschuss
Pitta-harmonisierend sind:
-
Vorwärtsbeuge (pascimottänäsana)
-
Fisch (matsyendräsana)
-
Dreieck (tri-konösana)
-
alle Augenübungen
-
kühlende Atemübungen wie si'ta/T und sTtkärT
Kapha-harmonisierend sind:
-
Umkehrstellungen
-
-
Krähe (käkäsana)
-
Pfau (mayürösana)
-
Sonnengruß (sürya-namaskära) mit dynamischen Varia tionen und mehreren Wiederholungen
-
Kapö/a-bhätT, dhauti (gehört zu den $Ot-kriyäs) und ujjäyt
Atmung reduzieren den kapha-Überschuss.
Alle do$OS werden harmonisiert (und damit die prakrti wieder ins Gleichgewicht gebracht) durch:
-
-
Pfau (mayürösana)
-
Vorwärtsbeuge (pascimottänäsana)
-
-
Fisch (matsyendräsana)
-
Lotossitz (padmösana)
-
Wechselatmung (anuloma-viloma-pröQöyöma)
-
-
Enddarmspülung (basti)
-
gezielte Bauchmuskelbewegungen für den Darm (nauli)
-
forciertes Ein- und Ausatmen (bhastrikä)
-
-
226
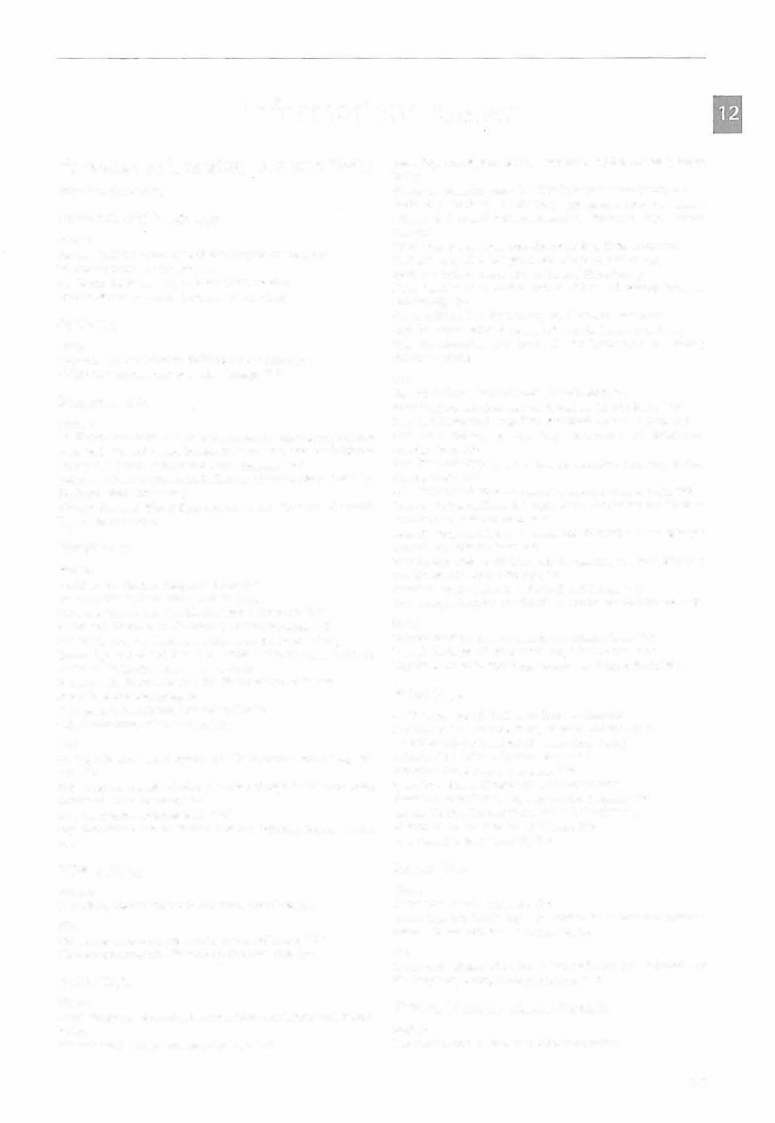
1 nformationsquellen
Hinweise zu Literatur, CDs und DVDs
(YVV - Yoga Vidya Verlag)
Anatomie und Physiologie
Bücher:
Bau und Funktionen des menschlichen Körpers, Speckmann/ Wittkowski, Urban & Fischer Verlag
Der Körper des Menschen, A. Faller, Thieme Verlag Orthopädie von A-Z, K.-D. Thomann, Thieme Verlag
Ayurveda
DVDs:
Ayurveda. Heilsam leben im Einklang mit der Natur, YVV Abhyanga. Techniken der Ayurveda-Massage, YVV
Bhagavad-Gita
Bücher:
Die Bhagavad-Gita für Menschen von heute. Erläuterung von Sukadev Bretz (mit Original Sanskritversen in Devanagari, wissenschaftlicher Umschrift, Worterklärungen und Übersetzungen), YVV
Indische Mythen und Symbole, H. Zimmer, Diederichs Gelbe Reihe Bd. 33, Eugen Diederichs Verlag
Shrimad Bhagavad Gita. Erläuterung von Swami Sivananda, Sivananda Yoga Vedanta Zentrum
Bhakti Yoga
Bücher:
Bhakti Sutras, Narada, Mangalam Books/YVV Das Vermächtnis, Ramakrishna, Scherz Verlag
Feste und Feiertage im Hinduismus, Swami Sivananda, YVV Götter und Göttinnen im Hinduismus, Swami Sivananda, YVV Hanuman. Sohn des Windes, K. Subrahmanyam, Ansata Verlag
Karma Yoga und Bhakti Yoga. Zwei wahre Perlen indischer Weisheit, Swami Vivekananda, Bauer Hermann Verlag
Mahabharata, Krishna Dharma, The Bhaktivedanta Book Trust Parabeln, Swami Sivananda, YVV
Ramayana, C. Schmölders, Hugendubel Verlag Yoga Geschichten, Sukadev Bretz, YVV
CDs:
Die Yoga-Weisheit der Bhagavad-Gita für Menschen von heute, Hör spiel, YVV
Entsagung und Freiheit. Die Geschichte von Königin Chudala und König Shrikidwaja, Sukadev Bretz, YVV
Yoga Geschichten, Sukadev Bretz, YVV
Yoga Geschichten aus klassischen indischen Schriften, Sukadev Bretz, YVV
Entspannung
Bücher:
Yoga Nidra, Swami Satyananda Saraswati, Ananda Verlag
CDs:
Tiefenentspannung zum Regenerieren und Auftanken, YVV Tiefenentspannung mit Nilakantha & The Love Keys, YVV
Hatha Yoga
Bücher:
Asana Pranayama Mudra Bandha, Swami Satyananda Saraswati, Ananda Verlag
Das Yoga Vidya Asana-Buch, Sukadev Bretz, YVV
Durch Yoga zum eigenen Selbst, A. van Lysebeth/W. von Grünau, Scherz Verlag
Gherandha Samhita, (klass. ind. Schrift; Verfasser unbekannt), YVV Hatha Yoga Pradipika, Swatmarama, mit Kommentaren von Brahm ananda und Swami Vishnu-devananda, Sivananda Yoga Vedanta Zentrum
Hatha Yoga, Swami Sivananda, Sivananda Yoga Vedanta Zentrum Licht auf Yoga, B.K.S. lyengar/U. von Mangoldt, Nikol Verlag Sport und Yoga, S. Yesudian/E. Haich, Drei Eichen Verlag
Shiva Samhita. Geheimlehre Indiens, (klass. ind. Schrift; Verfasser unbekannt), YVV
Weg des Lichts. Yoga für Schwangere, F. Leboyer, Kösel Verlag Yoga für Körper und Seele, Swami Sivananda, Bassermann Verlag
Yoga für Menschen von heute, A. van Lysebeth/Dr. G. Plattner, Goldmann Verlag
CDs:
Yoga für Anfänger. Sanfte Stunde, Sukadev Bretz, YVV
Yoga für Anfänger. Entspannen und Auftanken, Sukadev Bretz, YVV Yoga für Mittelstufe A. Yoga Vidya Grundreihe, Sukadev Bretz, YVV
Yoga für Mittelstufe B. Yoga Vidya Grundreihe mit Variationen, Sukadev Bretz, YVV
Yoga für Mittelstufe C. Hatha Yoga als Ganzkörperverehrung Gottes, Sukadev Bretz, YVV
Yoga für Fortgeschrittene A. Asana Variationen, Sukadev Bretz, YVV Yoga für Fortgeschrittene B. langes Halten der Asanas und Chakren konzentration, Sukadev Bretz, YVV
Yoga für Fortgeschrittene C. Asanas mit Affirmationen zur geistigen Entwicklung, Sukadev Bretz, YVV
Yoga für den Rücken. Stärkung und Entspannung von Hals, Schultern und Rücken, Eva-Maria Kürzinger, YVV
Sukadevs Fitness-Reihe für mehr Kraft und Energie, YVV Hormonyoga. Energien transformieren, Amba Popiel-Hoffmann, YVV
DVDs:
Yoga für Anfänger ohne Vorkenntnisse, Sukadev Bretz, YVV Yoga für Anfänger mit Vorkenntnissen, Sukadev Bretz, YVV
Yoga für Mittelstufe. Yoga Vidya Grundreihe, Sukadev Bretz, YVV
Jnana Yoga
Der Weg zum Selbst, H. Zimmer, Books on Demand
Das Kleinod der Unterscheidung, Shankara, Scherz Verlag Die Erkenntnis der Wahrheit, Shankara, Econ Verlag Entdecke Dich selbst, P. Brunton, Bauer Verlag
Göttliches Elixier, Swami Sivananda, YVV
Jnana Yoga, Swami Vivekananda, Phänomen Verlag Klassische Upanishaden, Übersetzung Paul Deussen, YVV Sei, was Du bist, Ramana Maharishi, 0. W. Barth Verlag Vedanta für Anfänger, Swami Sivananda, YVV
Yoga Vasishtha (Band 1 und 2), YVV
Karma Yoga
Bücher:
Karma Yoga, Swami Sivananda, YVV
Karma Yoga und Bhakti Yoga. Zwei wahre Perlen indischer Weisheit, Swami Vivekananda, Bauer Hermann Verlag
CD:
Karma und Reinkarnation. Das Leben nach dem Tod, Schicksal und Wiedergeburt, Vortrag mit Sukadev Bretz, YVV
Kirtana, Mantras, Rituale, Sanskrit
Bücher:
Das Mantra-Buch, E. Easwaran, Goldmann Verlag
227
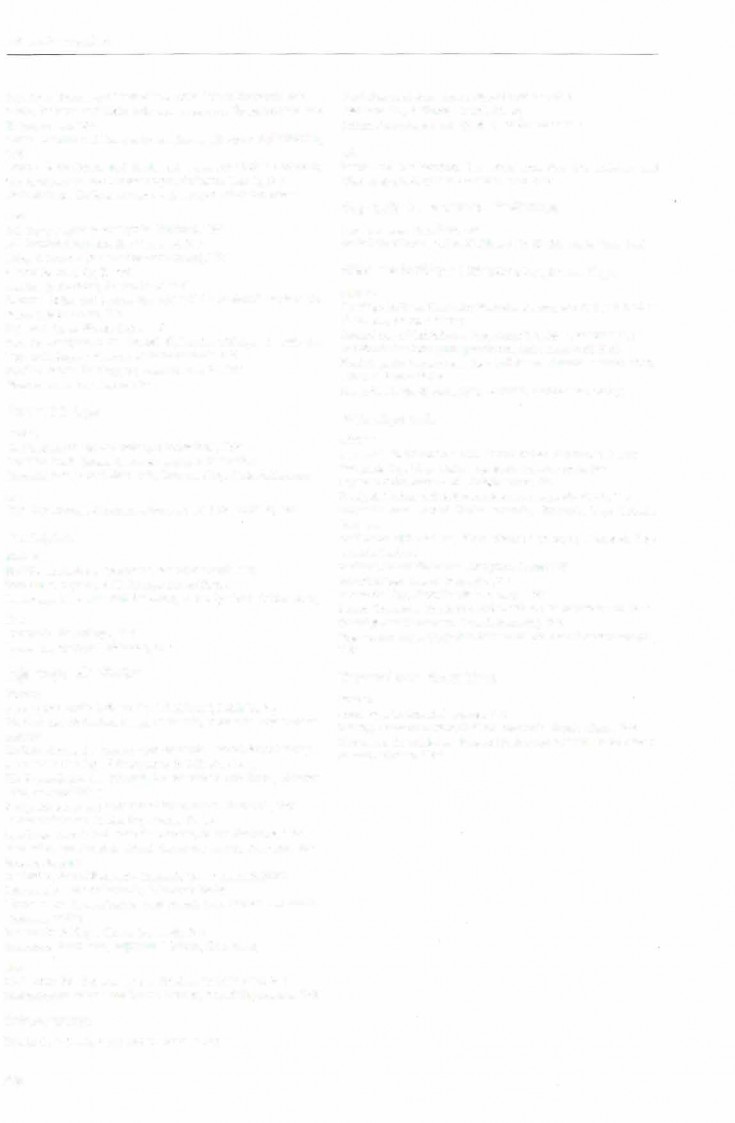
Informationsquellen
Japa Yoga. Theorie und Praxis der Mantras, Swami Sivananda, YVV Kirtan. Mantras und Liedertexte zum Singen mit Übersetzungen und Erläuterungen, YVV
Kirtan. Mantras und Liedertexte zum Singen mit Noten und Akkorden, YVV
Kirtana. Rezitationen und Lieder mit wissenschaftlicher Umschrift, Worterklärungen und Übersetzungen, Catharina Kiehnle, YVV
Nada Brahma. Die Welt ist Klang, J. E. Berendt, Suhrkamp Verlag
CDs:
108 Surya Mantra Sonnengrüße, Vani Devi, YVV 108 Kundalini Sonnengrüße, Vani Devi, YVV Kirtan 1, 2 und 3 (Satsang-Live-Aufnahmen), YVV Mantra Mantra, Gopiji, YVV
Mantras und Stotras, Sitaram Kube, YVV
Mantras, Slokas und Stotras. Eine Auswahl der machtvollsten Sanskrit Texte, Sukadev Bretz, YVV
Puja und Homa, Sitaram Kube, YVV
Sanskrit. Aussprache des Sanskrit-Alphabets, wichtiger Begriffe des Yoga und gängiger Mantras, Catharina Kiehnle, YVV
Sanskrit Trainer. Trainingsprogramm für den PC, YVV Westerwald Kirtan Classics, YVV
Kundalini Yoga
Bücher:
Die Kundalini-Energie erwecken, Sukadev Bretz, YVV Kundalini Praxis, Swami Sivananda Radha, Bauer Verlag
Kundalini Yoga, Swami Sivananda, Sivananda Yoga Vedanta Zentrum
CD:
Kriya Yoga. Energie-Erweckungsübungen aus dem Kundalini, YVV
Pranayama
Bücher:
Die Wissenschaft des Pranayama, Swami Sivananda, YVV Licht auf Pranayama, B.K.S. lyengar, Scherz Verlag
Pranayama. Die große Kraft des Atems, A. van Lysebeth, Scherz Verlag
CDs:
Pranayama für Anfänger, YVV Pranayama für Fortgeschrittene, YVV
Raja Yoga, Meditation
Bücher:
Der geheimnisvolle Helfer in dir, K. 0. Schmidt, Reichl Verlag
Die Kraft der Gedanken, Swami Sivananda, Sivananda Yoga Vedanta Zentrum
Die Überwindung der Furcht, Swami Sivananda, Heinrich SchwabVerlag
Die Wurzeln des Yoga, P. Deshpande, 0. W. Barth Verlag
Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute, Sukadev Bretz, Via Nova Verlag
Erfolgreich leben und Gott verwirklichen, Swami Sivananda, YVV Herzensweisheiten, Louise Hay, Lüchow Verlag
Japa Yoga. Theorie und Praxis der Mantras, Swami Sivananda, YVV Meditation und Mantras, Swami Vishnu-devananda, Sivananda Yoga Vedanta Zentrum
Meditation, Swami Sivananda, Sivananda Yoga Vedanta Zentrum Raja Yoga, Swami Vivekananda, Phänomen Verlag
Übungen zu Konzentration und Meditation, Swami Sivananda, Goldmann Verlag
Vedanta für Anfänger, Swami Sivananda, YVV
Vollendung durch Yoga, Rammurti S. Mishra, Econ Verlag
CDs:
Meditation. Der Weg zum inneren Frieden, Sukadev Bretz, YVV Meditation für Energie und inneren Frieden, Swami Nirgunanada, YVV
Reinkarnation
Blick in die Ewigkeit, E. Alexander, Ansata Verlag
228
Das Leben nach dem Tod, R. Moody, Rororo Verlag Reinkarnation, R. Zürrer, Govinda-Verlag
Schicksal als Chance, T. Dethlefsen, Goldmann Verlag
CD:
Karma und Reinkarnation. Das Leben nach dem Tod, Schicksal und Wiedergeburt, Vortrag mit Sukadev Bretz, YVV
Vegetarische & vegane Ernährung
Das Yoga vegan Kochbuch, YVV
Vedische Kochkunst, A. Dasa/C. Rücker, The Bhaktivedanta Book Trust
Wissenschaftliche Untersuchungen zu Yoga
Bücher:
Der Weg des Yoga, Abschnitt: Westliche Medizin und Yoga, Dr. med. D. Ebert, BDY, Via Nova Verlag
Gesund durch Meditation, J. Kabat-Zinn/H. Kappen, Knaur Verlag Handbuch der Entspannungsverfahren, Petermann/Vaitl, Beltz Physiologische Aspekte des Yoga und der Meditation, Dietrich Ebert, Urban & Fischer Verlag
Revolution in der Herztherapie, D. Ornish, Kamphausen Verlag
Yoga allgemein
Bücher:
Das große illustrierte Yogabuch, Swami Vishnu-devananda, Aurum Das große Yoga Vidya Hatha Yoga Buch, Sukadev Bretz, YVV
Das Yoga Vidya Asana-Buch, Sukadev Bretz, YVV
Erfolgreich leben und Gott verwirklichen, Swami Sivananda, YVV Integraler Yoga, Swami Venkatesananda, Sivananda Yoga Vedanta Zentrum
Meditation und Mantras, Swami Vishnu-devananda, Sivananda Yoga Vedanta Zentrum
Sadhana, Swami Sivananda, Mangalam Books/YVV Samadhi Yoga, Swami Sivananda, YVV
Sivananda Yoga, Swami Venkatesananda, YVV
Swami Sivanandas Inspiration und Weisheit für Menschen von heute
{Auszüge aus Werken von Swami Sivananda), YVV
Yoga Vasishtha. Band 1, In der Übersetzung von Swami Venkatesananda, YVV
Yogameister (Biografien)
Bücher:
Autobiografie, Swami Sivananda, YVV
Der Yogi. Portraits von Swami Vishnu-devananda, Gopala Krishna, YVV Sivananda. Ein moderner Heiliger. Erzählt und gesammelt von seinen engsten Schülern, YVV
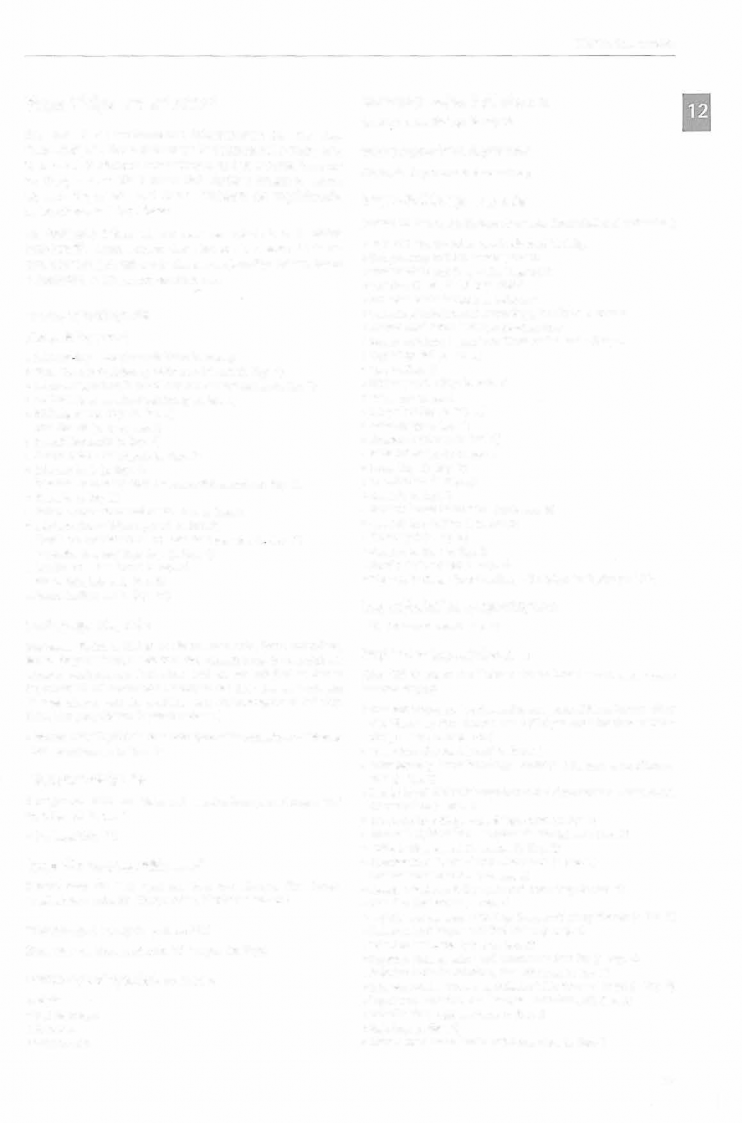
Informationsquellen
Yoga Vidya im Internet
Hier findest du umfangreiche Informationen aus der Yoga Vidya-Welt, die dir als vielseitiges Begleitmaterial in Text-, Bild, Video- und Audioform unterstützend zu deiner Ausbildung zur Verfügug stehen. Sie können dich darüber hinaus in deiner eigenen Yogapraxis und deiner Tätigkeit als Yogalehrer/in unterstützen und inspirieren.
Als Anregung haben wir für dich exemplarisch auch einige Suchbegriffe entsprechend der Themen in diesem Buch zu sammengetragen. Gib dafür einfach die jeweilige Internetseite
+ Suchwort in eine Suchmaschine ein.
(Das große Yogaportal)
+ 2-Jahres Yogalehrer/in-Ausbildung (s. Kap. 1)
+ Yogalehrer/in Ausbildung 4-Wochen-lntensiv (s. Kap. 1)
+ 2-Jahres-Yogalehrer/in-Ausbildung im Bausteinsystem (s. Kap. 1)
+ 3-Jahres-Yogalehrer/in-Ausbildung (s. Kap. 1)
+ Wirkungen von Yoga (s. Kap. 1)
+ Yoga für Anfänger {s. Kap. 1)
+ Swami Sivananda {s. Kap. 1)
+ Swami Vishnu-Devananda (s. Kap. 1)
+ Sukadev Bretz {s. Kap. 1)
+ Sukadev Bretz Jnana Yoga / Vedanta-Philosophie (s. Kap. 2)
+ Vedanta (s. Kap. 2)
+ Vedanta Meditation und Jnana Yoga {s. Kap. 2)
+ Reinkarnation - Wiedergeburt (s. Kap. 2)
+ Klassische Upanishaden -Die Weisheit des Yoga (s Kap. 2)
+ Kundalini Yoga und Raja Yoga {s. Kap. 4)
+ Meditation - Das Portal (s. Kap. 4)
+ Vegetarisch Leben (s. Kap. 9)
+ Asana-Lexikon A-Z {s. Kap. 11)
mein.yoga-vidya.de
(Auf dieser Plattform findest du die neuesten Infos, Fotos und Videos, kannst Fragen zu Yoga, Meditation, Ayurveda, Spiritualität und dich mit anderen austauschen. Außerdem hast du die möglichkeit deinen Yogaunterricht oder verwandte Leistungen mit einer eigenen Profilseite zu präsentieren und du profitierst von Aktionsangeboten bei Yoga Vidya, Europas größtem Yogaseminarhaus.)
+ Warum wirkt Yoga? Raja Yoga Konzepte: Geist und Körper-Wirkung von Yogaübungen (s. Kap. 4)
blog.yoga-vidya.de
(Neuigkeiten rund um Yoga, mit Mantra-Übungsanleitungen und Vorträgen als Podcast)
+ Der Yoga Vidya Stil
https://sho p.yoga-vidya.de/
{Online Shop für alles rund um Yoga von Literatur über Musik, Yogakleidung, -zubehör, Klangschalen, Räucherwaren etc.)
{Infos über die therapeutischen Wirkungen des Yoga)
+ Allgäu
+ Bad Meinberg
+ Nordsee
+ Westerwald
www.yoga-vidya.de/de/ asana
(Infos rund um die Yogaübungen)
{Finde ein Yogacenter in deiner Nähe)
https://wiki.yoga-vidya.de
{Wissen über Yoga, Meditation, Ayurveda, Gesundheit und spiritualität)
+ Yoga und Sport-Video und Audio mp3 Vorträge
+ Entspannung und Stressmanagement
+ Wissenschaft und Yoga - Wie Yoga wirkt
+ Vorträge für alle YLA 9 Tage WBi A
+ Interview-Reihe "Fragen an Sukadev"
+ Vedanta Meditation und Jnana Yoga, Kurs in 20 Lektionen
+ Mantra Meditation lernen, 8 Wochen-Kurs
+ Sukadevs Antworten auf von "Emailern" gestellte Fragen
+ Yoga Vidya Stil {s. Kap. 1)
+ Yoga (s. Kap. 1)
+ Wirkungen des Yoga {s. Kap. 1)
+ Yogaarten (s. Kap.l)
+ Integraler Yoga (s. Kap. 1)
+ Spiritualität {s. Kap. 1)
+ Sivananda Ashram {s. Kap. 1)
+ Vishnu-devananda (s. Kap. 1)
+ Jnana Yoga (s. Kap. 2)
+ Das Absolute (s. Kap. 2)
+ Sanskrit (s. Kap. 3)
+ Sanskrit lernen leicht gemacht (s. Kap. 3)
+ Sanskrit Kurs Lektion 1 (s. Kap. 3)
+ Devanagari (s. Kap. 3)
+ Sanskrit Lexikon (s. Kap. 3)
+ Sanskrit Wörterbuch (s. Kap. 3)
+ YVS - MP3 (Yoga Vidya-Schulung-Vorträge der 2-jährigen YLA)
https://schrifte n.yoga-vidya.de
+ Die Bhagavad Gita {s. Kap. 7)
https://www.yo utube .com
(über 400 Videos zu den Themen der 2-jährigen YLA u. v. m.- siehe gesamte Playlist)
+ Yoga Vidya Schulung {Vortragsreihe zum ganzheitlichen Yoga mit über 400 Videos zu den Themen der 2-jährigen Yogalehrer/innenausbil dung u. v. m.) (s. Kap. 1-11)
+ Yoga Vidya Stil, was ist das? {s. Kap. 1)
+ Sukadevs Yoga Vidya Schulung - Vortragsreihe zum ganzheitlichen Yoga (s. Kap. 1)
+ Was ist Yoga? Die 3 Wirkungsebenen des Yoga: Harmonie, Erweckung, Transzendenz {s. Kap. 1)
+ Die Sechs Yoga Wege - die 6 Yoga Arten (s. Kap. 1)
+ Was heißt Spiritualität - 7 Spirituelle Prinzipien (s. Kap. 1)
+ Sukadev über Swami Sivananda {s. Kap. 1)
+ Sukadev über Swami Vishnu-devananda (s. Kap. 1)
+ Sukadev über Yoga Vidya (s. Kap. 1)
+ Sukadev: Vedanta Philosophie und Jnana Yoga (s. Kap. 2)
+ Sukadev: Drei Gunas (s. Kap. 2)
+ Moksha und Samadhi-19. Yoga Kongress Vortrag: Narada {s. Kap. 2)
+ Sukadev: Drei Körper und fünf Hüllen (s. Kap. 2)
+ Sukadev: Der Astralkörper (s. Kap. 2)
+ Sukadev: Reinkarnation und Leben nach dem Tod (s. Kap. 2)
+ Sukadev: Indische Schriften, Yoga Schriften (s. Kap. 2)
+ Interview-Reihe "Fragen an Sukadev": Wo entstand Yoga? (s. Kap. 2)
+ Yoga Sutra - Weisheit des Patanjali - Einführung (s. Kap. 2)
+ Indische Philosophiesysteme (s. Kap. 2)
+ Raja Yoga (s. Kap. 4)
+ Mantra Meditation lernen, 8 Wochen-Kurs {s. Kap. 4)
229
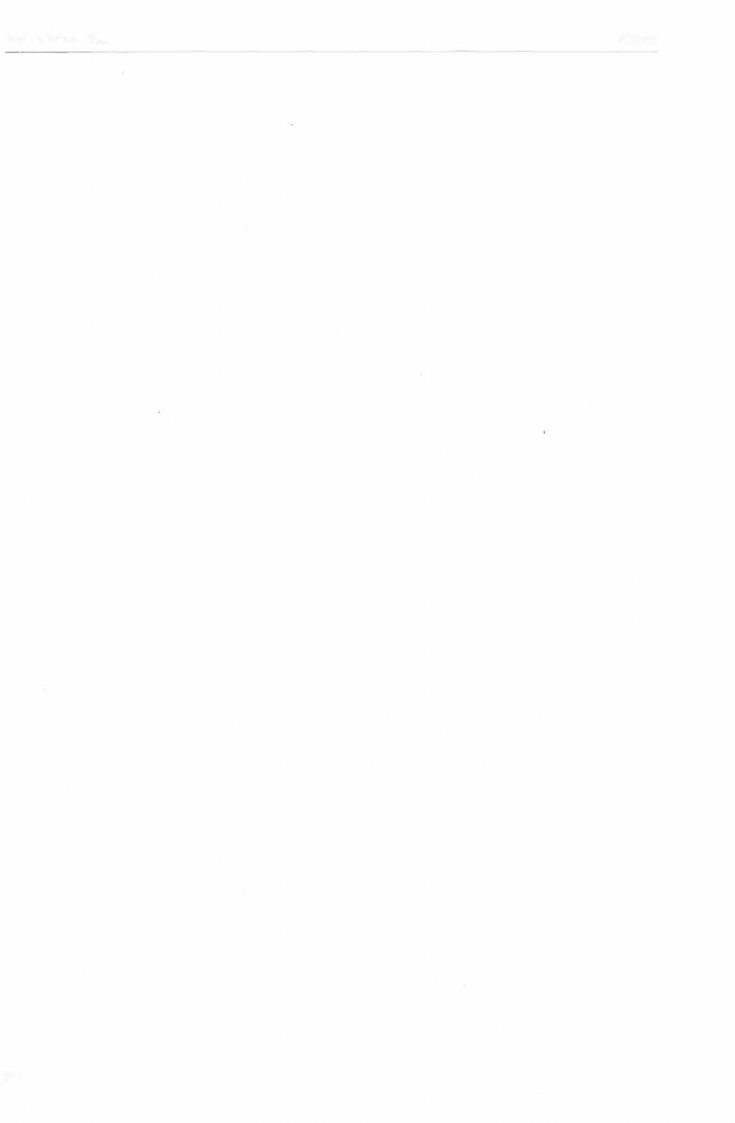
Informationsquellen Notizen
230
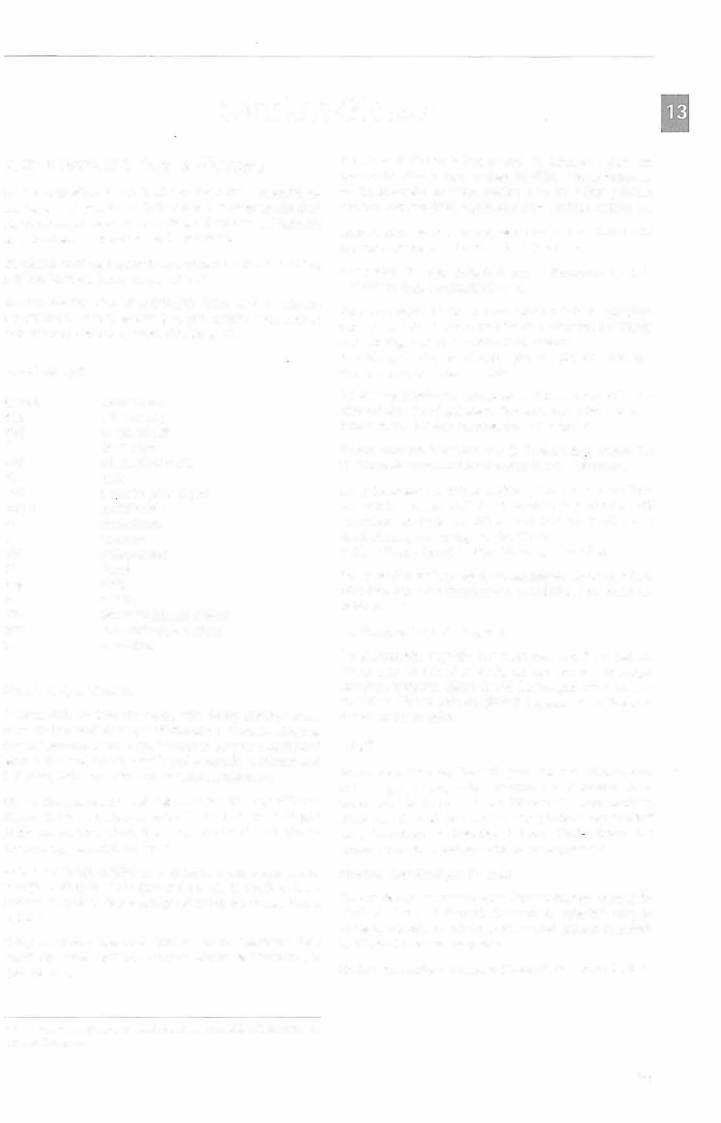
Sa nskrit-G lossa r
Zum Gebrauch dieses Glossars
Die Sanskrit-Wörter* sind in wissenschaftlicher Umschrift ge schrieben und gemäß der Reihenfolge des westeuropäischen Alphabets angeordnet. In den eckigen Klammern [...] befindet sich die allgemein vereinfachte Schreibweise.
Im Glossar steht bei Substantiven das Genus in Kursivschrift: m,
f, n (maskulinum, femininum, neutrum).
Sanskrit-Beg·riffe sind grundsätzlich klein- und in wissen schaftlicher Umschrift geschrieben, mit Ausnahme von Namen (von Göttern, Personen, Orten, Werken u. a.).
Abkürzungen
Bei eingeschliffenen Wörtern wird im Deutschen gern die zweitletzte Silbe betont, sodass fälschlicherweise ku,:,r;Ja!Tni, yogTni, bhramäri, anahäta, cintäna uvm. für richtig gehalten werden, statt ku,:,r;JalinT, yoginT, bhrämarT, anähata, cintana etc.
Kurzes a wird geschlossen ausgesprochen, d. h. der Mund wird nicht so weit aufgemacht wie beim deutschen a.
-
Das r wird als Vokal aufgefasst und in Nordindien zu ri, in Mahärä$tra (ind. Bundesstaat) zu ru.
Bei Konsonanten ist die Unterscheidung zwischen aspirierten und unaspirierten Konsonanten für die Bedeutung der Wörter sehr wichtig, aber für Deutsche nicht einfach:
ka - kha, ga - gha, ca - cha, ja - Jha, ta - tha, r;Ja - r;Jha, ta -
tha, da - dha, pa - pha, ba - bha.
astron. Bez.
BhG
f GhS hlg.
HYP
lndek/
m n phil. PI
Präf rel. SSP YCU YS
astronomisch Bezeichnung Bhagavad-gTtä femininum Gherar:ic;la-sarnhitä heilig
Hatha(yoga)pradTpikä lndeklinabile maskulinum
neutrum philosophisch Plural
Präfix religiös
Siddhasiddhäntapaddhati Yogacüc;lämar:ii-upani$ad Yoga-sütra
Bei der Aussprache der unaspirierten Konsonanten sollte sich eine vor den Mund gehaltene Kerzenflamme möglichst nicht bewegen, wie bei dem französischen Wort 'table'.
Konsonanten mit Punkt darunter (t, th, c;l, c;lh, r:i, s) werden mit (Richtung Gaumen) zurückgebogener Zunge gesprochen.
Das h innerhalb von Wörtern, Sätzen, Strophen und am Ende von Wörtern (wenn nicht durch spezielle Regeln verändert): Hauchlaut; am Ende von Sätzen, Strophen: wie h mit kurzer Wiederholung des vorangehenden Vokals:
Siva� - Sivaha, Vi$1JU� - Vi$r:iuhu, Hari� - Harihi etc.
Das rn im Glossar kann oft als m ausgesprochen werden bzw. wird dem folgenden Konsonanten angeglichen (was meist da beisteht).
Der Konsonant r ist ein Zungen-r.
Das s entspricht ungefähr dem Deutschen sch. Bei c liegt die Zunge zwar an derselben Stelle, es wird jedoch tsch ausge
Sanskrit-Aussprache
Es lohnt sich, die Sanskrit-Fachbegriffe richtig auszusprechen, da so die Verständlichkeit der Wörter und der schöne Klang des Sanskrit gewahrt bleiben. (Im Deutschen kann man auch nicht einfach Saft und Schaft, versifft und verschifft, Mühlstein und Müllstein, Hüte und Hütte etc. beliebig austauschen).
Die richtige Aussprache ergibt sich aus der wissenschaftlichen Umschrift wie sie im Glossar an vorderster Stelle steht Sie gibt Aufschluss darüber, ob ein Vokal lang oder kurz ist und wie ein Konsonant genau artikuliert wird.
Vokale mit Strich darüber (ä, T, 0) sowie e und o sind immer lang (z. B. änanda wie in Saat und am wie in Boot), d. h. sie werden doppelt so lang ausgesprochen wie die kurzen Vokale
a, i, u, r.
Beispiele: sastra bedeutet 'Waffe', sästra 'Lehrtext'; bala 'Kraft', bäla 'Kind', Kä/T 'die schwarze Göttin', kali 'Zeitalter', in dem wir leben ...
-
Das Glossar enthält neben Sanskrit-Begriffen auch einige Stichwörter aus anderen Sprachen.
-
sprochen: tschakras (cakra-s) sind die Energiezentren im fein stofflichen Körper, Schakra (Sakra) dagegen ist ein Beiname des Götterkönigs lndra.
Hindi
Kurzes a am Ende von Sanskrit- (und anderen) Wörtern wird nicht ausgesprochen, außer manchmal in Gedichten. D. h. wenn man die End-a-s bei den Wörtern der Liste weglässt, erhält man die HindT-Aussprache: Sarnskrta GirTsa wird zu HindT GirTs, Manohara zu Manohar. Bei den HindT Wörtern des Glossars wurden unausgesprochene a-s weggelassen.
Sonstige Veränderungen im HindT:
Die auf -in und -an auslautenden Sanskrit-Stämme werden im HindT zu -T und -ä (Sanskrit-Nominative): adhikärin wird zu adhikärT, advaitin zu advaitT, yogin zu yogT, a,:,iman zu a,:,imä. Im Glossar ist beides angegeben.
(Siehe auch Kapitel 3 'Sarnskrta (Sanskrit)', besonders S. 35 f.)
231
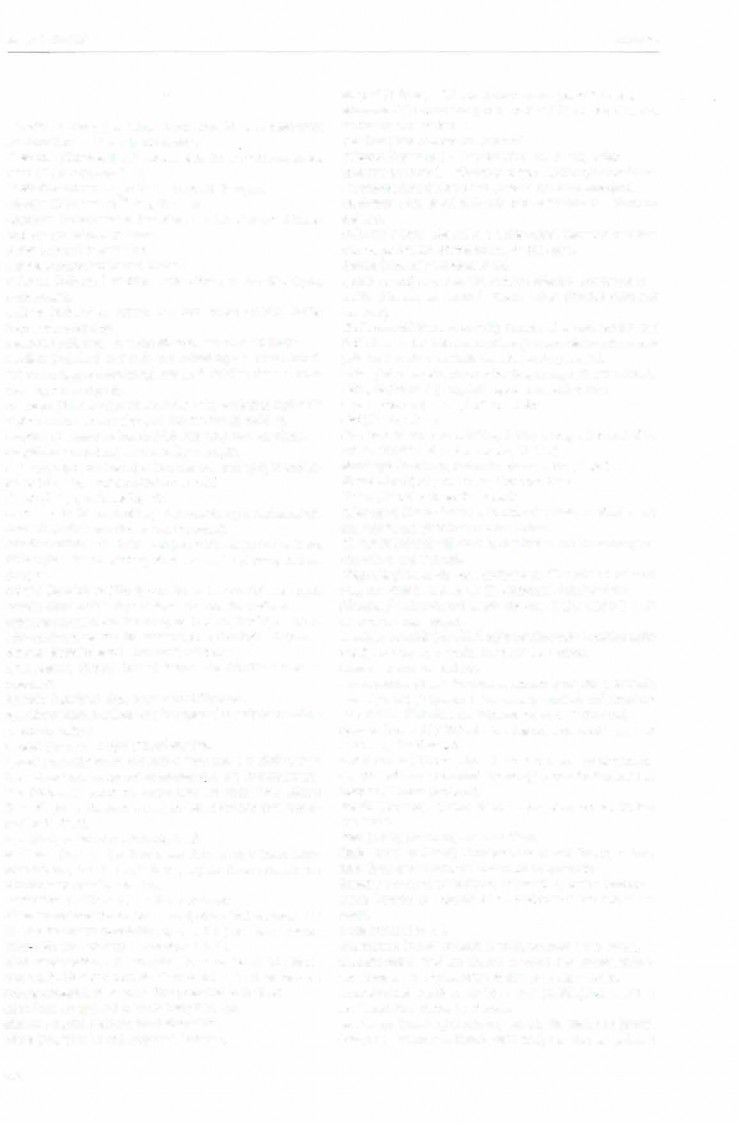
Sanskrit-Glossar
A
abhariga [Abhanga] m 'ohne Bruch', Bez. für eine bestimmte Art devotionaler Lieder in Mahärä?tra.
äbhara,:,a [Abharana] n Schmuck; eine der Darreichungen bei
der pOjä (Verehrungsritual).
abhimäna [Abhimana] m Stolz, Hochmut, Arroganz.
abhyäsa [Abhyasa] m Übung, Studium.
äcamana [Achamana] n Ausspülen des Mundes vor Ritualen und vor und nach dem Essen.
äcära [Achara] m Verhalten.
äcärya [Acharya] m Lehrer, Meister.
adhama [Adhama] niedrigst, schlechtest; m der Niedrigste, Sch!echteste.
ädhära [Adhara] m Stütze; das, was etwas enthält, Gefäß;
Konzentrationspunkt.
adharma [Adharma] m Nicht-dharma, unrechtes Verhalten. adhikäri [Adhikari] m (Hindi; von adhikärin) ein durch Autori tät/Berechtigung charakterisierter (z. B. Schüler, der zu Unter
weisung berechtigt ist).
adhvaryu [Adhvaryu] m Priester, der beim vedischen Opfer die Opferhandlungen ausführt und den Yajur-veda rezitiert. adhyäsa (Adhyasa] m (falsche) Übertragung bzw. Annahme. adhyätma [Adhyatma] auf das Selbst bezogen.
ädi-Se$G, se$a [Adishesha] m Bez. der tausendköpfigen Schlan
ge, auf der Vi?r:iu auf dem Weltmeer ruht.
äditya [Aditya] m Sonne(ngott).
advaita [Advaita] zweiheitlos, nichtdualistisch; n Nichtdualität, Identität (insbes. von ätman und brahman).
advaita-vedänta [Advaita Vedanta] m nichtdualistischer vedänta, Philosophie des Monismus, eines der sechs philosophischen Systeme.
advaiti [Advaiti] m (Hindi; von Sanskrit advaitin) der durch
advaita charakterisierte; Anhänger des advaita-vedänta. ägama (Agama] m das Kommen; rel. Doktrin, Schrift; n sektari sche Schriften, welche die Verehrung von Gottheiten lehren. ägämin, ägämT[Agami] kommend, zukünftig.
ägämi-karma [Agami Karma] karma, das künftig auf einen zukommt.
agarbha [Agarbha] ohne Mutterschoß/Embryo.
agarbha-prä,:,äyäma [Agarbha Pranayama] m prä,:,äyäma ohne
mantra bzw. japa.
ägneya [Agneya] zu agni (Feuer) gehörig.
ägneyi [Agneyi] f Name von Agni-s Frau; Bez. der südöstlichen Ecke eines Hauses; ägneyT yoga-dhäranä: die Yogakonzentra tion (dhära,:,ä), durch die yogT-s usw. am Ende ihres Lebens ihren Körper in Flammen aufgehen lassen können (Bhägavata purär:ia 11.31.6).
agni [Agni] m Name des Feuer(gottes).
agni-sära [Agni Sara] n Essenz des Feuers; kriyä (hier: Reini gungsübung), bei der durch Bewegung der Bauchmuskeln die Bauchorgane massiert werden.
agni-tattva [Agnitattva] n das Element Feuer.
aham brahmäsmi [Aham Brahmasmi] aham brahma asmi 'ich bin das Brahman'; mahäväkya (großer Satz) aus dem Weißen Yajur veda (Brhadärar:iyaka-upani?ad 1.4.10).
ahari-graha-upäsanä [Ahamgraha Upasana] f abstrakte Medi
tation z. B. über brahman als eigenes Selbst, im Gegensatz zu
pratTka-upäsanä, Meditation über gestalthafte Gottheit. ahari-kära [Ahamkara] m Ich/Selbstgefühl, Ego. ahantä [Ahanta] flchheit, Ich/Selbstgefühl.
ähära [Ahara] m 'zu sich nehmen', Nahrung.
232
abhariga
ahif!)sä [Ahimsa] f 'Nichtverletzen', erster yama (YS 2.30). ahuramazdä (Ahuramazda] m (Awestisch) Name des höchsten Gottes im Zoroastrismus.
aif!) [Aim] bija-mantra von SarasvatT.
aisvarya [Aishvarya] n Herrschaftlichkeit, Macht, Größe. aitareya-upani$ad, aitareyopani$ad [Aitareya-upanishad, Aitareyopanishad] feine zum Rg-veda gehörige upani$ad. ajäti-väda [Ajati Vada] m Gauc;Ja-päda-s Theorie des Nichtent
stehens.
äjfiä-cakra [Ajna Chakra] n 'Befehls-cakra', Zentrum zwischen den Augenbrauen, Stirnzentrum, drittes Auge.
ajfiäna [Ajnana] / Unwissen(heit).
ajfiäni [Ajnani] m (Hindi; von Sanskrit ajnänin) Unwissender. äkäsa [Akasha] m Himmel, Raum, Äther (fünftes subtilstes Element).
äkäsa-Chronik [Akashachronik] Summe aller aufgezeichneten Gedanken in der Gedankensphäre (theosophisch-anthroposo phische Theorie vom Ende des 19. / Anfang 20. Jh.).
akbar [Akbar] m Mogulherrscher (Regierungszeit 1556-1605).
akha,:,<;ia [Akhanda] ungeteilt, ganz, ununterbrochen.
ak$ara [Akshara] unvergänglich; n Silbe.
ak$i [Akshi] n Auge.
älambana (Alambana] n Stütze, Stätte; im yoga: Konzentration auf ein Objekt (Vyäsa-Kommentar, YS 1.17).
alambu$ä (Alambusa] feine der vierzehn Haupt-nä<;iT-s. ä/andT[Alandi] Pilgerort in der Nähe von Pur:ie. älasya [Alasya] n Trägheit, Faulheit.
aläta-cakra [Alata Chakra] n leuchtender Kreis, gebildet durch das Schwingen eines brennenden Holzes.
allahabäd [Allahabad] Stadt in Nordindien am Zusammenfluss
von Garigä und Yamunä.
Allopathie f(Deutsch; von Altgriechisch: allos pathos) Behand lung mit Mitteln 'anders als die Krankheit', Schulmedizin.
Alveolen f (Deutsch; von Latein alveolus 'kleine Mulde') Luft bläschen in den Lungen.
äma/aka, äma/akT[Amalaka] n/fäma/aka-Baum (Emblica offici
nalis), Myrobalan, n Frucht des Baumes, s. ämlä.
amara [Amara] unsterblich.
amara-purU$G (Amara Purusha] m unsterblicher Mann, Mensch. amarT [Amari] f Eigenurin; von amara, 'unsterblich' (machen der) Nektar; Heilmittel der Käpälika-yogT-s (HYP 3.96-98). amara/T [Amaroli] f Variante von vajro/T, eine mudrä zur Ver hinderung der Ejakulation.
ambä [Amba] f Mutter, Bez. für Durgä und andere Göttinnen. ämbhasi dhära(Jä [Ambhasi Dharana] fKonzentration auf (das Element) Wasser (ambhas).
ambikä [Ambika] f Mutter, Verkleinerungsform von ambä, Bez. von Durgä.
ämin [Amin] (Arabisch) Amen im Islam.
äm/ä (Amla] m (Hindi) Myrobalan-Baum und Frucht, s. öma
/aka. Eines der wichtigsten Heilmittel im äyurveda.
ämnäya (Amnaya] m Tradition; heiliger Text, veda-s, tantra-s. am_rta [Amrita] n Unsterblichkeit; Ambrosia (Unsterblichkeits trank).
Gf!JSG [Amsha] m Teil.
af!)sävatära [Amsha Avatar] m Teilinkarnation eines Gottes. anähata-cakra [Anahata Chakra] n 'cakra des unangeschlage nen Klanges', Energiezentrum in der Höhe des Herzens. anähata-näda (Anahata Nada] m unangeschlagener Klang, in der Meditation hörbar im Herzen.
ana'l-haqq (Analhaq] (Arabisch) 'ich bin die Wahrheit (Gott)'. Ausspruch Mansur al-Hallajs (857-922), für den er gefoltert
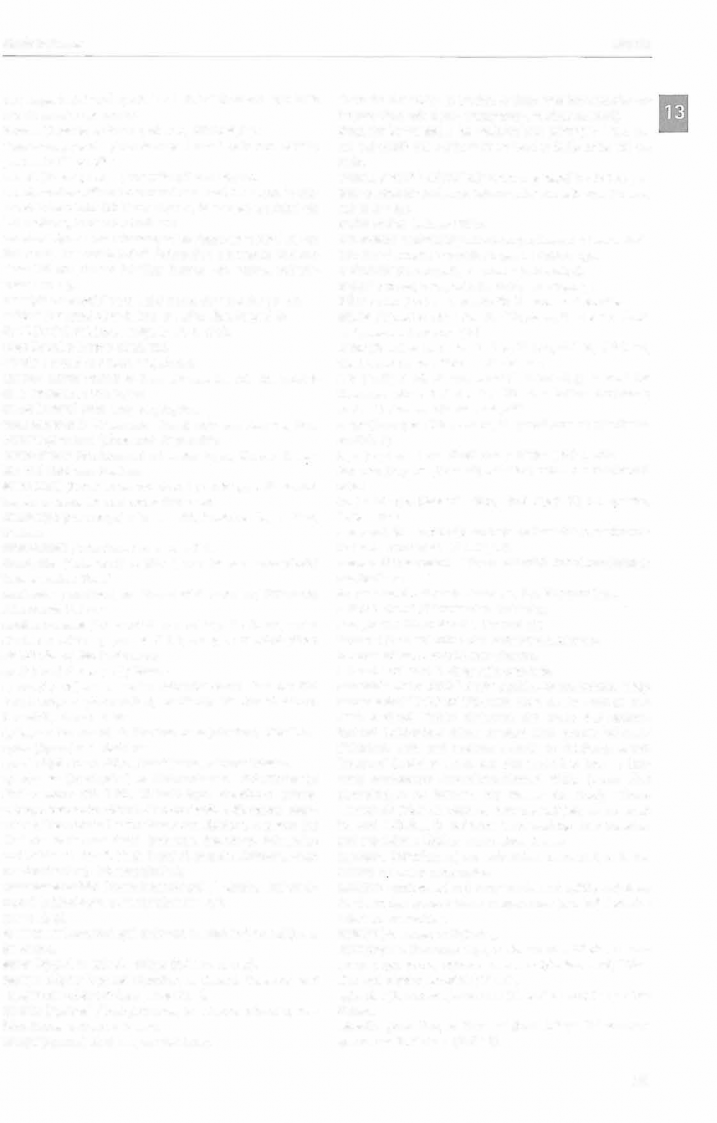
Sanskrit-Glossar
und hingerichtet wurde; wird nach SvämT Sivänanda von Sufis wie ein mantra verwendet.
änanda [Ananda] m Freude, Wonne, Glückseligkeit.
änanda-maya-kosa [Anandamaya Kosha] m/n aus Wonne gemachte Körperhülle.
ananta [Ananta] endlos, unendlich; Name Vi�r:iu-s.
ananta-padma-näbha [Anantapadmanabha] m Ananta, in des sen Nabel ein Lotos ist: Name Vi�r:iu-s, da aus seinem Nabel ein Lotos wächst, in dem Brahmä sitzt.
anantanäräya,:,a [Ananthanarayan] m Name eines Schülers von Sivänanda. Er schrieb SvämT Sivänanda-s Biographie und gab einen Teil von dessen Schriften heraus (-th- südind. Schreib weise von -t-).
anasüyä [Anasuya] f ohne Neid; Name der Frau des [$i Atri.
anätmä [Anatma] ohne Selbst, m Nichtselbst, körperlich.
äQ<;iäl [Andal] f südind. Heilige (9. Jh. n. Chr.).
ariga [Anga] n Körper, Glied, Teil.
arigu/a [Angula] m Finger, Fingerbreit.
af)iman, af)imä [Anima] m Kleinheit; eine der acht übernatürli chen Fähigkeiten von yogT-s.
anitya [Anitya] nicht ewig, vergänglich.
anna-maya-kosa [Annamaya Kosha] min aus Nahrung bzw. Materie gemachte {physische) Körperhülle.
antaf)-karaf)a [Antahkarana] n inneres Organ, Sitz von Gedan ken und Gefühlen, Denken.
antar; antat) [Antar] innen, zwischen, in; r oder f) gemäß sandhi
Regeln, s. antof)-karaf)a, antor-ätman usw.
antar-ariga [Antaranga] n innerer Teil, innerstes Organ, Herz, Denken.
antar-ätman [Antaratman] m inneres Selbst.
antar-yämT [Antaryami] m (Hindi; von Sanskrit antar-yämin)
innerer Lenker, Selbst.
anubhava [Anubhava] m direkte Wahrnehmung, Erfahrung; Selbstverwirklichung.
anuloma-viloma [Anuloma-Viloma] entlang der Haare, gegen die Haare: mit und gegen den Strich; bezogen auf präf)ä-yäma: när;JT-sodhana, Wechselatmung.
äpaf) [Apas] PI von [ap-] f Wasser.
apäna [Apana] m nach unten gehender Atem: einer der fünf Haupt-prä0a-s (Atemsorten), zuständig für Ausscheidung, Sexualität, Menstruation.
äpäf)<;iura [Apandura] ein bisschen blass (päf)<;iura), blässlich.
apara [Apara] u. a. niedriger.
aparä vidyä [Apara Vidya] f niedrigeres, relatives Wissen. aparigraha [Aparigraha] m Nichtumfassen, Nichtgierigsein; fünfter yama (YS 2.30., Vyäsabhäwa: Vi$ayänäm arjana rak$Of)O-k$ayasanga-hirr,sä-do$a-darsanäd svTkara0am apari grahaf), 'das nicht in Besitznehmen von Objekten, weil man das Übel des Verletzens durch Erwerben, Bewahren, Schwinden und Anhängen sieht'). Nach SvamT Sivänanda: Nichtannehmen von Geschenken; Unbestechlichkeit.
aparo/cya-anubhüti [Aparokshanubhuti] f 'direkte Wahrneh
mung'. Salikaräcärya zugeschriebenes Werk.
apas s. äpaf,
apauru$eya [Apaurusheya] nicht von Menschen (gemacht) z. B. die veda-s.
appar [Appar] m südind. Heiliger (6./7. Jh. n. Chr.).
appaya dTk$itar [Appaya Dikshitar] m südind. Gelehrter und Heiliger der Advaita-Schule (1608-1680).
apsaras [Apsaras] f halbgöttliches, im Himmel lebendes, ver
führerisches weibliches Wesen.
apürf)a [Apurna] nicht voll, unvollständig.
asvattha
ärambha [Arambha] m Beginn, Anfang; ärambha-avasthä An fangsstadium (ein durch präf)äyäma erreichter Zustand). äraf)yaka [Aranyaka] n 'zu Wald/Wildnis gehöriger' (Text, der nur außerhalb des Dorfes rezitiert werden darf); dritte Teil des veda.
arcana, arcanä [Archana] n/JVerehrung, respektvolle Bez. gen über Gottheiten und Autoritäten; Opfer von Reis oder Blumen; Teil einer piljä.
ardha [Ardha] halb, m Hälfte.
ardha-matsyendräsana [Ardha Matsyendrasana] n halber Dreh sitz; eine der zwölf Grundstellungen im hatha-yoga. ardhänginT [Ardhangini] f Ehefrau < [ardha-anga].
arghya [Arghya] n respektvolle Gabe, Darbringung.
arhat [Arhata] m im Theraväda Buddhismus: Vollendeter. arjuna [Arjuna] m einer der fünf Pär:ic;lava-s, Freund und Schü ler Kr�r:ia-s, s. Bhagavad-gTtä.
artha [Artha] m u. a. Zweck, Sinn, Nutzen, Objekt, Reichtum, Geld; eines der vier Ziele des Menschen.
ärtT [Arati] f (Hindi; von Sanskrit ärätrika(m)) abendliches
Schwingen eines Lichts vor dem Bild eines Gottes oder guru-s;
heute: Lichtzeremonie nach der piljä.
aruf)a [Aruna] m rötliche Farbe, Morgendämmerung (auch per sonifiziert).
ärya [Arya] m 'zu den Gastlichen gehöriger', Arier, Edler. Aryaman [Aryaman/Aryamä] m vedischer Gott der Gastfreund schaft.
Asafoetida Jim (Sanskrit hingu, Hindi hTrr,g) (PI) ind. Gewürz, Teufelsdreck.
asamprajnäta-samädhi [Asamprajnata Samadhi] m meditativer Zustand ohne Objekt (YS 1.17, 18).
asarr,sakti [Asamsakti] J fünfte bhümikä: Anhaftungslosigkeit des Denkens.
äsana [Asana] n das sich Hinsetzen, Sitz, Körperstellung.
asänti [Ashanti] J Nichtfrieden, Unfrieden.
dsat [Asat] n Nichtseiendes, Unwahrheit.
äsram(a) [Ashram] m/n Aufenthaltsort von Asketen; Lebensstadium, s. varf)äsrama-dharma.
a$tan [Ashta] acht, in Komposita O$ta/a$tä.
a$tasiddhi [Ashta Siddhi] facht siddhi-s, übernatürliche Fähig keiten: a0imä 'Kleinheit' (Fähigkeit, klein wie ein Atom zu wer den); mahimä 'Größe' (Erlangen der Größe des Raums); laghimä 'Leichtigkeit' (ohne Gewicht sein); garimä 'Schwere' (Fähigkeit, sich und anderes schwer zu machen); präpti 'Erlangen' (jeglicher Dinge, wie den Mond berühren zu kön nen); präkämyam (unwiderstehlicher) 'Wille' (etwa, alles durchdringen zu können, wie Wasser die Erde); Tsitvam 'Herrschaft' (über die Materie, bzw. die Fähigkeit, sie zu schaf fen und aufzulösen); vasitvam 'Unterwerfung' (der belebten und unbelebten Objekte unter seinen Willen).
G$täk$ara [Ashtakshara] aus acht Silben bestehend, z. B. der
mantra am namo näräyaf)äya.
a$täk$arT [Ashtakshari] m (Hindi; von Sanskrit O$täk$arin) einer, der durch den aus acht Silben bestehenden [mantra] charakte risiert ist, ihn rezitiert.
O$täriga [Ashtanga] achtgliedrig.
O$täriga-yoga [Ashtanga Yoga] m der aus acht Gliedern beste hende yoga: yama, niyama, äsana, präf)äyäma, pratyähära, dhäraf)ä, dhyäna, samädhi (YS 2.92).
a$tävakra [Ashtavakra] man acht (Stellen) krumm; Name eines Weisen.
asvattha [Ashvattha] m Ficus religiosa: heiliger Feigenbaum; Symbol der Schöpfung (BhG 15).
233
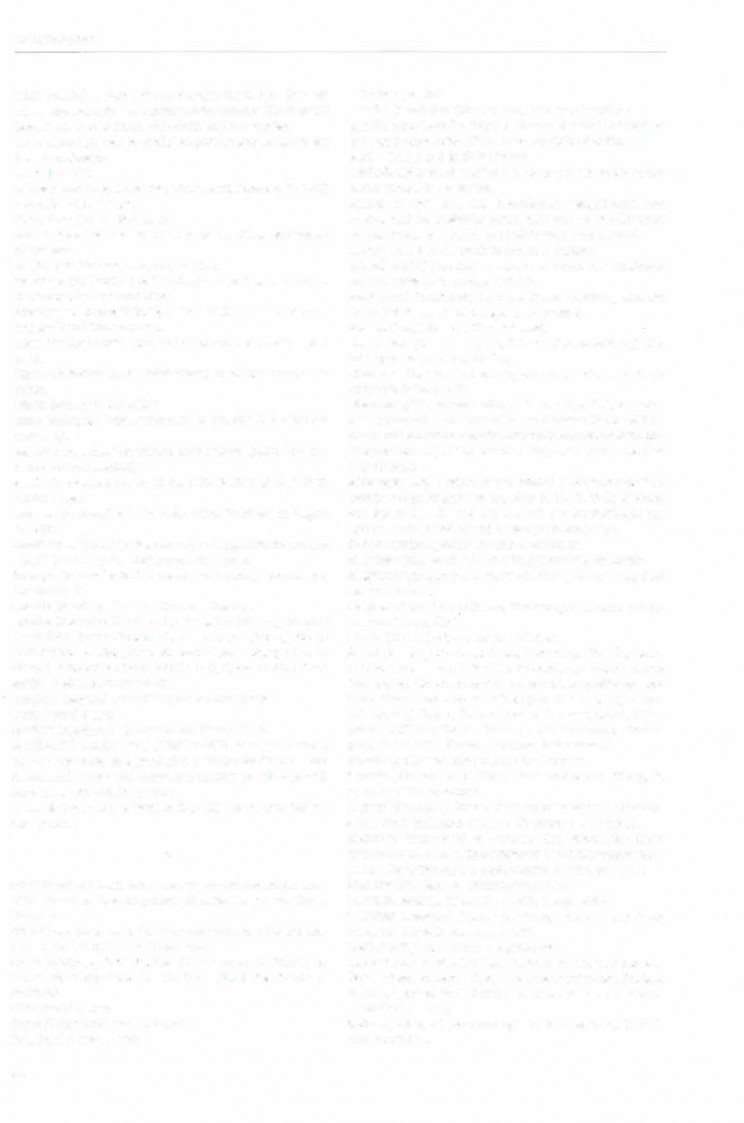
Sanskrit-Glossar
asvin [Ashvin] m durch Pferde charakterisiert, Bez. der vedi schen Zwillingsgötter, die später asvinTkumeirau (Hindi asvinT kumeir), die beiden Söhne der AsvinT, genannt wurden.
asvinT mudrä [Ashvini Mudra] f Anspannen und Loslassen der
Beckenmuskulatur.
asi [Asi] du bist.
asteya [Asteya] n Nichtstehlen, einer der fünf yama-s (YS 2.30).
asura [Asura] m Dämon.
äsura, äsuri[Asuri] dämonisch.
atharva-veda [Atharva Veda] m veda der Atharvan-Priester, vierter veda.
ati [Ati] Präf überaus, sehr, viel, zu (viel).
ati-prasna [Ati Prashna] m 'überfrage', zu weit gehende Frage zu transzendenten Wahrheiten.
atindriya, ati-indriya [Atindriya] über die Sinneswahrnehmung hinausgehend, Transzendenz.
ätma-nivedana [Atma Nivedana] n Hingabe des Selbst (an Gott o, ä.).
ätma-säksät-kära [Atma Sakshatkara] m Wahrnehmung des Selbst.
ätman [Atman] m das Selbst.
ätma-samarpa,:,a [Atmasamarpana] n Hingabe des Selbst (an Gott o. ä.).
avadhänin/avadhänT [Avadhani] aufmerksam (Apte: von ava dhäna, Aufmerksamkeit).
avadhüta [Avadhuta] meiner, der (alles Weltliche) abgeschüt
telt hat: Asket.
ävähana [Avahana] n Herbeirufen (einer Gottheit) zu Beginn der püjei.
avanti, avanti [Avanti]feine der sieben heiligen Städte Indiens: UjjayinT (heute: Ujjain, Madhyaprades); s. pura.
ävara,:,a [Avarana] n Be-/Verdecken, Verdeckung; 'Schleier der Unwissenheit'.
avasthä [Avastha] f Zustand, Situation, Stadium.
avatära [Avatar] m Herabkunft, Inkarnation {Gottes); die zehn klassischen Inkarnationen Vi$r:,u-s: Matsya {Fisch), Kürma (Schildkröte), Vareiha (Eber), Narasirr,ha (Mannlöwe), Vämana (Zwerg), Parasuräma (Räma mit der Axt), Krsr:ia, Buddha, Kalki. avidyä [Avidya] f Unwissenheit.
avyaktam [avyakta] unmanifest; n das Unmanifeste.
ayam [Ayam] dieser.
ayodhyä [Ayodhya]fHauptstadt von Räma-s Reich.
äyudha-püjä [Ayudha Puja] f Waffen-püjä; Feier am neunten Tag von navarätra, an dem Waffen, wichtige Werkzeuge, usw. (heute auch Autos und Computer) zusammen mit SarasvatT, Lak$mT, PärvatT, verehrt werden.
äyurveda [Ayurveda] m 'Wissen über das Leben', traditionelle
ind. Medizin.
B
bäbä [Baba] m (Hindi) Vater; respekt- oder liebevolle Anrede. bäbü [Babu] m Respektsperson, höfliche Anrede für Vater; Beamter.
bädaräya,:,a [Badarayana] m Name des Verfassers der Brahma sütra-s, der mit Vyäsa identifiziert wird.
badari-näräya,:ia, badari-nätha [Badrinarayan, Badrinath] m Name eines Pilgerorts im Himälaya, Hindi Badrinäräyar:,, Badrinäth.
bähu [Bahu] m Arm.
bähya [Bahya] äußerlich, außerhalb.
bala [Bala] n Stärke, Kraft.
234
asvin
bäla [Bala] m Kind.
bandha [Bandha] m (Ver-)bindung, im yoga: Verschluss. bandha-traya [Bandha Traya] n 'Gruppe der drei Verschlüsse' bei prä,:iäyäma: müla-, jälandhara-, uc;ic;JTyeina-bandha.
baniyä [Bania] m (Hindi) Kaufmann.
bärike-bihärT[Bankebehari] m Bez. Kr$r:ia-s in einem der belieb testen Tempel in Vrndävana.
banyan m engl. Bez. des bengalischen Feigenbaums (von
baniyei, weil die Engländer sahen, dass sich oft Händler unter solchen Bäumen aufhielten); Sanskrit vata, Hindi bargad. baroda engl. Bez. der Stadt Va<;!odarä in Gujarät.
bäska/i, väskali [Bashkali] m Name des Autors der Välakhilya
sarnhitä (Bhägavata-purär:,a 12.6.59).
basti [Basti] f Abdomen; im yoga: Enddarmspülung, eine der sechs (Reinigungs-) Handlungen (sat-karma-s).
Benares f engl. Bez. der Stadt Värär:,asT.
bhadräsana [Bhadrasana] n 'glückverheißende Haltung', Sitz haltung im yoga (Schmetterling).
bhagavad [Bhagavad] ehrwürdig, verehrungswürdig, steht für
bhagavein in Komposita.
bhagavad-gTtä [Bhagavad-Gita]f 'die vom Ehrwürdigen gesun gene (upanisad, s. Abschlusszeilen der einelnen Kapitel: iti bha gavad-gTtä süpanisatsu brahmavidyäyeirr, yogaseistre srTkrsr:iar Junasarr,vade ... )' Dialog zwischen Kr$r:ia und Arjuna aus dem Mahäbhärata.
bhägavata, bhägavatam [Bhagavata/m] n Bhägavata-purär:,a,
wichtiger Vi$r:,uitischer Text aus dem 9./10. Jh. in 12 Kapiteln, von denen das 10. und das 11. mit der Beschreibung von Kr$r:ia-s Kindheit und Jugend besonders bekannt sind. bhagavatar [Bhagavatar] m südind. Ehrentitel.
bhagavati [Bhagavati] f die Verehrungswürdige, die Göttin.
bhqgiratha [Bhagiratha] m mythischer König, der die Garigä auf die Erde brachte.
bhajana [Bhajan] n (Zu-)teilen, Verehrung, in neuind. Sprach en: devotionales Lied.
bhakta [Bhakta] m Verehrer (z. B. Gottes).
bhakti [Bhakti] f Zuteilung, Anteil, Verehrung, Hingabe; neun fach nach Bhägavata-purär:,a 7.5.23: srava,:iarr, kTrtanarr, visr:iof:i
'smara,:iarr, pädasevanarr, I arcanarr, vandanarr, deisyarr, 'sak hyam eitma-nivedanam 11 Hören (von Geschichten), Preisen
(mit Liedern) Vi$DU-s, Erinnern (seines Namens), seinen Füßen (seiner bildlichen Form) dienen, rituelle Verehrung, Verbeu gung, Haltung des Dieners, Freundes, Selbsthingabe.
bhakti-yoga [Bhakti Yoga] m yoga der Hingabe.
bharata [Bharata] m 1. Name eines mythischen Königs, 2. Name von Räma-s Bruder.
bhärata [Bharata] zu Bharata gehörig; m Nachkomme Bharata
s, Bewohner Indiens; n das Land Bharata-s; heute: Indien. bhartrhari [Bhartrihari] m Verfasser des VäkyapadTya (über Grammatik, ca. 5. Jh. n. Chr.); Verfasser des Sataka-trayam (über Liebe, Lebensführung und Leidenschaftslosigkeit, ca. 7. Jh.). bhäskara [Bhaskara] m Lichtmacher, Sonne.
bhasman, bhasma [Bhasma] n Asche, heilige Asche.
bhastrikä [Bhastrika] f eine Atemübung, die u. a. zur Erwe ckung der Kur:,<;!alinT angewandt wird.
bhäti [Bhati] f Licht, Glanz, s. kapei/a-bheiti.
bhäva [Bhava] m Werden, Sein, Zustand, Gefühl; fünf bheiva-s: seinta, deisya, sakhya, veitsalya, madhura (friedvolles/ruhiges Gefühl gegenüber Gott, Gefühl sein Diener, Freund, seine Mut ter, Geliebte zu sein).
bhävana, bhävanä [Bhavana] n/f das Manifestieren, Vorstel lung, Meditation.
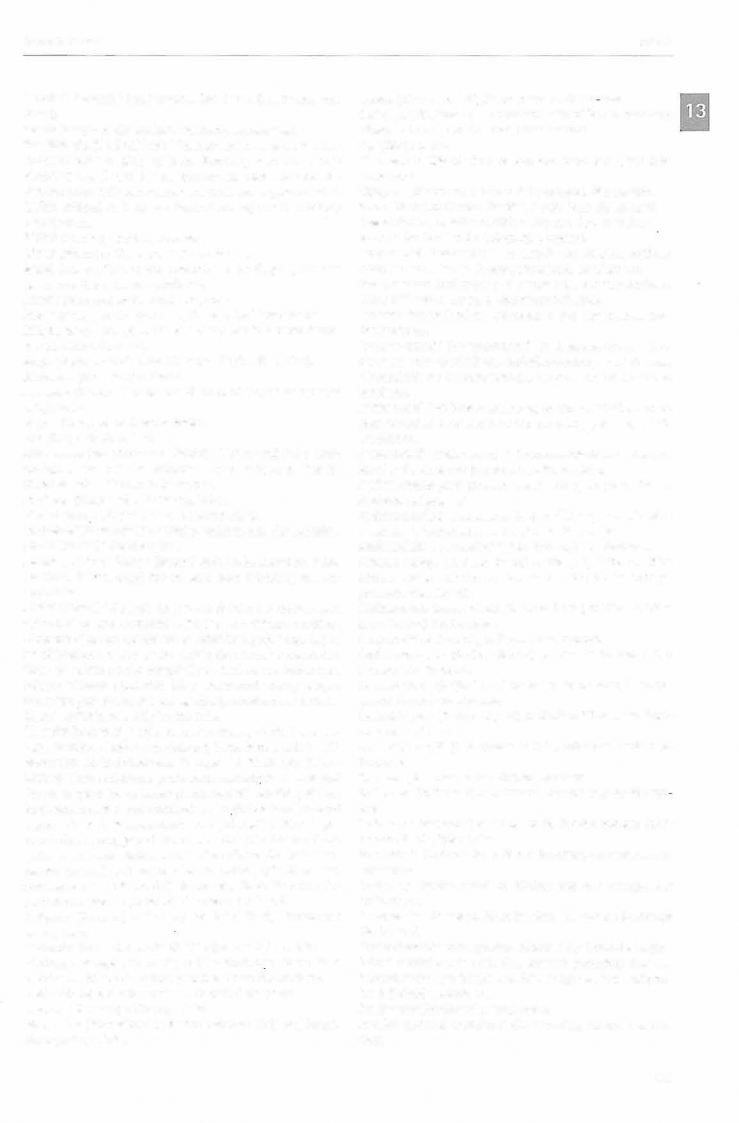
Sanskrit-Glossar
bhavänT [Bhavani] f Bez. PärvatT-s, Siva-s Frau (von Bhava, Bez. Siva-s).
bheda [Bheda] m das Spalten, Trennung, Unterschied. bhedäbheda, bheda-abheda [Bhedabheda] m Unterschied und Nichtunterschied: philosophische Richtung, vertreten durch Nimbärka (13. Jh.), in der das individuelle Selbst als verschie den und auch nicht verschieden von Brahman angesehen wird. bhikku [Bhikku] m (Pali; von Sanskrit bhik$u) (buddhistischer) Bettelmönch.
bhik$ä [Bhiksha] f Betteln, Almosen.
bhima [Bhima] m Name von Arjuna-s Bruder.
bhir:u;fi [Bhindi] f (Hindi) Gemüsesorte: 'lady's fingers', Hibiscus esculentus (Okra, Malvengewächse).
bhT$f!1G [Bhishma] m Großonkel Arjuna-s.
bhoga [Bhoga] m das Genießen, Essen, (sinnlicher) Genuss. bhogin, bhogT [Bhogi] m charakterisiert durch Genuss: Genie ßer (sinnlicher Freuden).
bhoja [Bhoja] m berühmter König (ca. 10./11. Jh. n. Chr.).
bhramara [Bhramara] m Biene.
bhrämari [Bhramari] m der zur Biene gehörige; einer der acht
prä(läyäma-s.
bhrgu [Bhrigu] m mythischer Weiser.
bhü [Bhu] f die Erde, Land.
bhü-cara-siddhi [Bhuchara Siddhi] f 'übernatürliche Kraft bezüglich der auf der Erde/dem Land gehenden (Tiere)', Fähigkeit, wilde Tiere zu beherrschen.
bhujanga [Bhujanga] m Schlange, Kobra.
bhujangäsana [Bhujangasana] n Kobrastellung. bhujanginf[Bhujangini]f weibliche Schlange, Bez. der Kuo<;lalinT. bhukti [Bhukti]f das Genießen.
bhüman, bhümä, bhüma [Bhuma] min große Quantität, Fülle, die Erde, Gebiet, Geschöpf; im yoga auch Erfahrung des Un endlichen.
bhümi [Bhumi]f die Erde, Ebene; die Ebenen des Geistes nach Vyäsa-bhä$ya und Väcaspati Misra (YS 1.1): k$iptarn mügharn vik$iptam ekägrarn niruddham iti cittabhümayah. Bdtg.: k$ipta instabil/geworfen (von einem Objekt zum anderen durch Ein fluss von rajas); mügha dumpf (durch Einfluss von tamas bzw. Schlaf); vik$ipta abgelenkt (aber manchmal stabil); ekägra fokussiert (auf eine Sache ausgerichtet); niruddha verhindert. bhümi-devT[Bhumi Devi] f Göttin Erde.
bhümikä [Bhumika] f Erde, Platz, Stockwerk, Stufe, Grad; sie ben bhümikä-s: subhecchä, vicära(lä, tanumänasä, sattväpatti, asarnsakti, padärthäbhävanT, turyagä (YV 3.118.5,6): jnäna bhümih subhecchäkhyä prathamäsamudährtä / vicära(lä dvitTyä tu trtTyä tanumänasä II sattväpattis caturthT syät tato 'sarnsaktinämikä / padärthäbhävanT $OsthT saptamT turyagä smrtä. 'Die erste Wissensebene wird glückhafter Wunsch ge nannt, Überlegung jedoch die zweite, die dritte (Zustand) des geringen Denkens, Gelangen zu sattva dürfte die vierte sein, danach (kommt die) namens Nichtanhaften, (die Stufe der) Abwesenheit von Dingen (ist) die sechste, die siebte wird erin nert als zum vierten (Bewusstseinszustand) gehend.'
bhü-pura [Bhupura] n Festung der Erde, Stadt, Umrandung eines yantra.
bhür-loka [Bhur Lokal m die Welt/Region der Erde, s. loka. bhusu,:u;Ja, busu,:,gi [Bhusunda] m Käka Bhusuoda, Name eines mythischen Weisen in Krähengestalt aus dem Yogaväsi$tha. bhüta [Bhuta] n das Gewordene, Geschöpf, Gespenst. bhuvana [Bhuvana] n Ebene; s. loka.
bhuvar-loka [Bhuvarloka] m Region zwischen Erde und Sonne, Atmosphäre, s. /oka.
buddha
bhuvas [Bhuvas] m Luft, Atmosphäre, s. bhuvar loka. bibhT$G(la [Bibhishana] erschreckend, schrecklich; m Name von Rävaoa-s Bruder, der Verehrer Räma-s wurde.
bTja [Bija] n Same.
bTja-mantra [Bija Mantra] m Samen-mantra, aus einer Silbe bestehend.
bTjäk$ara [Bijakshara] n Samen-Silbe (ak$ara), bija-mantra. bindu [Bindu] m Tropfen, Partikel, Punkt; Form der cit-sakti. bodha [Bodha] m Wissen, Wahrnehmung, Idee, Erwachen. brahmä [Brahma] m Schöpfergott, s. trimürti.
brahma-cärT [Brahmachari] m (Hindi; von Sanskrit brahma cärin) jemand, der ein Keuschheitsgelübde abgelegt hat. brahma-carya [Brahmacharya] n Verhalten, das zum brahman führt; zölibatäres Leben, s. var(läsrama-dharma.
brahma-cintana [Brahma Chintana] n das Nachdenken über das brahman.
brahma-granthi [Brahmagranthi] m brahman-Knoten (Blo ckade im oder oberhalb des mülädhära-cakra); steht für mala (Unreinheit) und die Schwierigkeit, die physische Welt zu trans zendieren.
brahma-muhürta [Brahmamuhurta] m Moment/Zeit des brah man (zwischen 3.30 und 5.30 Uhr morgens), gut geeignet für Meditation.
brahma-näg, [Brahmanadi] f brahman-Ader/Kanal: Energie kanal in der SU$Umnä (feinstoffliche Wirbelsäule).
brahma-ni?tha-guru [Brahma Nishta Guru] m guru, der im
brahman gefestigt ist.
brahma-randhra [Brahmarandhra] n Öffnung am höchsten Punkt der Schädeldecke, im Bereich der Fontanelle.
brahma-sakti [Brahmashakti] f Kraft/Energie des brahman. brähma samäja [Brahma Samaj] m (Bengali) 1828 von Räm Mohan Roy in Calcutta zur Erneuerung des Hinduismus ge gründete Gesellschaft.
brahma-srotr, brahma-srotä [Brahma Shrotri] m Hörer, Schüler (auch Lehrer) des brahman.
brahma-vid [Brahmavid] m Kenner des brahman.
brahma-vid-vara [Brahmavidvara] m der beste unter den Kennern des brahman.
brahma-vid-varTya [Brahmavidvariya] m ein besserer, hervorra gender Kenner des brahman.
brahmäbhyäsa [Brahmabhyasa] m Studium/Übung, um brah man zu erreichen.
brahmäkära-vrtti [Brahmakara Vritti] f ständiges Denken an
brahman.
brahman [Brahman] n das Höchste, Absolute.
brähma,:,a [Brahmana] m Brahmane, Angehöriger der Priester kaste.
brähma,:,a [Brahmana] n Teil des veda, der sich mit den Erklä rungen für die Opfer befasst.
brahmä,:,r;Ja [Brahmanda] n Ei des brahman, Universum, Ma krokosmos.
brahmar?i [Brahmarishi] m Weiser aus der Gruppe der Brahmanen.
brahmin eine der westl. Schreibweisen des Wortes brähma(la
(Brahmane).
Brahmoismus Anschauung der Anhänger des brähma samäja. brinja/ möglicherweise aus dem Sanskrit (bha(ltäkD über das Portugiesische entwickelte Bez. für Aubergine, Hindi bairigan. brrrh [Brimh] anwachsen.
brndä-vana [Brindavan] s. vrndä-vana.
buddha [Buddha] erwacht; m der Erwachte, Buddha (ca. 5 Jh. Chr.).
235
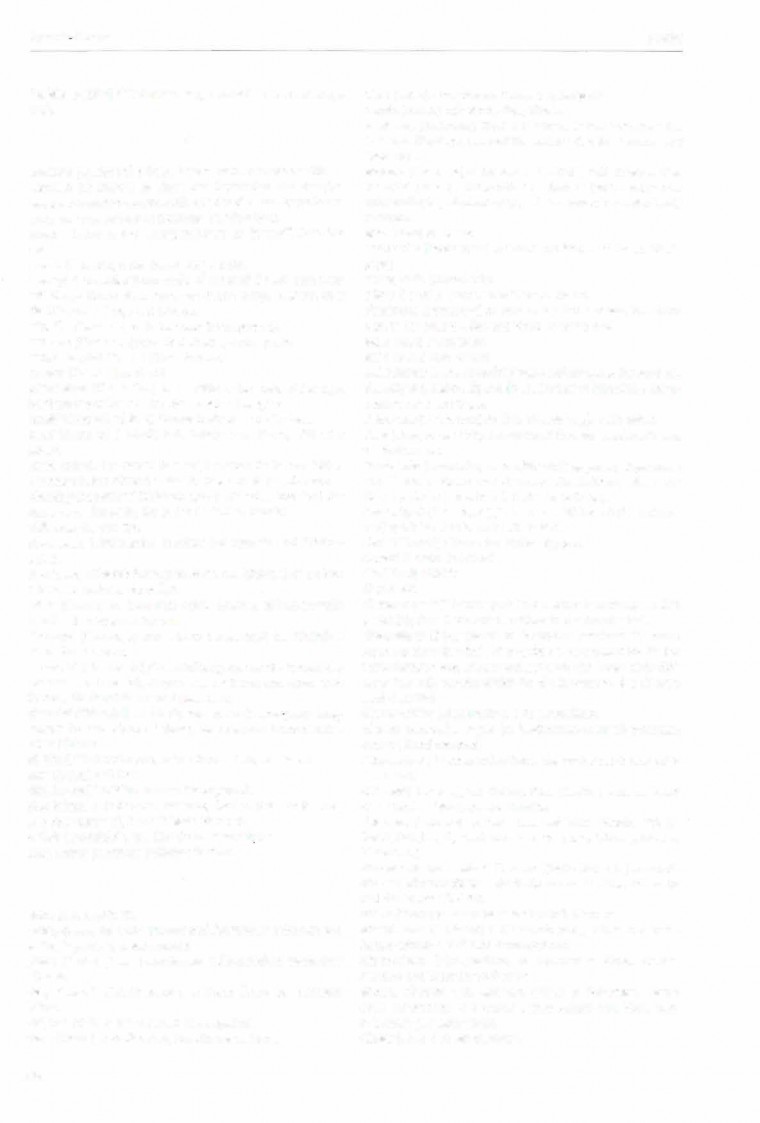
Sanskrit Glossar
buddhi [Buddhi] f Wahrnehmung, Intellekt, Unterscheidungs kraft.
C
caitanya [Chaitanya] n Geist, Bewusstsein, höchste Realität. Caitanya [Chaitanya] m Name des Begründers der Gauc;JTya Vai$r:iava-Tradition(1486-1533), aus der die Hare-Kr$r:ia-Bewe gung hervorgegangen ist(Caitanya Mahäprabhu).
cakra [Chakra] n Rad, Energiezentrum im feinstofflichen Kör per.
cak$US [Chakshu] n das Sehen, Auge, Sicht.
cämur_l(;iä, cämur:l(;it (Chamunda, Chamundi] f nach dem DevT mähätmya Name einer Form von Göttin Durgä, Siegerin über die Dämonen Car:ic;Ja und Mur:ic;Ja.
cä,:,r;läla [Chandala] m Kastenloser(Schimpfwort). candana [Chandana] n/m Sandelbaum, -holz, -paste. ca,:,r;JT, ca,:,r;likä [Chandi] f Bez. Durgä-s.
candra [Chandra] m Mond.
cäriga-deva [Chang Dev] m in Mittelindien bzw. Mahärä$tra berühmter yogT(ca.13. Jh.), Aussprache: Tsangdev. capätT [Chapati] f(Hindi) dünner Brotfladen aus Weizen.
catnT [Chutney] f {Hindi) ind. Beilage zum Essen, süß oder scharf.
charu südind. Gericht aus Reis, ghT, braunem Zucker und Milch. catu$taya [Chatushtaya] n eine Gruppe von vier, s. sadhona.. chändogya-upani$ad [Chhandogya-upanishad] f upani$ad des Säma-veda, des veda, der in den Melodien besteht.
chilli scharfes Gewürz.
cid-änanda [Chidananda] m reines Bewusstsein und Glückse ligkeit.
cid-ätman, cid-ätmä [Chidatma] m das aus Wahrnehmung bzw.
Intelligenz bestehende Selbst.
cikkü [Chikku] m {MaräthT) süße, braune, pflaumengroße Frucht mit schwarzen Kernen.
cin-maya [Chinmaya] aus reinem Bewusstsein bestehend; n
reines Bewusstsein.
cin-mudrä [Chinmudra] f Handhaltung, bei der die Spitzen des Daumens und des Zeigefingers sich berühren und einen Kreis formen, die Handfläche weist nach vorn.
ciran-jTvT [Chiranjivi] m (Hindi; von Sanskrit ciran }Tvin) lang lebiger (in den Mythen Wesen, die mehrere tausend Jahre leben können).
cit [Chit] f Wahrnehmung, reines Bewusstsein, brahman.
citra [Chitra] hell, klar.
citrä [Chitra] f när;li' im Inneren der SU$Umnä.
citta [Chitta] n Gedachtes, Gedanke, Denken(inkl. Gedächtnis, Unterbewusstsein), Denkfähigkeit, Vernunft.
cür;lälä [Chudala]fweise Königin im Yogaväsistha.
curry kräftig gewürztes indisches Gericht.
D
daiva [Daiva] göttlich.
daivT $Gt-sampad [Daivi Shatsampat] f göttlicher Reichtum von sechs(Tugenden), s. $Gt-sampad.
r;läkinT [Dakini] f im Buddhismus: halbgöttlicher, weiblicher Hilfsgeist.
dak$i,:,ä-mürti [Dakshinamurti] m Form Siva-s als höchster Lehrer.
däl [Dal] f(Hindi) Hülsenfrucht, Linsengericht.
dama [Dama] m Bezähmung, Selbstbeherrschung.
236
buddhi
däna [Dana] n das Geben, Gabe, Freigiebigkeit.
da,:,r;Ja [Danda] m/n Stock, Stab, Strafe.
darjee/ing [Darjeeling] Stadt und Distrikt in den Vorbergen des östlichen Himälaya, bekannt für mildes Klima im Sommer und Teeanbau.
darsana [Darshana] n das Sehen, die Sicht, Anblick(eines Got tes oder guru-s), philosophisches System (sechs darsano-s: nyayavaise$ika, somkhya-yoga, pürva- und uttara-mTmämsa/ vedanta).
däsa [Dasa] m Diener.
dasa-ratha [Dasharatha] m Name von Räma-s Vater(s. Rämä yar:ia).
dasan, dasa [Dasha] zehn.
däsya [Dasya] n Status eines Dieners, Dienst.
dattätreya [Dattatreya] m Name eines ind. Weisen, ind. Gott heit, in der Brahmä, Siva und Vi$(1U vereinigt sind.
dayä [Daya]fMitgefühl.
deha [Deha] min Körper.
deha-suddhi [Deha Shuddhi] f Reinheit/Reinigung des Körpers. dehädhyäsa, deha-adhyäsa [Dehadhyasa] m fälschliche Identi fikation mit dem Körper.
dehrä-dün [Dehra Dun] Stadt in Uttaräkhar:ic;J, nahe �$ikes.
deva [Deva] m ein Gott, eine Gottheit(von div 'leuchten'); Bez. für Brahmanen.
deva-datta [Devadatta] m von/für Gott gegeben, Eigenname
wie Theodor, Name von Arjuna-s Muschelhorn; einer der Neben-prä,:ia-s(verantwortlich für das Gähnen).
deva-nägarT [Devanagari] f die zu den Göttern(evtl. Brahma nen) gehörige städtische Schrift(= lipi). devakT[Devaki] f Name der Mutter Kr$r:ia-s.
devatä [Devata] fGottheit.
devT [Devi] fGöttin.
dhal s. da/.
dhamma-pada [Dhammapada] n Bez. einer Sammlung von 432 buddhistischen Denkversen, verfasst in der Sprache Pali. dhananjaya [Dhananjaya] m 'Reichtum gewinnend', Name Arjuna-s; einer der fünf Neben-pra,:io-s, verantwortlich für das Hervorbringen von Lauten; verlässt auch den Toten nicht(SSP 1.68; YCU 26), verantwortlich für die Zersetzung des Körpers nach dem Tod.
dhanur-äsana [Dhanurasana] n Bogenstellung.
dhanus [Dhanus] n Bogen (in bestimmten Lautverbindungen:
dhanur; Hindi dhanum).
dhanvantari [Dhanvantari] m Name des Arztes der Götter, gött licher Arzt.
dhära,:,ä [Dharana] f das Halten, Konzentration, sechstes Glied des achtgliedrigen yogo des Patanjali.
dharman [Dharma] m 'das, was feststeht', Gesetz, Pflicht, Recht, Religion, Eigenart; einer der vier puru$örtha-s(Ziele des Menschen).
dharma-megha-samädhi [Dharma Megha Samadhi] m sama dhi der dharma-Wolke: Meditationszustand ohne Wünsche und Gedanken (YS 4.29).
dhätu [Dhatu] m essentieller Bestandteil, Element.
dhauti, dhautT [Dhauti] f Magenreinigung, eines der sechs
karma-s/kriyä-s {HYP 2.23 karma$atkam).
dh_rta-rä$tra [Dhritarashtra] m mythischer König, Bruder Pär:ic;Ju-s und Vater Duryodhana-s.
dhruva [Dhruva] fest, gefestigt, sicher; m Polarstern, Name eines Königsohns, der wegen seiner Askese von Vi$(1U zum Polarstern gemacht wurde.
dhüpa [Dhupa] m Räucherwerk.
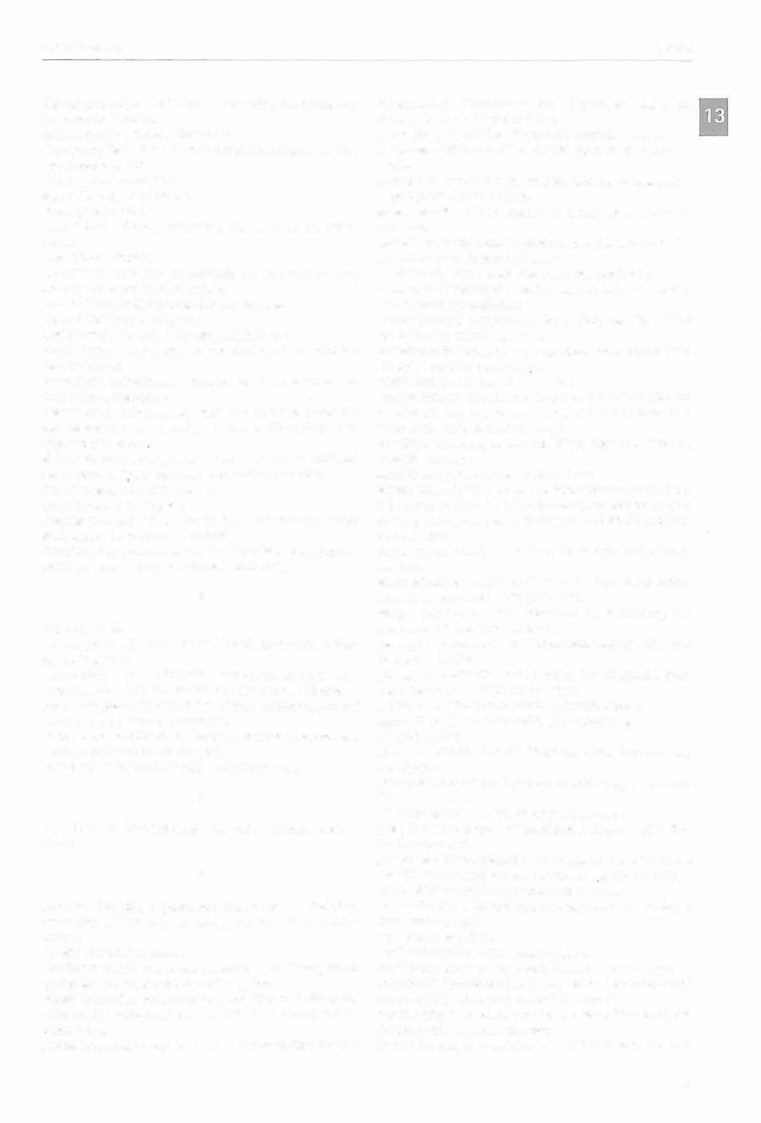
Sanskrit-Glossar
dhyäna [Dhyana] n Meditation, siebtes Glied des achtgliedri gen yoga des Pataiijali.
dTk$ä [Diksha] f Initiation, Einweihung.
dTk$ä-guru [Diksha Guru] m lnitiations-guru: Lehrer, der spiritu elle Einweihung gibt.
dTpa [Dipa] m Lampe, Licht.
dTpikä [Dipika] f Licht, Lampe.
dTrgha [Dirgha] lang.
dTväli [Divali] J (Hindi) Lichterreihe, Fest zu Ehren der Göttin Lak?mT.
divya [Divya] göttlich.
dO$G [Dosha] m Fehler; im äyurveda: die Konstitutionsarten, wenn in unausgeglichenem Zustand.
draupadT [Draupadi] f Ehefrau der fünf Pär:ic;fava-s.
dr<jhatä [Dridhata] J Festigkeit.
dr$ti [Drishti] J das Sehen, Sehfähigkeit, Sichtweise.
durgä [Durga] J Name einer der weiblichen Hauptgottheiten des Hinduismus.
duryodhana [Duryodhana] m ältester der 100 (manchmal auch
101) Söhne Dhrtarä?tra-s.
dussera (engl. Schreibweise) Hindi dasah(a)rä m letzter Tag von navarätra, einem neuntägigen Fest zu Ehren Durgä-s im September/-Oktober
dvä-dasäk$ara-mantra [Dvadashakshara Mantra] m zwölfsilbi ger mantra für Kr?r:ia: O((I namo bhagavate väsudeväya. dvaita [Dvaita] n Dualität, Dualismus.
dvära [Dvara] n Tor, Eingang.
dvärakä [Dvaraka] f Name der im Meer versunkenen Haupt stadt Kr?r:ia-s im Westen von Gujarät.
dvärakä-nätha [Dvarakanath] m Herr Dvärakä-s, Bez. Kr?r:ia-s.
dve$a [Dvesha] m Hass, Abneigung, Feindschaft.
E
eka, ek [Eka] eins.
ekädasT [Ekadashi] f elfter Tag des Mond-Halbmonats, Fasten tag der Vi?r:iuiten.
ekägra [Ekagra] 'dessen Spitze/Ziel eins ist', auf eine Sache aus gerichtet, fokussiert, eine der Ebenen des Geistes, s. bhiJmi. eka-agratä [Ekagrata] J 'Einzieligkeit' bzw. 'Einpünktigkeit', auf eine Sache gerichtete Konzentration.
ekäk$ara-mantra [Ekakshara Mantra] m einsilbiger mantra: O((I.
eko'ham [Ekoham] ich bin der eine.
ektärä [Ektar] m (Hindi) einsaitiges Zupfinstrument.
F
JaqTr [Fakir] m (Arabisch/Hindi) rel. Bettler (insbes. muslimi scher).
G
gajendra [Gajendra] m gaja-indra, lndra unter den Elefanten, großartiger Elefant (bes. derjenige, der von Vi?r:iu gerettet wurde).
gandha [Gandha] m Geruch.
gandharva [Gandharva] m eine Klasse von Halbgöttern, die als die Sänger und Musikanten der Götter gelten.
gändhT [Gandhi] m Mohandäs Karmcand GändhT (1869-1948), Politiker, der maßgeblich am Unabhängigkeitskampf Indiens beteiligt war.
ga,:,esa [Ganesha] m gaf)a-Tsa, hind. elefantenköpfiger Gott der
gorkhä
Gelehrsamkeit, Überwindung von Hindernissen, des guten Anfangs, Sohn von PärvatT und Siva.
garigä [Ganga] J der Fluss Ganges; die Göttin des Flusses. garigä-dhara [Gangadhara] m 'der die Garigä trägt', Name von von Siva.
garigotrT [Gangotri] J Ort im Himalaya nahe der Gangesquelle.
ga,:,ikä [Ganika] J Prostituierte.
garam masälä [Garam Masala] m (Hindi) scharfe Gewürz mischung.
garbhäsana [Garbhasana] n garbha-äsana; Stellung des Kindes (manchmal auch bä/äsana genannt).
gärgT [Gargi] f Name einer Weisen aus den upani$ad-s.
gärhasthya [Garhasthya] n viertes Lebenstadium: Haushalter tum, s. vamäsrama-dharma.
garu<ja [Garuda] m mythischer Vogel, König der Vögel, Feind
der Schlangen, Reittier des Vi?r:iu.
garu<jäsana [Garudasana] n garur;Ja-äsana, eine Yogastellung: der Adler, benannt nach Garuda.
gäthä [Gatha] J rel. Vers, Strophe, Lied.
gaur;Japädäcärya [Gaudapadacharya] m der Lehrer (äcärya) Gauc;fa-päda (zw. 6. u. 8. Jh. n. Chr.), wohl Lehrer Govinda-s, welcher als Lehrer Sarikaräcärya-s gilt.
gauräriga [Gauranga] m Bez. von Vi?r:iu, Kr?r:ia und Caitanya; Englisch Gouranga.
gaurT[Gauri] f Name PärvatT-s (Siva-s Frau).
gäyatrT [Gayatri] f Name eines vedischen Versmaßes mit 3 x 8 Silben; Bez. der Strophe tat savitur varef)yam, bhargo devasya dhimahi, dhiyo yo nah pracodayät (�g-veda 3.62.10) und ihrer Form als Göttin.
geruä [Gerua] (Hindi) ockerfarben, Ocker: Farbe von Asketen gewändern.
ghata [Ghata] m Topf; Zustand, wenn der Atem durch präf)ä yäma in die SU$Umnä eintritt (HYP 4.72).
ghatikä [Ghatika] f kleiner Wassertopf zur Berechnung und Bez. eines Zeitmaßes (ca. 24 Min.).
ghera,:,<ja [Gheranda] m hatha-yoga-Meister aus der Gherar:ic;Ja-sar]1hitä.
ghera,:,<ja-sa((lhitä [Gheranda Samhita] J grundlegendes Werk des hatha-yoga, ca. 1650-1700 verfasst.
ghT [Ghee] m (Hindi) Butterschmalz; Sanskrit ghrta n.
ghr,:,ä [Ghrina] J u. a. Widerwille, Ekel, Verachtung.
giri [Giri] m Berg.
giri-dhara [Giridhara] m der Träger des Berges (Govardhana), Bez. Kr?r:ia-s.
girTsa [Girish] m giri-isa, Herr des Berges/der Berge, Name von Siva.
gTta [Gita] gesungen, n das Gesungene, das Lied.
gitä [Gita] f 'die gesungene' (upani$ad, s. Bhagavad-gTtä), Bez. der Bhagavad-gTtä.
gttä-rahasya [Gita Rahasya] n 'Das Geheimnis der GTtä', Name des GTtä-Kommentars von Bäl Garigädhar Tilak (1856-1920). godävarT[Godavari] J Name eines südind. Flusses.
gokula [Gokula] n Rinderherde, Kuhstall; Name des Dorfes, in dem Kr?r:ia aufwuchs.
gopa [Gopa] m Kuhirte.
gopäla [Gopala] m Kuhirte; Name Kr?r:ia-s.
gopT[Gopi] f Kuhhirtin; Verehrerin Kr?r:ia-s in dessen Jugend gorakh-näth [Gorakhnath] m (Hindi) Name eines großen yogi aus ca. dem 11. Jh. n. Chr; Sanskrit Gorak?a-nätha.
gorak$a-sataka [Goraksha Shatakam] n Werk über yoga, das Gorak?a-nätha zugeschrieben wird.
gorkhii [Gurkha] m nepalische und nordind. Volksgruppe (von
237
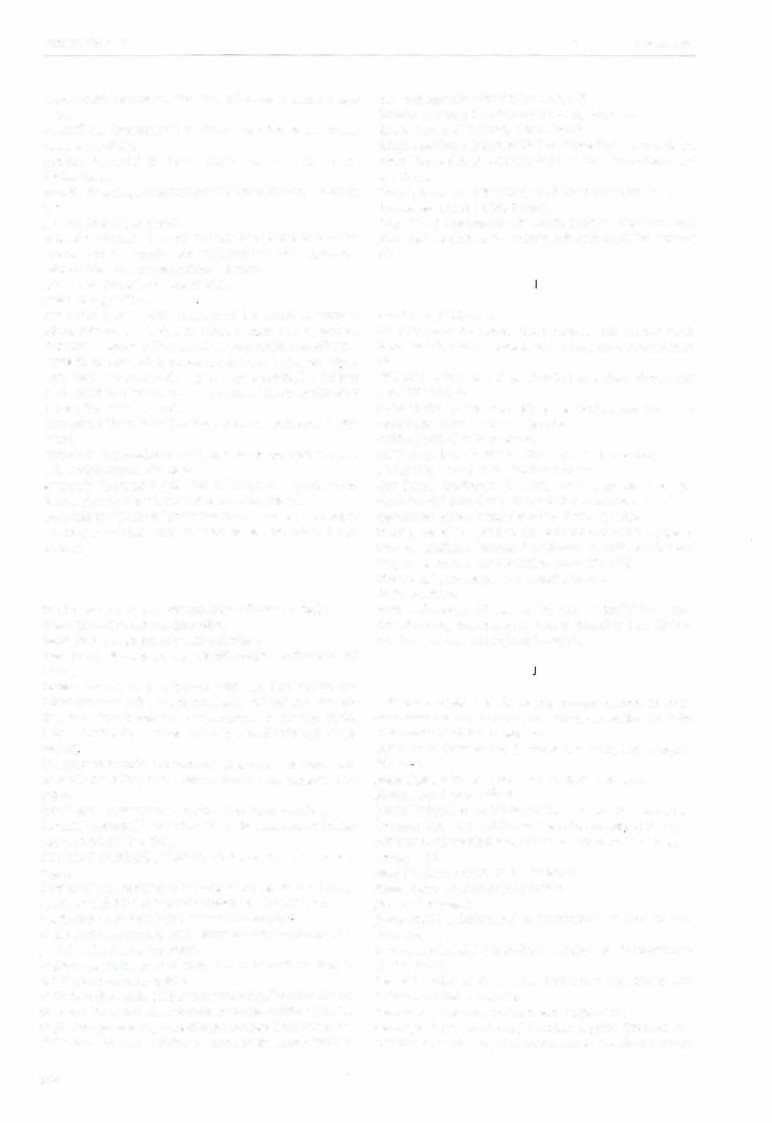
Sanskrit-Glossar
Gorakh-näth abgeleitet), von den Briten als Soldaten einge setzt.
govardhana [Govardhana] m Name eines Berges bei Vrndä
vana, s. Giri-dhara.
govinda [Govinda] m Name Kr?r:ia-s und des Lehrers von Salikaräcärya.
grantha [Grantha] m das Zusammenbinden; literarisches Werk, Buch.
granthi [Granthi] m Knoten.
grha-stha [Grihastha] m der im Haus befindliche, Haushalter, Mensch der im Berufs- und Familienleben steht; grha-stha
wird oft fälschlich für gärhasthya gebraucht.
guda, gudä [Guda] n/J Anus, Rectum.
guhä [Guha] f Höhle.
gur:ia [Guna] m Qualität, Eigenschaft der Natur: 1. sattva n (Güte, Reinheit > Leichtigkeit, Licht), 2. rajas n (Leidenschaft, Aktivität), 3. tamas n (Dunkelheit, Unwissenheit, Dumpfheit). gupta [Gupta] geschützt, versteckt, geheim; m Name von Visr:iu. guru [Guru] schwer(gewichtig); m Lehrer, spiritueller Führer; nach tantrischer Interpretation: gu Finsternis, ru entfernen > der die Finsternis entfernt).
guru nänak [Guru Nanak] m Begründer des Sikhismus (1469- 1539).
guru-deva [Gurudev] m der Gott, welcher der guru ist: Bez. und gelegentlich Anrede des guru.
guru-guha [Guruguha] f MuttusvämT DTk?itar-s 'Signatur' bzw.
Kennzeichnung in der letzten Strophe seiner Lieder.
guru-kula [Gurukula] n Familie des guru, in der auch auswärti ge Schüler wohnen und unterrichtet werden (altes Schul system).
H
ha [Ha] nach tantrischer Wortableitung: 'Sonne', s. hatha.
häkinT [Hakini] J sakti des iijnä-cakra.
halvä [Halva] m (Arabisch/Hindi) Süßspeise.
ha,n [Harn] bija-mantra des visuddha-cakra (verbunden mit Raum).
ha,nsa [Hamsa] m Gans/Ganter, wird seit dem Import von Schwänen nach Indien aus Großbritanien für 'Schwan' verwen det; Bez. einer Klasse von fortgeschrittenen Asketen; Seele, Selbst; Symbol für Brahman und den lebend Befreiten UTvan mukta)
hanumat (hanumän, hanumanta) [Hanuman] m Name des Generals der Affen, Helfer Räma-s bei der Zurückgewinnung STtä-s.
hara [Hara] wegnehmend, ergreifend; m Name von Siva. harappä [Harappa] Name einer Stadt der Indus-Kultur (Blüte zeit ca. 2600-2000 v. Chr.).
hari [Hari] grün(lich), gelb(lich), rötlich-braun; m Name von Vi?QU.
hariscandra [Harischandra] m Name eines mythischen Königs, sprichwörtlich für seine Wahrhaftigkeit und Freigiebigkeit. hasti-Jihvä [Hastijihva] feine der zehn Haupt-näc;IT s.
hatha [Hatha] m Gewalt, Kraft, Hartnäckigkeit; tantrische Inter
pretation: ha Sonne, tha Mond.
hatha-yoga [Hatha Yoga] m yoga, in dem besonderes Gewicht auf Körperbeherrschung liegt.
hatha(yoga)pradTpikä [Hatha Yoga Pradipika]j'Leuchte des ha tha-yoga' Hauptwerk des hatha-yoga von Svätmäräma (15. Jh.). hatha(yoga)pradTpikä-guru-paramparä-stotra [Hatha Yoga Pra dipika Guru Parampara Stotra] n Hymne an die Lehrer-Tradition
238
govardhana
der Hatha(yoga)pradTpikä (HYP 1.1,2,5-9).
havana [Havan] n Darbringung ins Feuer, Feueropfer.
hi,nsä [Himsa] f Verletzen, Töten, Zerstörung.
hirar:iya-garbha [Hiranyagarbha] m 'Schoß/Embryo von Gold', oder: 'etwas, dessen Ursprung Gold ist', Bez. für brahman und von Vi?r:iu.
homa [Homa] m Darbringung von Butterschmalz ins Feuer.
hrd, hrdaya [Hrid] n Herz, Denken.
hrT,n (Hrim] bija-mantra für Durgä, sonstige Göttinnen und Siva; nach Tanträloka 30: mantra, mit dem Kur:ic;lalinT erweckt wird.
icchä [lccha] fWunsch.
ic;lä [lda] feine der Haupt-nä(ii'-s, befindet sich auf der linken Seite der Wirbelsäule, steht in Verbindung mit der Mondener gie.
id/T[lddli] südind. Gericht: gedämpfte flache kleine Kuchen aus
urad däl und Reis.
indra [lndra] m im veda: König der Götter; am Ende von
Komposita: König, bester, s. gajendra.
indriya [lndriya] m Sinnesorgan.
Indus m lat. Bez. des Flusses Sindhu (heute in Pakistan).
Tsa [lsha] m Herr; Bez. des höchsten Gottes.
i$ta [lshta] erwünscht, begehrt, verehrt, geopfert; m der Verehrte; der Gott, den man persönlich besonders verehrt. i$ta-devatä [lshta Devata] f verehrte Gottheit, s. i$ta,
isvara [lshvara] m Herr; Bez. des höchsten Gottes, häufig Siva-s. Tsvara-prar:iidhäna [lshvara Pranidhana] n tiefe Meditation, Hingabe an Gott, einer der fünf niyama-s (YS 2.32).
Tsvarärpar:ia [lshvararpana] n Hingabe an Gott.
iti [lti] lndek/ so.
itihäsa, iti-ha-äsa [ltihasa] m 'so war es tatsächlich', Epos (Mahäbhärata, Rämäyar:ia); in neuind. Sprachen Bez. für 'Ge schichte' (im Sinn von Englisch 'history').
Ja(ja-bharata [Jadabharata] m 'der dumpfe/dumme Bharata', ein Weiser aus den Purär:ia-s, der sich dumm stellte, um nicht in die Welt verwickelt zu werden.
jagad-ambä [Jagadamba] f Mutter der Welt, Bez. Durgä-s, PärvatT s.
jagat [Jagat] n 'das sich Bewegende', Welt, Universum.
jägrat [Jagrat] wach seiend.
jaimini [Jaimini] m mythischer Weiser, der den Säma-veda ver breitete; Name des Begründers des pürva-mi'miimsii-Systems. Jainismus, Jinismus ind. Rel., in der absolute Gewaltlosigkeit ge predigt wird.
Jains (Englisch) Anhänger des Jainismus. Jaipur Name einer Stadt in Räjasthän. ja/a [Jala] n Wasser.
ja/a-stambha [Jalastambha] m Baumstamm auf dem Wasser:
'toter Mann'.
jälan-dhara-bandha [Jalandhara Bandha] m Kinnverschluss (HYP 3.70-76).
Janaka [Janaka] m Name eines mythischen ind. Königs und Heiligen, des Vaters von STtä.
janärdana [Janardana] m Name von Vi?r:iu/Kr?r:ia.
janmä$tamT [Janmashtami] f Kr?r:iajanmä?tamT, (Kr?r:ia-s) Ge burtstag am achten Tag des abnehmenden Mondes im Monat
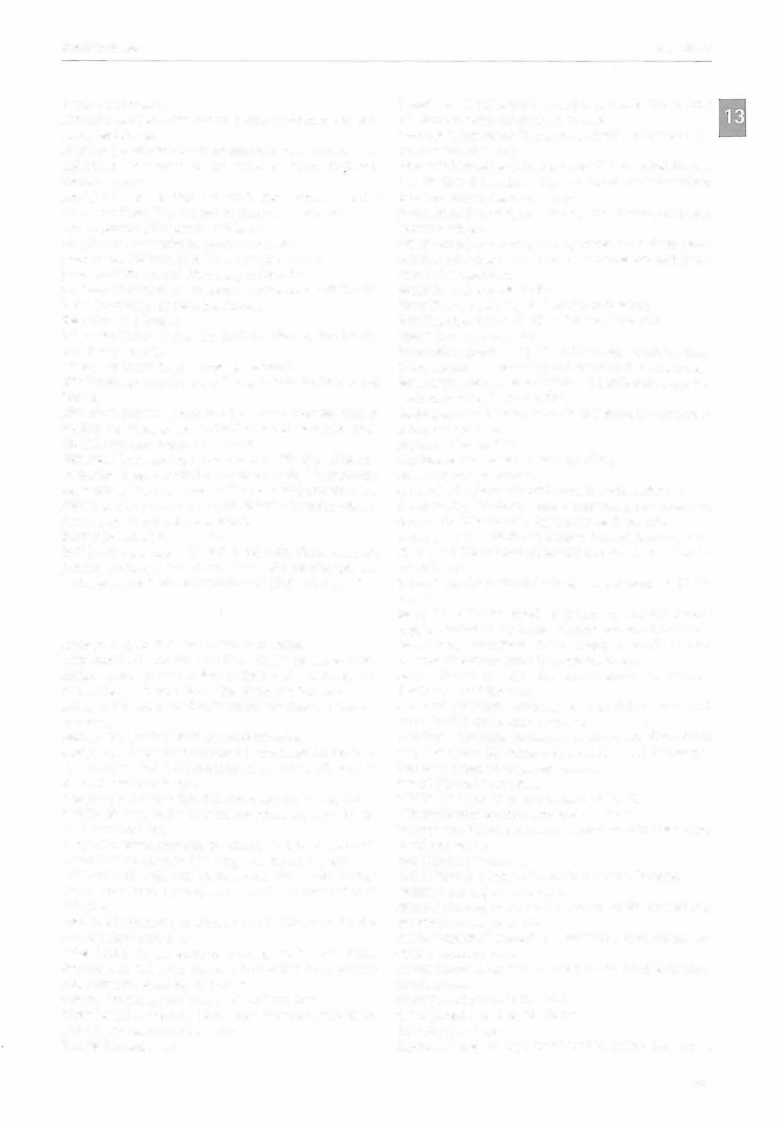
Sanskrit-Glossar
Srävar:ia (Juli-August).
jänu-sir$äsana [Janushirshasana] n Knie-Kopf-äsana, einbeini ge Vorwärtsbeuge.
japa [Japa] m Wiederholung von mantra-s, Namen Gottes usw. jatharägni [Jatharagni] m das Feuer im Bauch Uathara), Verdauungfeuer.
jaya [Jaya] siege, m Sieg, f in Hindi, dort verwendet in der Formel xxx kTjay, 'Sieg des xxx' im Sinn von 'es lebe xxx'. jayanti [Jayanti] f Geburtstag, Jubiläum.
jiva [Jiva] m Lebensprinzip, individuelle Seele.
jivan-mukta [JTvanmukta] m lebend Uivat) Befreiter.
jivan-mukti [JTvanmukti] f Befreiung zu Lebzeiten.
jivätman [Jivatman] m im Körper wohnendes individuelles Selbst (manchmal als Seele bezeichnet).
jnäna [Jnana] n Wissen.
jnäna-loka [Jnana Lokal m Ort, Welt des Wissens, eine der sie ben Ebenen, s. loka.
jnäna-yoga [Jnana Yoga] m yoga des Wissens.
jnänäbhyäsa [Jnana Abhyasa] m Übung des Wissens/Wissen und Übung.
jnänadeva, jnändev [Jnana Deva] m dessen Gott das Wissen ist/Gott des Wissens; Dichter/Heiliger aus Maharashtra (Ende
13. Jh.), wird auch Jnänesvar genannt.
jnänesvari [Jnaneshvari] f Bez. des von Jnänesvar (Jnändev) verfassten Bhagavad-gTtä-Kommentars; auch: 'Herrin/Göttin des Wissens', Name von SarasvatT und verwandter Göttinnen. jnänT[Jnani) m (Hindi; von Sanskritjnänin) Wissender, Weiser. jumna engl. Schreibweise von Jamnä.
jye$tha [Jyeshtha] ältest-, best-.
jyoti [Jyoti] n {Hindi; von Sanskritjyotis) Licht, Glanz, Helligkeit. Jyotsnä [Jyotsna] f 'Mondlicht', Name des Kommentars zur Hatha(yoga)pradTpikä von Brahmänanda (Ende 19. Jh.).
K
ka'ba [Kaaba} muslimisches Heiligtum in Mekka.
kabir [Kabir] m Name eines nordind. Heiligen (ca. 1398-1448). kailäsa, kailäsa [Kailash] m Berg in Tibet, heilig für Hindus und Buddhisten, mythische Wohnstätte Siva-s und Kubera-s. kaivalya [Kaivalya] n Isolation, Trennung von Geist und Materie, Befreiung.
käkini, käki{Ji [Kakini] f sakti des anähata-cakra.
kalä [Kala] f kleiner Teil einer Sache, sechzehnter Teil des Mon des; Kunst; in Hindi-Dichtung: Licht, Glanz, Schönheit; eine der sieben Zungen des Feuers.
käla [Kala] schwarz; m Zeit, Bez. Siva-s und des Todesgottes. kälätita [Kalatita] m der über die Zeit hinausgegangen ist, der sie überwunden hat.
kali [Kali] m Streit, schlechtester Wurf im Würfelspiel, schlech testes Zeitalter (yuga, in dem wir gerade leben), s. yuga.
käli [Kali) f die Schwarze (Göttin), nach dem DevTmähätmya Name einer Form Durgä-s; auch: weibliches Gegenstück zu Käla (Siva).
kalki [Kalki) m zehnte und letzte Inkarnation Vi�r:iu-s, soll in die
sem Zeitalter stattfinden.
kalpa [Kalpa] m ein Schöpfungszyklus, ein Tag des Gottes Brahmä (432 Milliarden Jahre); (rituelle) Vorschrift; Alterna tive, Methode, Vorschlag, Entschluss.
ka/panä [Kalpana] f das Formen, Vorstellung, Idee.
käma [Kama] m Wunsch, (sinnliche/s) Verlangen, Vergnügen, Liebe; Name des Gottes der Liebe.
kamala [Kamala] n Lotos.
käya-siddhi
kamaläsana [Kamalasana) n Lotos-Sitz; m 'dessen Sitz im Lotos ist', Name von dem Schöpfergott Brahmä.
kama{J<;Jalu, kama{J<;Jalü [Kamandalu) n/f Wassertopf von Aske ten (aus Ton oder Holz).
kämesvari [Kameshvari] f die erste der fünfzehn nityä-Gotthei ten, die über die fünfzehn Tage des Mondmonats herrschen; tantrische Göttin; Name von Durgä.
karnsa [Kamsa] m König und Dämon, Onkel Kr�r:ia-s, wurde von letzerem getötet.
kanda [Kanda] min Knolle, Knoten; Wurzel der meisten nä<;Ji-s
zwischen oder über Anus und Geschlechtsorganen, wird unter schiedlich angesiedelt.
käQ<;Ja [Kanda] m/n Teil, Kapitel.
känta [Kanta) begehrt, geliebt, schön; m Geliebter. känti [Kanti] m Schönheit, Glanz, Wunsch, Verlangen. kapäla [Kapala] min Schädel.
kapäla-bhäti [Kapalabhati] f 'Licht/Glanz des Schädels', Atem übung mit starker Ausatmung und automatischer Einatmung. käpä/ika [Kapalika] m einen Schädel als Bettelschale tragender sivaitischer Asket; Name von Siva.
kapha [Kapha] m Schleim; einer der drei do$a-s (Konstitutions arten) des äyurveda.
Kapillaren f Haargefäße.
kapotäsana [Kapotasana] n Taubenstellung.
kära{Ja [Karana] n Ursache.
kära{Ja-sarira [Karana Sharira] n Ursachen-/Kausalkörper. kärikä [Karika] fMerkverse bzw. Verssammlung zu Philosophie, Grammatik, Wissenschaft, des Öfteren als Kommentar.
karma [Karma] n {Hindi; von Sanskrit karman) Handlung; Aus führung rel. Riten; Schicksal (gemäß dem Gesetz von Ursache und Wirkung).
karma-käQ<;Ja [Karmakanda] min der Teil des veda, der Rituale betrifft.
karma-kä{Ji;/i [Karma Kandi] m {Hindi; von Sanskrit karma kä(l,;iin) Haushalter, der Rituale ausführt bzw. ausführen lässt. karmäsraya, karmäfoya [Karmashraya] m Behältnis oder Speicher für sancita-karma (angehäuftes karma).
karr:,a [Karna] m Held des Mahäbhärata, unerkannter Halbbruder der Pär:ic:Java-s.
karor-pati (Crorepati, Croropati) m Multimillionär von Hindi
karor, Englisch crore, Zahlwort für 'zehn Millionen'.
kärttikeya [Kartikeya, Kartikeyan] m Name von Siva-s Sohn, dem Heerführer der Götter, wird auch Skanda, Subrahmar:iya, Sara-var:ia-bhava, Murugan usw. genannt.
karu{Jä [Karuna] f Mitgefühl.
käsi [Kashi] f alter Name von Benares (Värä,:iasT).
käsmir [Kashmir] Staat im Nordwesten Indiens.
ka$ta-mauna [Kashtha Mauna] n 'schwieriges Schweigen' ohne Gestik und Mimik.
kathä [Kathal f Erzählung.
kathak [Kathak] (Hindi) m Name eines nordind. Tanzstils.
kaupina [Kaupina] n Lendenschurz.
kaurava [Kaurava] m von Kuru abstammend; die Gegenspieler der Pär:ic:Java-s im Mahäbhärata.
kau$itaki-upani$ad [Kaushitaki Upanishad] f upani$ad des �g
veda, s. upani$ad, veda.
kavaca [Kavacha] min Schutzpanzer; an eine Gottheit gerichte te Schutzhymne.
käveri [Kaveri] f Fluss in Südindien. kävya [Kavya] n Gedicht, Dichtkunst. käya [Kaya] m Körper.
käya-siddhi [Kayasiddhi] f Perfektion/Vollendung des Körpers
239 /
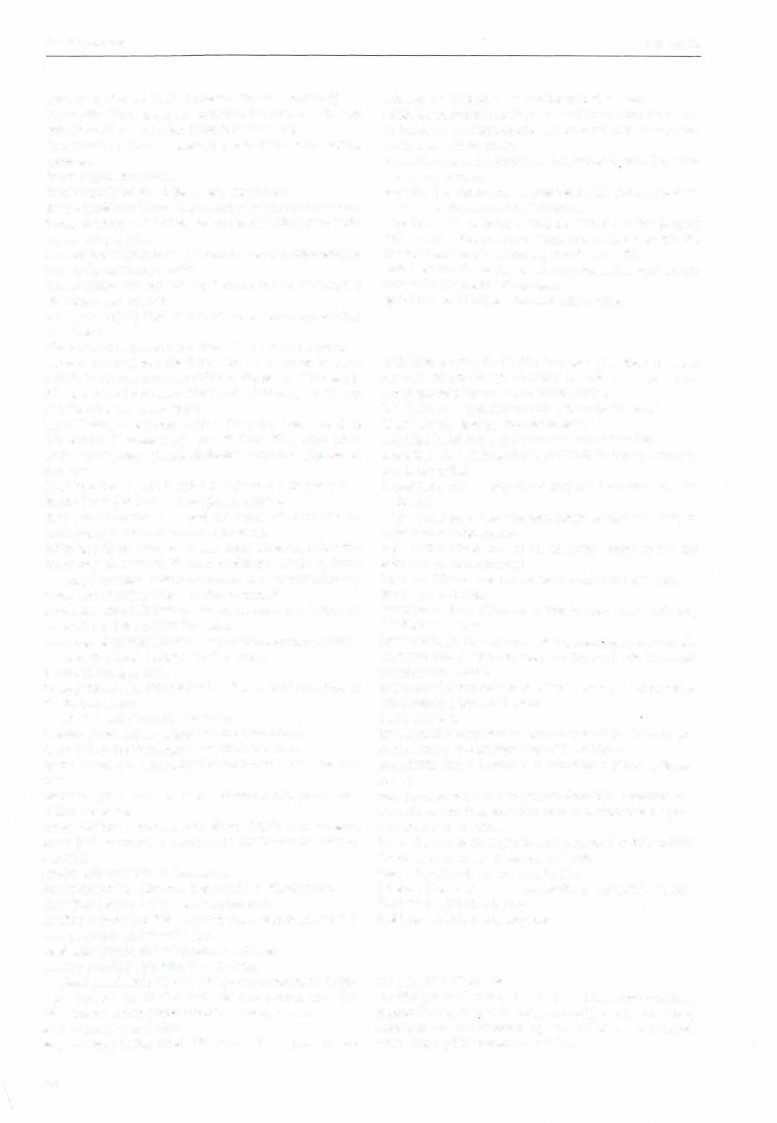
Sanskrit-Glossar
(Schönheit, Charme, Kraft, diamanthafte Dauerhaftigkeit). käya-vyüha (Kaya Vyuha] m 'Formation des Körpers', Fähigkeit, sich einen Körper zu bilden (ohne Wiedergeburt).
kena-upani$ad [Kena Upanishad] f zum Säma-veda gehörige
upani?ad.
kerala südind. Bundesstaat.
kevala [Kevala] allein, einfach, rein, ungemischt.
keva/a-kumbhaka [Kevala Kumbhaka] m reiner, einfacher kum bhaka: zwangloses Anhalten des Atems, der dabei fast vollstän dig zur Ruhe kommt.
kevalädvaita ([Kevala Adaita] Vedanta) n reiner advaita-vedänta,
Bez. für Salikaräcärya-s Lehre.
khecari-mudrä [Khecari Mudra] f mudrä, bei der die Zunge in die Kehle gegeben wird.
khicri [Khichdi) f (Hindi) Gericht aus einer Mischung von Reis
und Linsen.
kilaka [Kilaka] m Keil, Säule; n innere Silben eines mantra-s. kinnara [Kinnara) m schlechter oder deformierter Mensch; mythisches Wesen mit menschlichem Körper und Pferdekopf. kirtan(a) [Kirtan] n Preisen; Programm mit Gesang und Vorträ gen über Gott und seine Taten.
klesa [Klesha] m Schmerz, Leiden, Übel; fünf k/esa-s nach YS 2.3: avidyä {Unwissenheit), asmitä {Ichgefühl), räga {Wut, Leidenschaft), dve?a (Hass), abhinivesa (Anhaftung, insbes. an den Körper).
kosa, ko$a [Kosha] min Gefäß; i. d. Philosophie: {Körper-)Hülle.
krama [Krama] m Schritt, Vorangehen, Abfolge.
kriyä [Kriya] fAusführung, Handlung, Praxis, rel. Ritus usw.; im
hatha-yoga: Reinigungsübung, s. ?at-karma.
kriyä-yoga (Kriya Yoga] m YS 2.1: tapas (Askese), svädhyäya (Studium heiliger Texte), Tsvara-pra()idhäna (Hingabe an Gott); im kuQ<;ialini-yoga: Energietechniken, die Körperstellungen, Atem- und Visualisierungstechniken verbinden.
kriyamär:ia-karma [Kriyamana Karma) n karma, _das gerade er zeugt wird und die Zukunft beeinflusst.
krkara, krka/a [Krikara) meiner der fünf Neben-präQa-s, verant wortlich für Niesen, Hunger, Durst, s. prä()a.
krodha [Krodha) m Zorn.
k($/'JO (Krishna] machte Inkarnation Vi$t:JU-s, belehrte Arjuna in der Bhagavad-gTtä.
k$amä [kshama] fGeduld, Vergebung.
k$atriya [Kshatriya] m Angehöriger der Kriegerkaste.
k$aya [Kshaya] m Niedergang, Verschwinden, Ende.
k$etra [Kshetra) n Feld; in der Bhagavad-gTtä: Sphäre des Kör pers.
k$etra-jna [Kshetrajna] m in der Bhagavad-gTtä: Kenner des Feldes, das Selbst.
k$ipta [Kshipta] geworfen (von einem Objekt zum anderen durch Einfluss von rajas), instabil; eine der Ebenen des Geistes,
-
bhümi.
k$Udra [Kshudra) klein, unbedeutend.
k$udra-brahmär:i<;ia [Kshudra Brahmanda] n Mikrokosmos.
kuhü [Kuhu] feine der vierzehn Haupt-nä<;fT-s.
kumbha [Kumbha] m (Wasser-)topf; Name verschiedener Per sonen aus Epos und Yogaväsi$tt:ia.
kumbhaka [Kumbhaka] m Anhalten des Atems.
kur:i<;iala [Kundala] min Ring; Ohr-, Armring.
kur:i<;falini [Kundalini] f die durch Ringe charakterisierte, aufge rollte; Bez. für die kreative Kraft, die vom unteren Ende der Wirbelsäule bis zum brahma-randhra aufsteigen kann. kunjara [Kunjara) m Elefant.
kunjara-kriyä [Kunjara Kriya] f Reinigungsübung (der Übende
240
käya-vyüha
schluckt 1-2 Ltr. Salzwasser und übergibt sich dann).
kurikuma [Kumkum] n Safran; in Hindi auch: rotes Pulver aus Kurkuma, das bei Ritualen und zum Schmuck aufgetragen wird; symbolisiert oft die Göttin.
kürma [Kurma] m Schildkröte; 2. Inkarnation Visr:iu-s; Bez. eines
der Neben-prär:ia-s.
kuru [Kuru] m Name eines Landes nahe Delhi und von Königen, einer davon Stammvater der Kaurava-s.
kuru-k$etra [Kurukshetra] n 'Feld der Kurus', Ort der Schlacht zwischen den Kaurava-s und Pär:ic;lava-s, zu deren Beginn die Bhagavad-gTtä verkündet wurde; Distrikt bei Delhi.
kusa [Kusha] m Grassorte, die als heilig angesehen wird, als Un
terlage für Meditationssitz geeignet.
kutir [Kutir] m (Hindi; von Sanskrit kut,ra) Hütte.
L
/ahiri (syämäcara()} [Lahiri (Shyämacharan)] m Name des Leh rers von SrTyuktesvar {1828-1895), der wiederum der Lehrer von Yogänanda Paramaharnsa {1855-1936) war.
läkh [Lakh) m (Hindi) Zahlwort für 'einhunderttausend'.
läkini [Lakini] fsakti des maQipüra-cakra.
lak$mar:ia [Lakshmana] m Name eines der Brüder Räma-s. lak$mar:i jhülä [Lakshmanjhula] m (Hindi) 'Lak$mar:i-Schaukel', Brücke bei R$ikes.
lak$m'i [Lakshmi] f Name der Göttin des Reichtums und der Schönheit.
lak$YG [Lakshya] n 'das, was angesehen werden soll', Ziel; im
yoga: Konzentrationspunkt.
lalitä [Lalita] f tantrische Göttin {beliebte Hymne an sie: das
lalitä-sahasra-näma[stotra]).
lafTI [Lam) bija-mantra des mülädhära-cakra und der Erde.
/aya [Laya] m Auflösung.
laya-cintana [Laya Chintana] n Nachdenken über Auflösung (Meditationstechnik).
laya-yoga [Laya Yoga) m Form des kuQ<;ialinT yoga, bei dem alle Elemente bzw. Manifestationen von Energie in die Urenergie zurückgeführt werden.
likhita-japa [Likhita Japa] m 'geschriebener japa', Aufschreiben eines mantra-s (statt Aufsagen).
/i/ä [Lila) f Spiel.
liriga [Linga] n Kennzeichen, Symbol; männliches Sexualorgan, Symbol Siva-s; im säfTlkhya feinstofflicher Körper.
liriga-sarira [Linga Sharira] n feinstofflicher Körper (sük$ma sarira).
loka [Lokal m Welt; sieben Welten: bhür-loka, antarik$a-loka, svar-loka, mahar-loka, jana-/oka, tapo-/oka, satya-/oka (s. Vyäsa Kommentar zu YS 3.25).
loka-sarigraha, loka-safTlgraha [Loka Sangraha) m Schutz/Wohl
der Welt, (selbstloser) Dienst an der Welt.
lo/a [Lola] zitternd, rollend, instabil usw.
loläsana [Lolasana] n eine Yogastellung, 'Schaukel', gewisse Ähnlichkeit mit Krähestellung.
lotä [Lota] m (Hindi) Wassergefäß.
M
mä (Ma] f(Hindi) Mutter.
ma-kära [Makara] m der Laut M; die fünf M: madya (Alkohol), matsya (Fisch), mämsa {Fleisch), mudrä (gedörrtes Getreide), maithuna (Geschlechtsverkehr), die bei einem tantrischen Ritual (cakra-püjä) Verwendung finden.
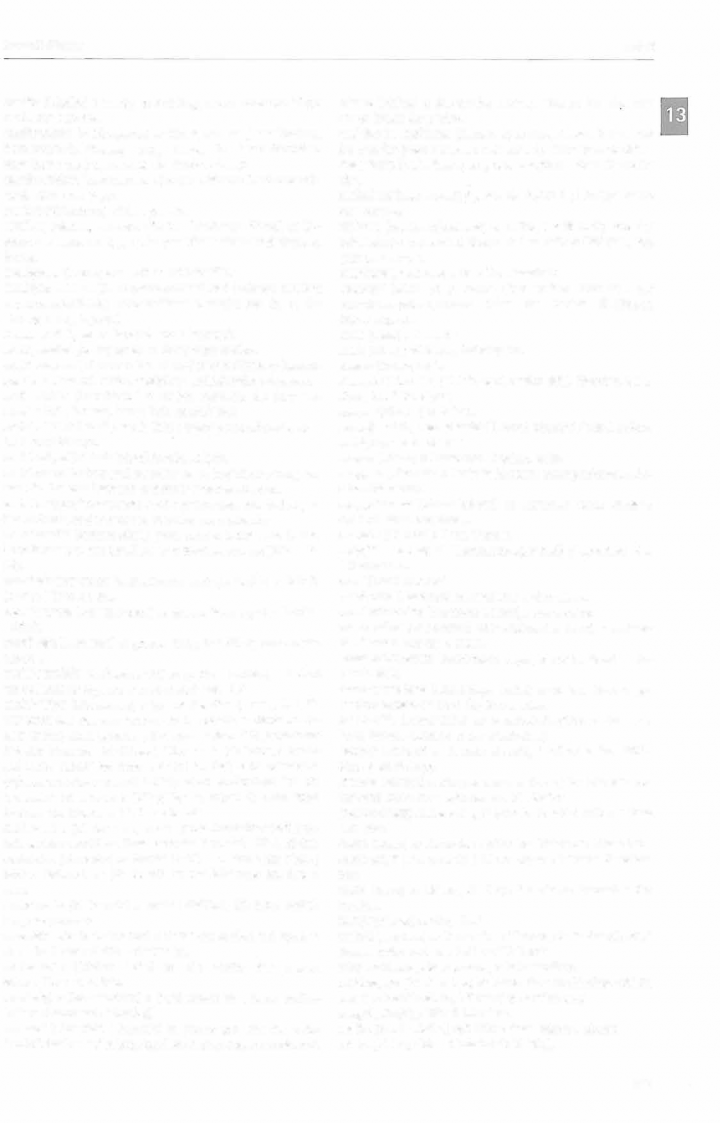
Sanskrit-Glossar
madhu [Madhu] n Honig; m Frühling; Name eines von Vi$t:1U getöteten Dämons.
madhu-parka [Madhuparka] m 'Honigmischung' aus Yoghurt, Butterschmalz, Wasser, Honig, Zucker, die einem Gast/Gott dargeboten wird; Zeremonie des Gastempfangs.
madhu-südana [Madhusudana] m (den Dämon) Madhu zerstö rend, Name von Vi$t:1U.
madhura [Madhura] süß, angenehm.
mädhurya-bhtiva, madhura-bhäva [Madhurya Bhava] m Zu stand der Liebe zu Kr$r:ia wie gegenüber einem Geliebten, s. bhäva.
madhyama [Madhyama] mittel, mittelmäßig. madhyamadhikäri [Madhyama Adhikari] m (Hindi; von Sanskrit madhyamädhikärin) mittelmäßiger Berechtigter (z. B. für Unterweisung in yoga).
madurai südindische Tempel- und Pilgerstadt.
mahä, mahat [Maha] groß; im Komposita: mahä-.
mahä-bandha [Mahabandha] m großer Verschluss: vollständi ger Verschluss mit mü/a-, w;Jr;Jiyäna- und jä/andhora-bandha. mahä-bhüta [Mahabhuta] n großes Element; die fünf Ele mente: Erde, Wasser, Feuer, Luft, Raum/Äther.
mahä-kä/i[Mahakali] f große KälT; Durgä-s personifizierter Zorn im DevTmähätmya.
mahä-lak$m'i [Mahalakshmi] f große Lak$mT.
mahä-meru [Mahameru] m großer Meru (mythischer Berg, um den die Planeten kreisen); dreidimensionales srT-cakra.
mahä-m[tyun-Jaya-mantra [Maha Mrityunjaya Mantra] m gro ßer todbesiegender mantra: tryambakaf!) yajämahe ...
mahä-mudrä [Mahamudra] f große mudrä, ähnlich der halben Vorwärtsbeuge, mit bandha-s und Wechselatmung (HYP 3.10- 18).
mahä-nirväf)a-tantra [Mahanirvana Tantra] n tantrische Schrift (zweite Hälfte 18. Jh.).
mahä-puru$a [Mahapurusha] m großer Mann, große Persön lichkeit.
mahä-räja [Maharaja] m großer König; ind. Fürst; respektvolle Anrede.
mahä-samädhi [Mahasamadhi] m großer samädhi, aus dem ein vollendeter yog1 nicht wiederkehrt, sein Tod.
mahä-väkya [Mahavakya] n 'großer Satz/Ausspruch', Bez. für vier Sätze aus den vier veda-s, die im advaita-vedänta beson ders wichtig sind: �g-veda (Aitareya-upani$ad 3.3) prajnänam brohma 'Brahman ist Wissen'; Säma-veda (Chändogya-upani
$ad 6.8.7, 6.16.6) tat tvam asi 'du bist das'; Sukla-yajur-veda (Brhadärar:i-yaka-upani$ad 1.4.10) aham brohmäsmi 'ich bin Brahman'; Atharva-veda {Mär:ic;lükya-upani$ad 2) ayam ätmä brohma 'das Brahman ist dieses Selbst'.
mahä-vedha [Mahavedha] m das große Durchdringen/Durch
bohren (eine mudrä zur Erweckung der Ku,:ic;lalinT, HYP 3. 25-31). mahä-vira [Mahavira] m 'Großer Held', u. a. Name des bislang letzten ti'rthati-karo (Furtbereiters) des Jainismus (ca. 500 v. Chr.).
mahä-vrata [Mahavrata] n großes Gelübde (YS 2.31: Einhal tung der yama-s)
mahäbhärota [Mahabharata] n Name des großen ind. Epos, in dem die Bhagavad-gTtä enthalten ist.
mahar-loka [Mahar Lokal m die vierte der sieben Welten/Ebenen, s. loka.
mahärä$tra [Maharashtra] n Bundesstaat im Westen Mittel indiens (Hauptstadt Mumbai).
mahar$i [Maharishi, Maharshi] m großer �$i; Titel für große Persönlichkeiten auf rel./spirituellem Gebiet; Englisch maharishi.
mäträ
mahat [Mahat] n das Große; höchstes Wesen; im sämkhya:
erstes Evolut der prokrti.
mahätman, mahätmä [Mahatma] m einer, dessen Selbst groß ist: Bez. für große Persönlichkeit auf rel./spirituellem Gebiet. mahesvara [Maheshvara] m großer Herr/Gott; häufig Name für Siva.
mahesvari [Maheshvari] f große Herrin/Göttin; häufiger Name von Durgä-s.
mahima [mahiman/mahimä] m Größe, Herrlichkeit; eine der acht siddhi-s (a$tasiddhi, übernatürliche Kräfte): Fähigkeit, sich groß zu machen.
maithuna [Maithuna] n Geschlechtsverkehr.
maitreyi [Maitreyi] f Name einer weisen Frau aus der Brhadärar:i-yaka-upani$ad (eine der beiden Ehefrauen Yäjnavalkya-s).
mala [Mala] n Schmutz.
mälä [Mala] f Girlande, Gebetskette.
mama [Mama] mein.
mamatä [Mamata] f 'Mein-heit', Besitzgefühl, Eigeninteresse, Stolz; Hindi: Zuneigung.
mäf!)sa [Mamsa] n Fleisch.
manab-suddhi, manas-suddhi [Manah Shuddhi] f Reinheit bzw. Reinigung des Denkens.
manas [Manas] n Denkorgan, Denken, Geist.
maf)l;ia/a [Mandala] n Kreis; in Ritualen: meist punktsymmetri sches Diagramm.
maf)l;ialesvara [Mandaleshvar] m Herrscher eines Gebiets; Gottheit eines maf)r;iala-s.
mandira [Mandir] n Haus, Tempel.
mäf)l;iükya-upani$ad [Mandukya-Upanisad] f upani$ad des Atharva-veda.
maf)i [Mani] m Juwel.
maf)i-püra [Manipura] m Juwelensee, -flut; Nabel.
maf)i-püra-cakra [Manipura Chakra] n Nabel-cakro.
mano-mätra [Manomatra] 'vom Maß des Denkens', so weit wie das Denken, nur das Denken.
mano-mätra-Jagat [Manomatra Jagat] n nur im Geist beste hende Welt.
mano-maya-kosa [Manomaya Kosha] m die aus Denken ge machte (geistig-emotionale) Körperhülle.
mano-näsa [Manonasha] m Verschwinden/Verlust des Den kens, Geistes (Zustand in der Meditation).
mansür [Mansur] m Mansür al Halläj, berühmter Sufi {857 - 922), s. ana'l-haqq.
mantra [Mantra] m Strophe aus den Veda-s; Anrufungsformel für Gottheiten; Formel/Silben zur Meditation.
mantra-dra$t(, mantra-dro$tä [Mantra Drashta] m Seher eines
mantro-s.
manu [Manu] m Name des mythischen Vaters der Menschen. manu-smrti [Manusmriti] f Manu zugeschriebener Gesetzes text.
märo [Mara] m Liebesgott, Tod; dämonischer Versucher des Buddha.
märga [Marga] m Weg, Pfad.
märica [Maricha] m Name eines Dämons, der in Gestalt einer Gazelle beim Raub von STtä behilflich war.
märjäry-äsana [Marjaryasana] n Katzenstellung.
märkaf)l;ieya [Markandeya] m Name eines mythischen Weisen aus dem Mahäbhärata, Märkar:ic;leya-purär:ia usw.
masjid [Masjid] f (Hindi) Moschee.
matha [Math, Matha] min Hütte eines Asketen, Kloster.
mäträ [Matra] f Maß, Maßeinheit; Versfuß.
241 /
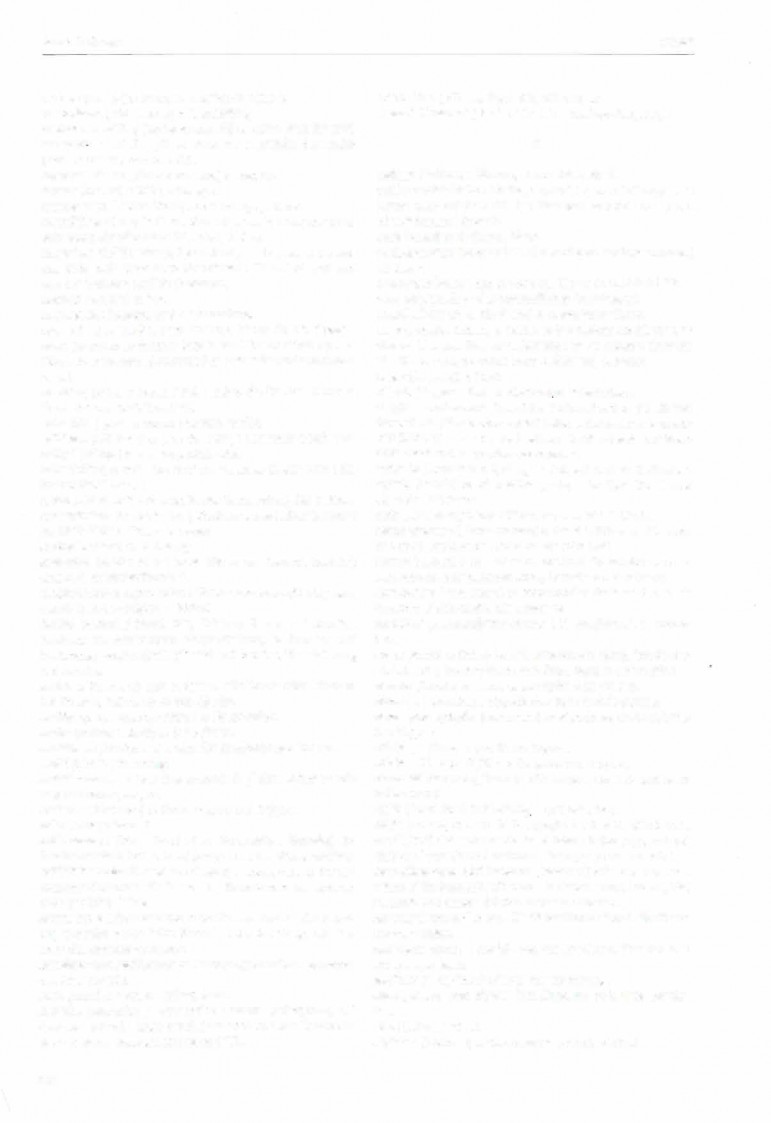
Sanskrit-Glossar
matsya [Matsya] m Fisch; 1. Inkarnation Vi$QU-s.
matsyiisana [Matsyasana] n Fischstellung.
matsyendra(niitha) [Matsyendranath] m Name eines legendä ren yogT s, ca. 9. Jh., gilt als einer der Begründer des Hatha yoga, Lehrer von Gorakh-näth.
matsyendriisana [Matsyendrasana] n Drehsitz.
mauna [Mauna] n Stille, Schweigen.
mauna-vrata [Mauna Vrata] min Schweigegelübde. maunT[Mauni] m (Hindi; von Sanskrit maunin) einer, der durch Schweigen charakterisiert ist, Asket, Weiser.
miiyii [Maya] /Täuschung, Zauberkraft, Illusion, durch die man das nicht reale Universum für existent hält und für getrennt von der höchsten Realität (brahman).
mayüra [Mayura] m Pfau.
mayüriisana [Mayurasana] n Pfaustellung.
mela [Mela] m Treffen, Versammlung, Jahrmarkt; Hindi melä. meru [Meru] m mythischer Berg in der Mitte der Welt (symbo lisiert die Wirbelsäule), zentrale Perle einer Gebetskette (meru ma(li).
mirii(biiO [Mira, Mirabai] f ind. Heilige, die für ihre Lieder an Kr$r:ia bekannt ist (1498-1546).
mita [Mita] ge-/bemessen, sparsam, mäßig.
mitähiira [Mitahara] m (von der Menge her) mäßige Nahrung.
mithyii [Mithya] falsch, vergeblich, eitel.
mitra [Mitra] m vedischer Gott des Vertrags; später: Name der Sonne; Hindi Freund.
moha [Moha] m Verwirrung, Fehler, Verblendung des Geistes.
mohenjo daro [Mohenjo Daro] Stadt der Indus-Kultur (Blütezeit ca. 2600-2000 v. Chr.), s. harappa.
mok$a [Moksha] m Befreiung.
mrd-ariga [Mridanga] n 'dessen Körper aus Tonerde besteht'; eine zweigesichtige Trommel.
mü(iha [Mudha] dumpf (durch Einfluss von tamas/Schlaf); eine der Ebenen des Geistes, s. bhümi.
mudrii [Mudra] f Siegel, Bild, Zeichen; Finger- und sonstige Position; im hatha-yoga: Körperstellung, verbunden mit bestimmter Atemtechnik, oft auch mit bandha, Visualisierung und mantra.
muhürta [Muhurta] min Moment, glückbringender Moment
bei Ritualen, Zeitabschnitt von 48 Min.
mukhya-prä(la [Mukhya Prana] m Haupt-prä(la.
mukta [Mukta] befreit; m der Befreite.
muktiisana [Muktasana] n eine der Meditationsstellungen.
mukti [Mukti] f Befreiung.
muktika-upani$ad [Muktika-Upanishad] f dem Atharva-veda zugerechnete upani:;ad.
mukunda [Mukunda] m Name Vi$QU-s und Kr$Qa-s.
müla [Mula] n Wurzel.
mü/a-bandha [Mula Bandha] m Kontraktion (bandha) im Bereich der Basis bzw. Wurzel (müla}, d. h. des Wurzel-cakra-s. müliidhiira-cakra [Muladhara Chakra] n cakra, dessen Stütze/ Konzentrationspunkt die Wurzel ist, Wurzel-cakra am unteren Ende der Wirbelsäule.
mumuk$utva [Mumukshutva] n der Zustand dessen, der Befrei
ung wünscht; vereinfacht: Wunsch nach Befreiung, ein Ele ment des sädhana-catu$taya.
mu(l(iaka-upani$ad [Mundaka-Upani$ad]feine ältere upani$ad
des Atharva-veda.
muni [Muni] m Weiser, Heiliger, Asket.
mürcchii [Murchha] f 'Bewusstlos werden', prii(liiyiima, bei dem die Luft sehr lange angehalten wird und der Übende in einen anderen Bewusstseinszustand fällt.
242
matsya
mürti [Murti] f Form, Figur, Bild, Götterfigur.
masüri [Mussoorie] Region/Stadt im Himälaya-Vorgebirge.
N
nabhas [Nabhas] n Himmel, Atmosphäre, Wolke.
nabho-mudrii [Nabho Mudra] f mudrä, bei der die Zunge nach hinten zum weichen Teil des Gaumens gefaltet wird (nach oben/Richtung Himmel).
niida [Nada] m Geräusch, Klang.
niida-brahman [Nadabrahman] n brahman (wahrgenommen) als Klang.
niida-yoga [Nada Yoga] m yoga des Klangs (z. B. HYP 4.80ff).
nii(ii, nii(ii [Nadi] f Ader, feinstofflicher Energiekanal.
nii(iT-sodhana [Nadi Shodhana] n, s. anulama-viloma.
niiga [Naga] m Schlange, insbes. Kobra; Elefant; mythisches, im Wasser lebendes Wesen; Volksgruppe im NO Indiens; einer der fünf Neben-prii(la-s (wirkt beim Aufstoßen), s. prii(la.
nagar [Nagar(a)] n Stadt.
niigpür [Nagpur] Stadt in Mahärä$tra (Westindien).
nai$thika-brahmaciiri [Naishthika Brahmachari] m (Hindi; von Sanskrit nai:;thika-brahma-cärin) fester, entschiedener brahma cärT (Mönch), der auch nach seinem Schüler-Dasein auf Sexu alität verzichtet, s. var(liisrama-dharma.
naivedya [Naivedya] n Speisegabe bei püjä u.ä. an Gottheiten. nakula [Nakula] m Mungo/Manguste, iltisartiges Tier; Name eines der Pär:ii;Java-s.
nala [Nala] m mythischer König aus dem Mahäbhärata.
niima-smara(la [Namasmarana] n das sich Erinnern, die men tale Wiederholung des Namens einer Gottheit.
namas [Namah] n (je nach dem, was folgt, ändert sich der Aus laut: namah, namo, namas usw.); Verneigung, Verehrung. namas-kiira [Namaskara] m respektvoller Gruß, wird u. a. als Grußformel gebraucht, wie namas te.
namas te [Namaste] 'Verneigung Dir', Grußformel, s. namas kära.
nandT[Nandi] m (Hindi; von Sanskrit nandin) durch Freude cha rakterisiert, glücklich; Name von Siva-s Reittier, einem Stier. niirada [Narada] m Name eines mythischen Weisen.
niiradfya [Naradiya] n Vi$QUitischer Text: Närada-purär:ia. narasirr,ha, nrsirr,ha [Narasimha] m Mannlöwe, vierte Inkarna tion Vi$QU-s.
niiräya(la [Narayana] m Name Vi$QU-s.
niiriiya(lt [Narayani] f Name Lak$mT-s und Durgä-s.
narmadii [Narmada] f Fluss in Mittelindien, der Süd- und Nord indien trennt.
niisik [Nasik] Stadt in Mahärä$tra (Mittelindien).
niitha [Nath(a)] m Herr; Titel von yogT-s der Gorakh-näth-Schule. nauli [Nauli]feine der sechs Haupt-kriyä-s hatha-yoga, bei wel cher der Darm durch Bauchmuskelbewegung massiert wird. nava-riitra, nava-rätri [Navaratra, Navaratri] n Periode von 'neun Nächten' im September/Oktober, in denen Durgä, Lak$mT, KälT, SarasvatT und andere Göttinnen verehrt werden.
nayanar [Nayanar] m Bez. für 63 berühmte südind. sivaitische Dichter/Heilige.
neti [Neti] 'nicht so' (na iti), Bez. des Absoluten, über das man nichts sagen kann.
netVneti [Neti] fMethode zur Nasenreinigung.
nididhyiisana, nidi dhyiisa [Nididhyasana] min tiefe Medita tion.
nidrii [Nidra]fSchlaf.
nil)sviisa [Nishvasa] m das Ausatmen, Atem, Seufzer.
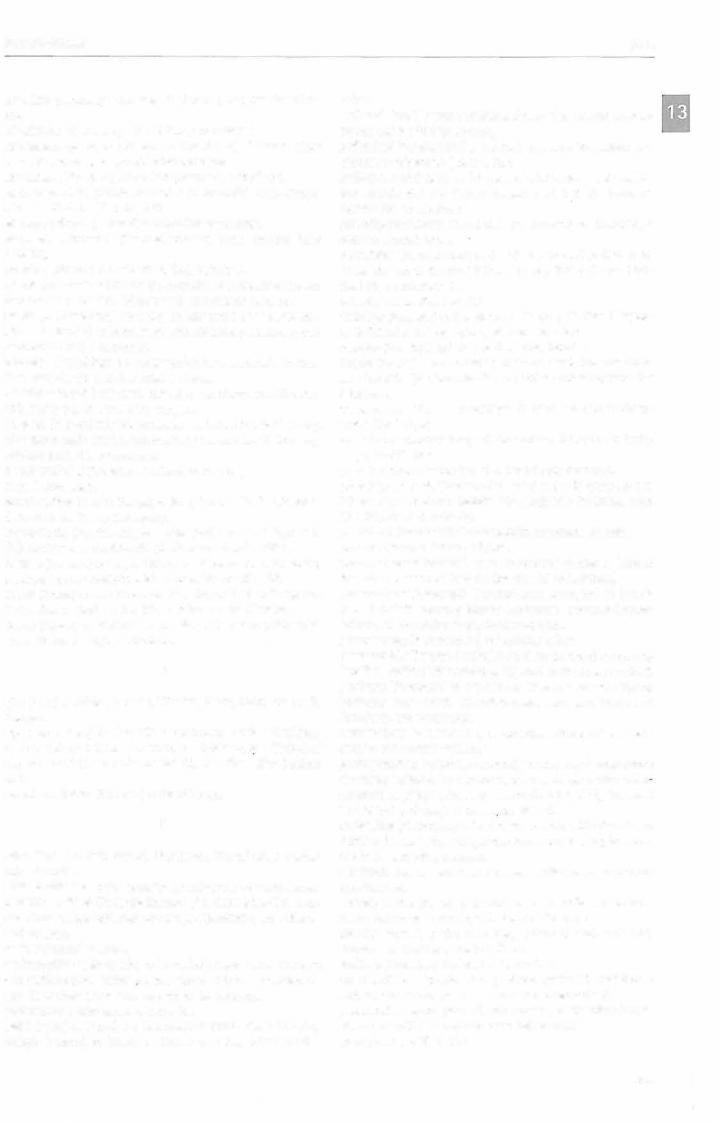
Sanskrit-Glossar
nir-äkära [Nirakara] ohne Gestalt, formlos, Bez. für das Höch ste.
nir-älamba [Niralamba] ohne Stütze, unabhängig.
nir-älamba-upani$ad [Niralamba-Upanishad] f Name einer dem Atharva-veda zugerechneten upani$ad.
nir-anjana [Niranjana] ohne Salbe/Pigment; unbefleckt.
nir-bija-samädhi [Nirbija Samadhi] m samädhi ohne Samen, höchster Zustand (YS 1.51, 3.8).
nir-gu,:,a [Nirguna] ohne Qualitäten/Eigenschaften.
nir-manu [Nirmanu] (Wechselatmung) ohne mantra (GhS 5.36,37).
nir-vär:ia [Nirvana] n Verlöschen, Tod, Befreiung.
nir-vika/pa-samädhi [Nirvikalpa Samadhi] m samädhi ohne Un terscheidung, Dualität, höchster überbewusster Zustand.
nir-Vi$aya [Nirvishaya] ohne Objekt (der Sinne oder der Welt). nirodha [Nirodha] m Behindern, Unterdrückung, Kontrolle; Gei steszustand ohne Gedanken.
niruddha [Niruddha] be- oder verhindert, blockiert, kontrol liert: eine der Ebenen des citta, s. bhümi.
ni$-käma-karma [Nishkama Karma] n Handlung ohne Wunsch, selbstloser Dienst ohne Erwartungen.
ni$-patti [Nishpatthi] fHervorkommen, Perfektion, Vollendung. ni$-patti-avasthä [Nishpatthi Avastha] fZustand der Vollendung, höchste Stufe des präf)äyäma.
ni$thä [Nishtha] f Position, Zustand, Vollendung.
nitya [Nitya] ewig.
nivrtti-märga [Nivritti Marga] m Weg des sich Zurück-/Abwen dens (von der Welt); Entsagung.
nivrtti-nätha [Nivrittinath] m großer yog'i aus Mahärä$tra (13. Jh.), Schüler von GahinT-näth (Schüler von Gorakh-näth). niyama [Niyama] m Regel, Gebot, rel. Observanz, z. B.: sauca, santO$O, tapas, svödhyäya, Tsvara-prof)idhana (YS 2.32}.
nyäsa [Nyasa] m das Niederwerfen, -legen; Zuschreibung von Gottheiten zu bestimmten Körperteilen vor rel. Ritualen. nyäya [Nyaya] m Methode usw.; eines der sechs philosophi schen Systeme, Logik, s. darsana.
0
ojas [Ojas] n Stärke, Energie, Vitalität, Glanz, Licht; spirituelle Energie.
orn (aum) [Om] heilige Silbe; brohman; nach Mär:ic;f 0kya upani$ad viergeteilt: a - Wachen, u - Schlafen, m - Tiefschlaf
(m) und unsichtbarer vierter Teil (.}, der über aller Dualität steht.
orn-kära, ori-kära [Omkara] m die Silbe orn.
p
päda [Pada] m Fuß; Viertel, Versviertel, Viertel eines Buches od_er Kapitels.
päda-hastäsana [Pada Hastasana] n stehende Vorwärtsbeuge. padärthäbhävan'i [Padarthabhavani] f sechste bhümikä: Stufe der Abwesenheit (abhäva) von Dingen (padärtha) im Äußeren und Inneren.
padma [Padma] n Lotos.
padma-päda [Padmapada] m 'Lotosfuß'; Name eines Schülers von Sankaräcärya (unter seinen Füßen blühten Lotosblumen auf, als er über einen Fluss zu seinem Lehrer ging). padmäsana [Padmasana] n Lotossitz.
paisä [Paisa] m (Hindi) ind. Münzeinheit (100 paise = 1 Rupie).
pakorä [Pakora] m (Hindi) in Kichererbsenteig frittiertes Ge-
pasu
müse.
pafica-dhärar:iä [Pancha Dharana] f nach GhS 3.68-69 Konzen tration auf die fünf (Elemente).
paficada§ [Panchadashi] f Lehrtext des advaita-vedänta von
Mädhava Vidyärar:iya (13./14. Jh.}.
paficägni [Panchagni] m Übung mit fünf Feuern, bei welcher der Übende von vier Feuern umgeben ist, und die Sonne als fünftes von oben scheint.
paficäk$ara-mantra [Panchakshara Mantra] m fünfsilbiger
mantra: namah siväya.
paficäk$ar'i [Panchakshari] m (Hindi; von Sanskrit paficäk$arin) einer, der durch die fünf Silben (na-mal:i si-vä-ya) charakteri siert ist, sie wiederholt.
pafican, pafica [Pancha] fünf.
päf)<;iava [Pandava] m Nachkomme Pär:ic;f u-s; die fünf Pär:ic;f ava s: Yudhi$thira, BhTma, Arjuna, Naku/a, Sahadeva.
par:i<;iita [Pandit(a)] gelehrt; m Gelehrter, Experte.
pär:i<;iu [Pandu] blass, weißlich; m Name des Sohns von Vyäsa und Ambälikä (die beim Anblick von Vyäsa erblasste); Vater der Pär:ic;fava-s.
papadam m dünnes, knuspriges Gebäck aus Kichererbsen mehl; Hindi pöpar.
para [Para] anderer; fern; auf der anderen Seite; m ein Ande rer; n das Höchste.
para-brahman [Parabrahman] n das höchste brahman.
para-käya-pravesa [Parakaya Pravesha] m das Eintreten in den Körper eines Anderen (siddhi, übernatürliche Fähigkeit, nach YS 3.38 para-sarTra-ävesa).
parä sakti [Parashakti] f höchste sakti, kosmische Energie.
parama [Parama] fernst-, höchst-.
parama-harnsa [Paramahamsa] m höchster Ganter, s. harnsa; Bez. einer Klasse von Asketen (im Idealfall Erleuchtete). parama-harnsa-sannyäs'i [Paramahamsa Sannyasi] m (Hindi; von Sanskrit parama-harnsa-sannyäsin) parama-harnsa Mönch, oft Angehöriger des Sankara-Ordens.
paramätman [Paramatman] m höchstes Selbst.
paramotsäha [Parama Utsaha] m höchste (parama) Bemühung (utsäha}, größter Eifer (wichtige Eigenschaft in einem Schüler). paräsara [Parashara] m mythischer Weiser, Vater von Vyäsa, Verfasser einer Smrti, legendärerweise auch von Werken zu Astrologie und Tantrismus.
parasu-räma [Parashurama] m Axt-Räma (Räma mit der Axt}, sechste Inkarnation Vi$r:iu-s.
paricayävasthä [Parichaya Avastha] f dritter, durch präf)äyäma erreichter Zustand: Trommeltöne werden im öjnä-cakra wahr genommen, präf)a geht in die leere ein (HYP 4.74}, Kur:ic;falinT ist erweckt und steigt in der susumnä hoch.
parivräjaka [Parivrajaka] m 'Umherwandernder', Wandermönch. Parse m 'Perser', Angehöriger des Parsismus, von Englisch par see bzw. Hindi färsT, persisch.
Parsismus Rel. der aus dem Iran nach Indien eingewanderten Zarathustrier.
parvan, parva [Parva] n Knoten (z. B. an Gräsern); Gelenk, Glied; Kapitel eines Buchs, z. B. des Mahäbhärata.
pärvat'i [Parvati] f 'die vom Berg (pärvata) abstammende', Tochter des Himalaya, Ehefrau Siva-s.
pascima [Paschima] hinten, letzt-, westlich.
pascimottäna [Paschimottana] hinten gestreckt (pascima + uttäna, von ud-tan, nach oben strecken, ausstrecken). pascimottänäsana [Paschimottanasana] n Vorwärtsbeuge, eines der zwölf Haupt-äsona-s des hatha-yoga.
pasu [Pashu] m Vieh, Tier.
243
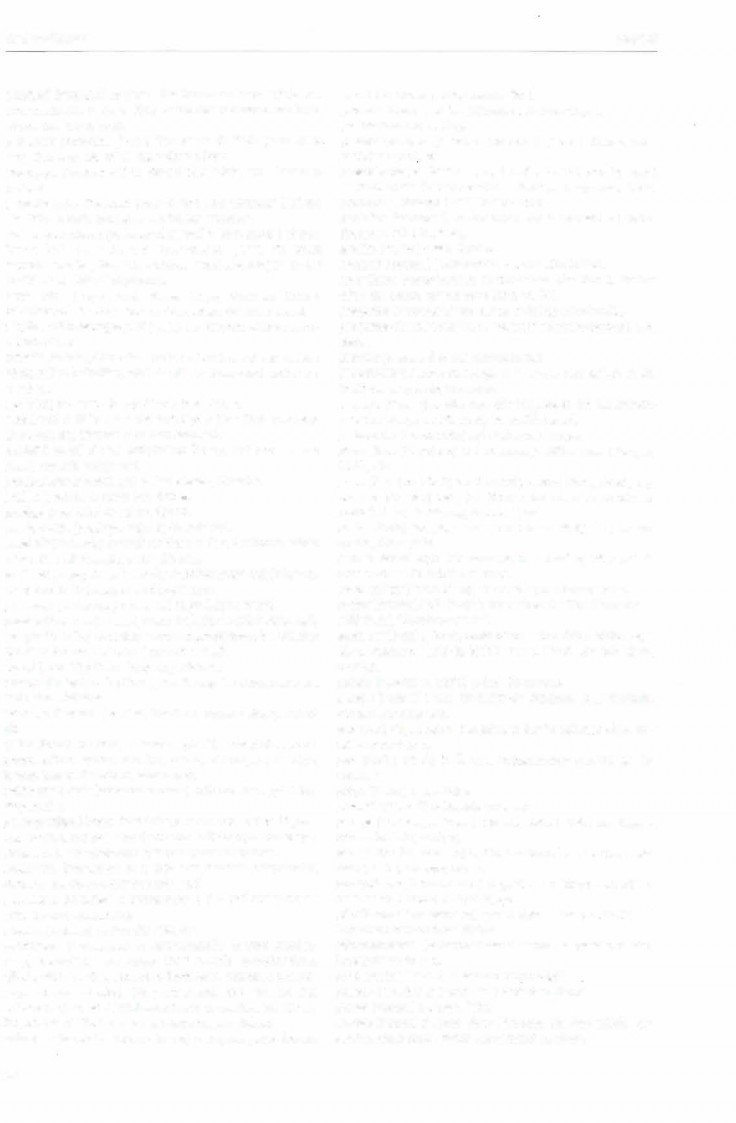
Sanskrit-Glossar
patafijali [Patanjali] m Name des Verfassers eines Werks zur Grammatik (ca. 3. Jh. v. Chr.); Name des Verfassers der Voga sütra-s (ca. 350 n. Chr.).
pati-vratä [Pativrata] f eine Frau deren Gelübde (zum Wohl
des) Ehemanns ist, treue, tugendsame Frau.
paurw;eya [Paurusheya] zu Menschen gehörig, von Menschen verfasst.
pavähärT bäbä [Pavahari Baba] m 'von Luft lebender' Heiliger, der 1504 in Galta bei Jaipur ein Kloster gründete.
pavana-muktäsana [Pavanamuktasana] n 'vom Wind befreites äsana', bei dem Knie und Oberschenkel gegen die Brust gepresst werden; Bez. für einfache Vogabewegungen in der Tradition von SvämT Satyänanda.
pil')c;la [Pinda) min runde Masse, Kugel, Klumpen, Körper; Mikrokosmos, im Gegensatz zu brahmöl')c;la (Makrokosmos). pil')c;lö,:,c;la [Pindanda] min Ei (a,:1r;Ja) des Körpers: Mikrokosmos,
s. brahmäl')r;ia.
pirigalä [Pingala] feine der drei Haupt-när;Ji-s, auf der rechten Körperhälfte befindlich, wird als mit der Sonne verbunden an gesehen.
pitr [Pitri] m Vater; pitarab PI Vorfahren, Ahnen.
pitta [Pitta] n Galle, einer der drei do$a-s (Konstitutionsarten/ elemente) des Körpers nach dem äyurveda.
plävinT [Plavini) f eine prä,:,äyöma-Obung, bei welcher der Bauch mit Luft gefüllt wird.
pra-l')i-dhäna [Pranidhana] n Niederlegen, Hingabe.
prabhu [Prabhu] m Herr; Bez. Gottes. pradO$G [Pradosha] m Fehler, Abend. prado$a-püjä [Pradosha Puja] m Abendritual.
prahläda [Prahlada] m Verehrer Vi$r:iu-s, dem der Gott in seiner Inkarnation als Narasirnha zu Hilfe kam.
prajäpati [Prajapati] m 'Herr der Nachkommen', Schöpfergott, besonders in Brähmar:ia-s und upani$ad-s.
prakaral')a [Prakarana] n u. a. Teil, Kapitel eines Werks. prakäsa [Prakasha] m Licht, Glanz, Helligkeit, Ausbreitung, Luft. präkrta [Prakrita] natürlich; Form von präl')äyäma, bei welcher der Atem beobachtet wird, jedoch frei fließt.
prakrti [Prakriti]fNatur, Ursprung, Materie.
pralaya [Pralaya] m Auflösung, Zerstörung des Universums am Ende eines Zeitalters.
pramäl')a [Pramana] n Maß, Standard, Beweis(mittel), Autori tät.
präl')a [Prana] m Atem, Lebensenergie; fünf Hauptatemarten: pröl')a, udöna, vyäna, samäna, apäna; Nebengruppe: näga, kürma, krkara, devadatta, dhananjaya.
prä,:,a-maya-kosa [Pranamaya Kosha] min aus Atem gebildete Körperhülle.
prä,:,a-prati$thä [Prana Pratishtha]/Zeremonie, bei der Figuren und sonstige Symbole von Gottheiten mit Atem/Leben ausge stattet, d. h. zur Verehrung geeignet gemacht werden.
prä,:,a-vädT [Pranavadi] m (Hindi; von Sanskrit präl')a-vädin)
Vertreter der Atem-Doktrin: hatha-yogi.
prä,:,äpäna, präl')äpänau [Pranapana] n ein- und ausgeatmete Luft, Ein- und Ausatmung.
pral')ava [Pranava] m Bez. der Silbe orr,.
prä,:,äyäma [Pranayama] m Atemkontrolle (äyöma Ausdeh nung, Kontrolle); acht Arten {HVP 2.44ff): süryabhedana, ujjäyin, si'tkärin, si'ta/T, bhastrikä, bhrämarin, mürcchö, plävini'. prapanca-sära(-tantra) [Prapanchasara] min Essenz des Universums /der Welt: Titel eines Werks zu mantras (ca 10./11. Jh.), wird wohl fälschlich Sarikaräcärya zugeschrieben. prärabdha-karma [Prarabdha Karma] n angefangenes karma,
244
patanjali
das sich in diesem Leben manifestiert.
prasava [Prasava] m das (Er)zeugen, Hervorbringen.
prasna [Prashna] m Frage.
prasna-upani$ad [Prashna-Upanishad] f zum Atharva-veda gehörige upanisad.
prasthänatraya [Prasthanatraya] n die Dreiheit der Systeme/ Methoden: die für den advoita-vedönta grundlegenden Texte: uponi$od-s, Bhagavad-gTtä, Brahma-sütra-s.
prasväsa [Prashvasa] m Ausatmen (im Gegensatz zu sväsa,
Einatmen {VS 1.31, 2.49).
pratika [Pratika] n Bild, Symbol.
pratimä [Pratima]f(Götter)bild, -statue; Ähnlichkeit. pratyähära [Pratyahara] m Zurückziehen (der Sinne), fünftes Glied des achtgliedrigen yoga (VS 2.29, 54).
pratyak$O [Pratyaksha] vor Augen, sichtbar, offenkundig. pratyak$a-devatä [Pratyaksha Devata]fsichtbare Gottheit, z.B. Statue.
pravesa [Pravesha] m das Eintreten, Tür.
prav.rtti-märga [Pravritti Marga] m Weg des nach außen (in die Welt) Gehens, s. nivrtti-märga.
prayäga [Prayag] m alte Bez. der Pilgerstadt am Zusammen fluss von Garigä und Vamunä, heute Allahabad.
präyascitta [Prayaschitta] min Sühnezeremonie.
prayo jana [Prayojana] n Anwendung, Mittel zum Erlangen, Motiv, Ziel.
prem [Prem] m (Hindi; von Sanskrit preman) Liebe, Zuneigung. preman [Preman] m/n (im Vorderglied eines Kompositums premo) Liebe, Zuneigung, Freude, Spaß.
preta [Preta] weggegangen (von dieser Welt), tot; m Ge spenst, Ahnengeist.
preyas [Preya] min lieb, angenehm, erfreulich; 'Himmel' als angestrebtes Ziel (nicht Erlösung).
preyo-märga [Preya Marga] m der Weg des Angenehmen. p[thivT [Prithivi] f'die Breite'; Erde; eines der fünf Elemente. püjä [Puja] fVerehrungsritual.
pura, pur [Pura] n Stadt; sapto pura: sieben (hlg.) Städte (Ayo dhyä, Mathurä, Haridvär, KäsT/Benares, KäncT, UjjayinT/ Ujjain, Dvärkä).
püraka [Puraka] m 'einfüllender', Einatmung.
purä,:,a [Purana] n 'alte' hinduistische Schriften zu Mythologie, Götterverehrung usw.
puri[Puri] Pilgerstadt in Bengalen, in der Vi$r:iu/Kr$r:ia als Jagan näth verehrt wird.
püri [Puri] f(Hindi) in Öl oder Butterschmalz gebratenes Fla denbrot.
pürl')a [Puma] voll; n Fülle.
purohita [Purohit] m Familienpriester.
purw;a [Purusha] m Mann, Mensch, Selbst, Geist (im Gegen satz zu Materie, prakrti).
puru$ärtha [Purushartha] m Ziel des Menschen; die vier Ziele:
kömo, ortho, dharmo, mok$a.
purU$Ottama [Purushottama] m größter der Menschen, höchs tes Wesen: Name von Vi$r:,u/Kr$r:ia.
pürväsrama [Purvashrama] min voriger Lebensabschnitt; bei Mönchen: Zeit vor ihrer Weihe.
pürvottänäsana [Purvotthanasana] n vorn ausgedehnte Stel lung (schiefe Ebene).
pÜ$Ö [Pusha] feine der vierzehn Haupt-när;Ji-s. pü$an/-ä [Pusha] m Name eines vedischen Gottes. pU$PG [Pushpa] n Blume, Blüte.
pütanä [Putana) f Name einer Dämonin, die (vergeblich) ver suchte, Kr$r:,a durch giftige Muttermilch zu töten.
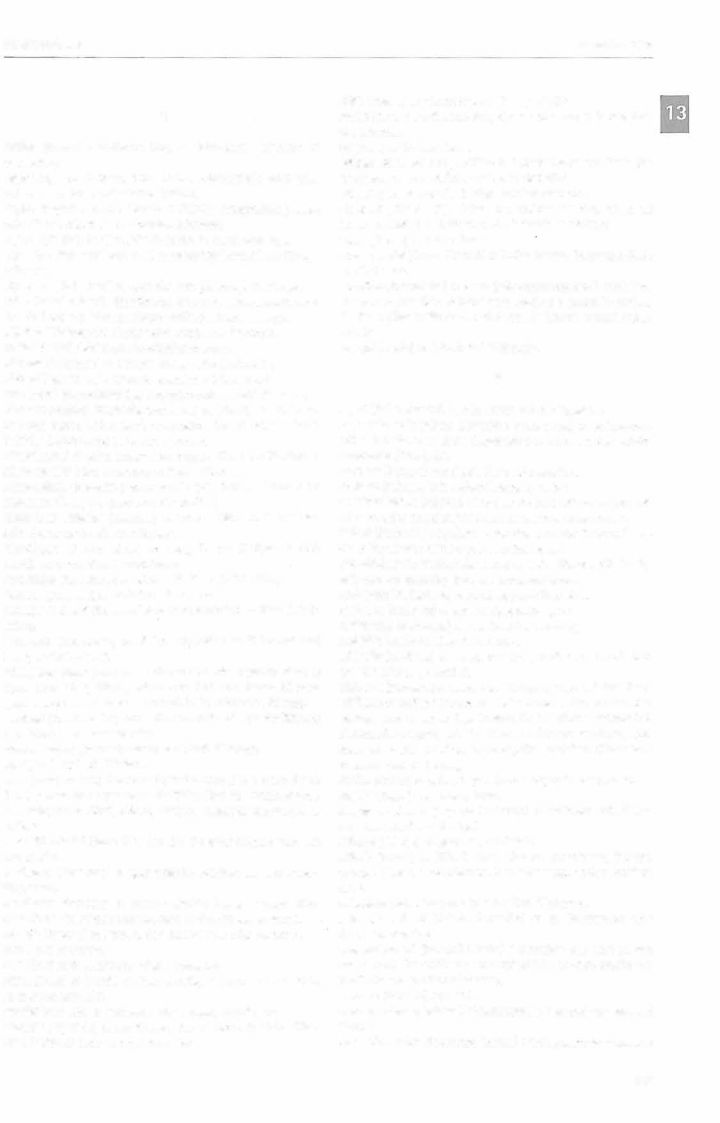
Sanskrit-Glossar
R
rädhä [Radha] f Geliebte Km1a-s, wichtigste Kuhhirtin in Vrndaväna.
räga [Raga] m Färbung, Röte, Liebe, Leidenschaft, Wut, Gier; entspricht rajas; musikalische Tonfolge.
rägini [Ragini] f in der Musik: weibliche Entsprechung eines männlichen rögas (z.B.bhairava, bhairav0.
räjan, räjä [Raj, Raja] m {Hindi) König, in Komposita röja.
räja-süya [Rajasuya] min großes yajna (Opferritual) zur Königs krönung.
räja-yoga [Raja Yoga] m yoga der Könige, königlicher Yoga . rajas [Rajas] n Staub, Eintrübung, Emotion, Leidenschaft: einer der drei guQa-s; Menstrualblut; weibliche Sexualenergie. räjesvari [Rajeshvari] f tantrische Göttin der SrT-vidyä.
räkini [Rakini] f sakti des svödhi$thöna-cakra.
räk$asa [Rakshasa] m Dämon, böser Geist {männlich}.
räk$GSi [Rakshasi] f Dämonin, weiblicher böser Geist.
rarr [Ram] bija-mantra des maQipüra-cakra, steht für Feuer.
räm-carit-mänas [Ramacharitamanas] m (Hindi) der Mänasa See von Räm-s Lebenslauf: Adaptation des Rämäyar:ia durch TulsTdäs {1543-1623} in AvadhT-Sprache.
räma [Rama] machte Inkarnation Vi?r:iu-s, Held des Rämäyar:ia.
räma-candra [Ramachandra] m Name Räma-s.
räma-näma, ram-näm [Ramanama] n (Hindi) Name Räma-s (im Zusammenhang vonjapa und Meditation).
rämadäsa, rämdäs [Ramdas] m Diener Räma-s; Name ver schiedener hinduistischer Heiliger.
rämak{$fJG [Ramakrishna] m bengalischer Heiliger {1836- 1886), guru von SvämT Vivekänand.
rämaliilga [Ramalinga] m südind. Heiliger (1823-1874).
ramafJa [Ramana] m Geliebter, Ehemann.
ramaf)a mahar$i [Ramana Maharishi] m südind. Heiliger {1879- 1950).
ramanuja [Ramanuja] m südind. vi?r:iuitischer Philosoph und Heiliger (1017-1137).
rämäyaf)a [Ramayana] n das Gehen/der Weg (ayana) Räma-s: Epos über König Räma, seine Frau STtä und deren Wieder gewinnung aus der Gefangenschaft beim Dämonen Rävar:ia. rambhä [Rambha] f apsaras, die von lndra oft zur Verführung von Asketen ausgesandt wird.
ramesvara(m) [Rameshwaram] n südind. Pilgerort.
räni [Rani] f (Hindi) Königin.
rasa [Rasa] m Saft; Geschmack; Verlangen; Liebe; neun durch Kunstgenuss hervorgerufene Gefühle; fünf rel. Dispositionen der Vai?r:iava-s: sönti, dösya, sakhya, vötsalya, mödhurya, s. bhövas.
räsa lilä, räs-lilä [Rasa Lila, Ras Lila] f (Hindi) Kr?r:ia-s Tanz mit den gopT-s.
rasayana [Rasayana] n ayurvedische Medizin zur Lebensver
längerung.
ratnakara [Ratnakar] m Name VälmTki-s bevor er durch Wie derholung des röma-mantra-s zum Dichter/Heiligen wurde. rävaf)a [Ravana] m Dämon, der Räma-s Frau STtä entführte. ravi [Ravi] m Sonne.
rayi [Rayi] min Reichtum, Schatz, Material.
räytä [Raita] m (Hindi) Gurken, sonstige Gemüse oder Obst in Joghurt angemacht.
recaka [Rechaka] m Entleeren (der Lunge), Ausatmung.
rg-veda [Rig Veda] m das Wissen, das in Versen besteht: ältes ter erhaltener indo-europäischer Text.
sahasrära-cakra
riksä [Riksha] m (Hindi) kleines Transportmittel.
rohif)i [Rohini] f (rötliche) Kuh; viertes Mondhaus; liebste Frau des Mondes.
[$i [Rishi] m Weiser, Seher.
[$ikesa [Rishikesh] Pilgerstätte in Uttaräkhar:it;la am Fuße des Himälaya, wo SvämT Sivänanda sich niederließ.
rtu [Ritu] m Jahreszeit; richtige Zeit; Menstruation.
.rtu-sänti [Ritushanti] f Ritual vor Vollzug der Ehe, wenn als Kinder verheiratete Mädchen die Pubertät erreichten.
rudra [Rudra] m Narr,e Siva-s.
rudra-granthi [Rudra Granthi] m Rudra-Knoten, Energieblockade im öjnö-cakra.
rudrak$a [Rudraksha] m Baum (eleocarpus ganitrus), und Same des Baums, aus dem Gebetsketten (mölä-s) hergestellt werden, die Rudra/Siva heilig sind, und denen Heilkräfte zugeschrieben werden.
rupayä [Rupie] m (Hindi) ind. Währung.
s
sa, sä [Sa] in der ind. Musik: erster Ton der Tonleiter.
sa-garbha-präf)äyäma [Sagarbha Pranayama] m praQöyöma mit Wiederholung eines bija-mantra-s; Unterart des sahita kumbhaka (GhS 5.47}.
sa-guf)a [Saguna] mit Eigenschaften/Qualitäten.
sa-hasa [Sahasa] 'mit Lachen/Lächeln', heiter.
sa käma-bhäva [Sakama Bhava] m Zustand mit Verlangen; rel. oder sonstige Handlung mit dem Ziel, etwas zu bekommen. sabari [Shabari] f Angehörige des Stammes der Sabara; Name einer Verehrerin Räma-s aus dem Rämäyar:ia.
sac-cid-änanda [Sachchidananda] m Sein, Wissen, Glückselig keit (sat, cit, önanda): Bez. des brahman/ätman.
sad-acära [Sadachara] m rechtes/gutes Verhalten. sad-guru [Sadguru] m der richtige/wahre guru. sad-viveka [sadviveka] m rechte Unterscheidung. sadasiva [Sadashiva] m Name Siva-s.
sädhaka [Sadhaka] m einer, der Yogapraktiken o. ä. mit dem Ziel der Erlösung ausführt.
sädhana [Sadhana] n Mittel zum Erlangen; yoga u.ä.Praktiken. sadhana-catu$taya [Sadhana Chatushtaya] n Gruppe von vier Mitteln zum Erlangen (spirituellen Fortschritts): vairögya Lei denschaftslosigkeit, viveka Unterscheidungsvermögen, $Ot sampad sechs Schätze, mumuk$utva verkürzt (übersetzt:
Wunsch nach Befreiung).
sädhu [Sadhu] m guter, tugendhafter Mann; Weiser; Asket.
sägara [Sagar] der Ozean, Meer.
saguf)a-brahman [Saguna Brahman] n brahman mit Eigen schaften: sichtbare Gottheit.
saha-ja [Sahaja] eingeboren, natürlich.
sähab [Saheb] m (Hindi) Herr, Meister, prominente Person, wurde in Indien besonders auf Europäer angewendet; Arabisch söhib.
sahadeva [Sahadeva] m einer der fünf Pär:it;lava-s.
sahaja(-samadhi) [Sahaja Samadhi] m im Tantrismus: eine Form von samödhi.
sahajo/i-mudrä [Sahajoli Mudra] f Einreiben des Körpers mit Asche nach Durchführung von vajro/T (HYP 92-95); mudrö zur Sublimierung der Sexualenergie.
sahasra [Sahasra] tausend.
sahasra-näman/-nama [Sahasranama] n (Hymne) von tausend Namen.
sahasrara-cakra [Sahasrara Chakra] n 'Rad (cakra) von tausend
245

Sanskrit Glossar
(sahasra) Speichen (ara)', cakra in der Region der Schädel decke.
sahita-präf)ä yäma [Sahita Pranayama] m präf)äyäma mit kum bhaka, mit oder ohne mantra (GhS 5.47).
saiva [Shaiva] zu Siva gehörig, Bez. seiner Verehrer.
saiva-siddhänta [Shaiva Siddhanta] m südind. rel.-phil. System, in dem Siva als höchste Gottheit verehrt wird.
säkära [Sakara] mit Form/Gestalt (sa-äkära).
sakhä [Sakha] m Freund; Avadhi sakha.
säkhä [Shakha] fZweig, Unterabteilung; veda-Schule.
sakhya, säkhya [Sakhya] n Freundschaft.
sakhya-bhäva [Sakhya Bhav] m Zustand/Gefühl der Freund schaft zu Gott.
säkinT [Shakini]f.fokti des visuddha-cakra.
säk$ät [Sakshat] vor Augen, sichtbar.
säk$ät-kära [Sakshatkara] m Wahrnehmung (auch intuitive). säk$/[Sakshi] m (Hindi; von Sanskrit säk$in) Zeuge, Beobachter. säk$T-bhäva [Sakshi Bhav] m Zustand des Zeugen, das Gefühl, Beobachter aller Handlungen zu sein (u. a. Meditationstech nik).
säkta [Shakta] m zur Sakti gehörig; Bez. ihrer Anhänger.
sakti [Shakti] fKraft, (kosmische) Energie, Bez. für 'die Göttin'. sakti-cälana, sakti-cäfanT [Shakti Chalana, Shakti Chalani] n '.sakti-bewegenlassende', eine der zehn mudrä-s (HYP 3.6-7.). sakti-sancära, sakti-sarricära [Shakti Sanchar] m 'Anregen/ Übermitteln der sakti', Erweckung der ku,:,r;JalinT durch einen guru; Energieübertragung.
Säktismus [Shaktismus] rel. Richtung des Hinduismus, inner halb derer Sakti als höchste Göttin verehrt wird.
sa/abha, sarabha [Shalabha] m Heuschrecke.
salabhäsana [Shalabhasana] n Heuschreckenstellung.
sama [Shama] m (innere) Stille, Ruhe, Frieden, Gleichmut; eine der sat-sampad.
säma-veda [Sama Veda] m 'das Wissen (veda), das in den Melodien (saman) besteht', einer der vier veda-s, der in einer melodiösen Weise rezitiert wird.
samädhäna [Samadhana] n geistige Ruhe, Zufriedenheit. samädhi [Samadhi] m Sammlung, meditativer Zustand, in dem nur Objekt übrig ist (YS 3.3); ohne Objekt: nirbija (YS 1.41-46, 51).
samädhi-päda [Samadhipada] m erstes Kapitel der Yoga-sütra-s, behandelt den Weg zu samädhi.
samäna [Samana] m 'Zusammen-Atem', der für die Verdau ung zuständige Atem.
samanu [Samanu] 'mit (sa) mantra (manu)', Wechselatmung mit mantra und Konzentration auf die vier Elemente. samäsana [Samasana] n Meditationsstellung ähnlich wie padmäsana, mit aufeinanderliegenden Fersen.
sama$ti-präf)a [Samashti Prana] m 'Kollektiv-/Totalitäts-Atem', kosmischer prä,:,a.
samatä [Samata] fGleichheit, Gleichmut.
samatä-df$ti [Samata Drishti] f Blick/Sicht der Gleichheit/des Gleichmuts; universelle Sichtweise.
sambandha [Sambandha] m Zusammenhang, Verbindung. sämbhavl[Shambhavi]f'die zu Sambhu (Siva) gehörige', Name PärvatT-s; Öffnung im Schädel, durch welche die Seele den Körper verlässt.
sämbhavTmudrä [Shambhavi Mudra]feine mudrä, bei welcher der Blick auf den Punkt zwischen den Augenbrauen gerichtet wird.
sambhu [Shambhu] m Name von Siva.
sarrihära [Samhara] m das Zusammenziehen, Zerstörung, ins-
246
sahita-prär:,äyäma
bes. des Universums.
sarrihitä [Samhita] f'die zusammengesetzte', Sammlung (von Texten, Versen usw.).
särrikhya, särikhya [Samkhya, Sankhya] min dualistisches, dem klassischen yoga zugrundeliegendes Philosophiesystem, s. darsana; in der Bhagavad-gTtä: jnäno-yoga.
sampad [Sampad]fReichtum, Schatz; Perfektion; Erfolg, Errun genschaft, s. $Gt-sampad.
sampradäya [Sampradaya] m Tradition, traditionelle Überlie ferung (von: sam ganz, pro nach vorn/weiter, dä geben). samprajnäta-samädhi [Samprajnata Samadhi] m samädhi mit Erkenntnis eines Objekts (YS 1.17).
sarrisära [Samsara] m (Kreis-)Lauf {des Lebens, von Geburt und Tod).
sarriskära [Samskara] m Zubereitung; Eindruck im Gedächtnis/ Unterbewusstsein.
sarrisk_rta [Sanskrit] 'richtig gebildet/zubereitet', opferrein; n Bez. der ältesten überlieferten indo-europäischen Sprache, in der viele Texte Indiens überliefert sind.
sarriyama [Samyama] m Kontrolle, Konzentration; Übung von dhäranä, dhyäna, samädhi zur Erlangung übernatürlicher Kräfte und Erkenntnisse (YS 3.7).
san-car, sarri-car [Sanchar] gehen, durchlaufen, ankommen. san-cita-karma, sarri-cita-karma [Sanchita Karma] n angehäuf tes, aufgespeichertes karma.
sanaka [Sanaka] m Name eines der vier Söhne Brahmä-s. sanandana [Sanandana] m Name eines der vier Söhne Brahmä-s. sanätana [Sanatana] m Name eines der vier Söhne Brahmä-s. sanätana-dharma [Sanatana Dharma] m ewige(s) Gesetz/Rel., orthodoxer Hinduismus.
sanatkumära [Sanatkumara] m Name eines der vier Söhne Brahmä-s.
sandhi [Sandhi] m Verbindung; gram.: Regeln des Wohllauts. sandhyä [Sandhya]fVerbindung; Morgen- und Abenddämme rung (günstige Zeit für spirituelle Übungen).
säf)r;/ilya [Shandilya] m Name eines Weisen aus dem Satapatha brähmar:ia, dem die Lehre der Einheit von ätman und brahman zugeschrieben wird; Name des Verfassers eines Gesetzestexts; Name des Verfassers der Sär:,c;Jilya-bhakti-sütras.
sandTpani [Sandipani] m Name von Kr�r:ia-s guru.
sarigTta [Sangita] zusammen gesungen, im Chor oder mit Instrumenten; Musik; Hindi: Musik; Gesang mit Musik; Auffüh rung mit Gesang, Musik, Tanz.
sarigraha [Sangraha] m Ergreifen, Sammeln, Sammlung (von Texten), Unterstützen, Bemühung, s. loka-sarigraha.
sanjaya [Sanjaya] m Name des Wagenlenkers, der Dhrtarä�tra die Bhagavad-gTtä mitteilte.
sarikalpa [Sankalpa] m Wille, Absicht, Entschluss, Vorstellung, Gedanke, Idee, Gelübde.
sarikara (Shankara] Glück/Wohlergehen verschaffend; m Name Siva-s.
sarikaräcärya [Shankaracharya] m Sarikara-äcärya, 'der Lehrer Sarikara', berühmter Vertreter des advaita-vedänta (zw. 650 und 800 n. Chr.), Organisator eines Mönchsordens mit zehn Unterabteilungen.
forikarT[Shankari]fweibliche Form von Sarikara: Name PärvatT-s. sarikha [Shankh] min Muschel; Stirn-, Schläfenknochen. sarikha-prak$älana [Shankh Prakshalana] n kriyä, bei der so lange Salzwasser getrunken und bestimmte Bewegungen aus geführt werden, bis das Salzwasser durch den Anus wieder ausgeschieden wird.
sarikhinT [Shankhini]feine der när;JT-s (Energiekanäle).
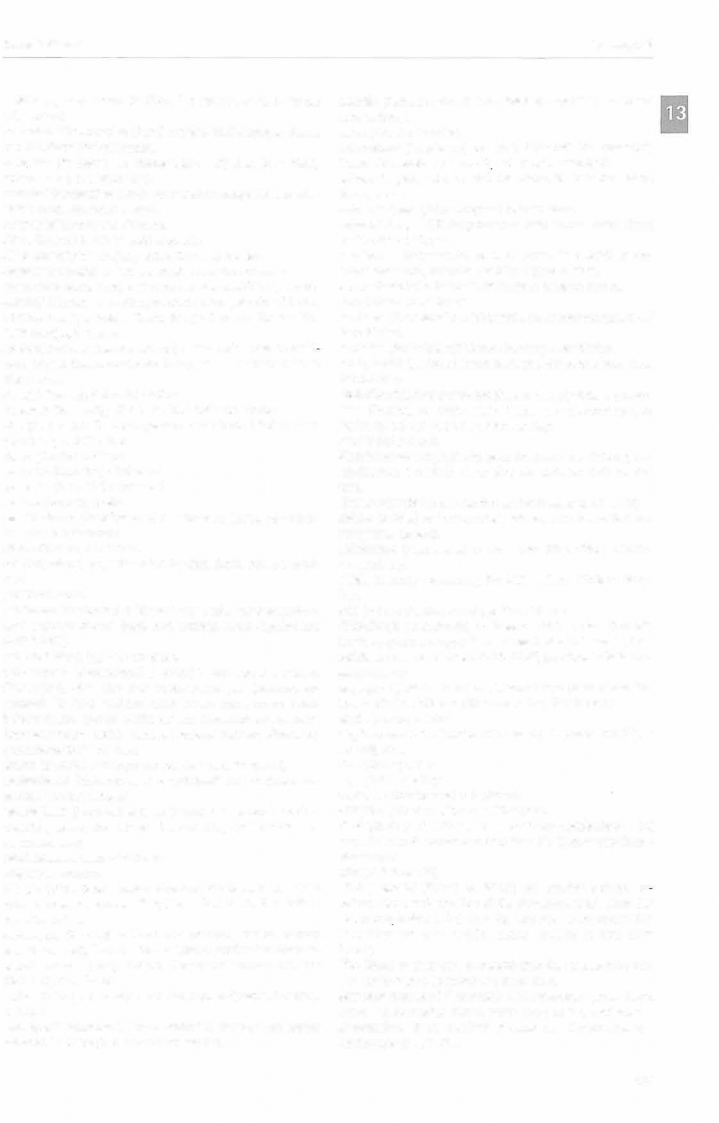
Sanskrit-Glossar
sarikTrtana, saf'!lkirtana [Sankirtan] n Preisen (insbes. Gottes mit Liedern).
$Of)mukha [Shanmuga] m(Tamil) Sanskrit, 'Sechsköpfiger', Name von Kärttikeya /Subrahmar:iya.
sannyäsa [Sannyasa] m Niederlegen, Aufgeben (der Welt), indem man z. B. Mönch wird.
sannyäsT[Sannyasi] m(Hindi; von Sanskrit sannyäsin) charakte risiert durch sannyäsa, Mönch.
sannyäsinT [Sannyasini] f Nonne.
sänta [Shanta] beruhigt, befriedet, still.
sänti [Shanti] f Beruhigung, Stille, (innerer) Frieden.
sant0$0 [Santosha) mZufriedenheit; einer der niyama-s. sapta-pura [Sapta Pura] n Gruppe von sieben Städten, s. pura. saptar$i [Saptarishi) m (Gruppe der) sieben ($i-s (MarTci, Atri, Arigiras, Pulastya, Pulaha, Kratu, Vasi$tha); astron. Großer Bär. sära [Sara] min Essenz.
sara-vaf)a-bhava [Sharavanabhava] m'dessen Werden im Schilf wald ist', Kärttikeya wuchs als Embryo u. a. in einem solchen Wald heran.
särarigT [Sarangi] feine Art Violine.
sarasvatT [Sarasvati] f Göttin der Weisheit und Künste.
särT [Sari] f (Hindi) Frauengewand aus einem (fünf o. neun yards) langen Stück Stoff.
sarTra [Sharira] n Körper.
sarva-jna [Sarvajna] allwissend. sarva-vid [Sarva Vid] allwissend. sarvam [Sarvam] n Alles.
sarvärigäsana [Sarvangasana] n sarva-ariga-äsana, All-Körper Stellung: Schulterstand.
sästra [Shastra] n Lehrtext.
sat [Sat] seiend, gut, n Seiendes, Realität, Gutes, Bez. des brah man.
$Ot [Shat] sechs.
$Ot-karma [Shatkarma] n 'Gruppe von sechs Reinigungsübun gen', $atkriyä: dhauti, basti, neti, trätaka, nau/i, kapä/a-bhäti (HYP 2.22ff.).
$Ot-kriyä [Shatkriya] f s. $Ot-karma.
$Ot-sampad [Shatsampat] f Gruppe von sechs Schätzen (Tugenden), eine der vier Voraussetzungen (sädhana-ca tu$taya) für Schülerschaft: sama innere Ruhe, dama Sebst beherrschung, uparati 'Aufhören' mit Sexualität und anderen Sinnesgenüssen, titik$ä Geduld, sraddhä Vertrauen/Glauben, samädhäna Zufriedenheit.
sataka [Shataka] n Gruppe von hundert (z. B. Strophen). satävadhäna [Shatavadhana] n '(Fähigkeit der) Aufmerksam keit auf hundert (Dinge)'.
satävadhänT [Shatavadhani] m (Hindi; von Sanskrit satäva dhänin) jemand, der sich auf hundert Dinge gleichzeitig kon zentrieren kann.
satchidananda s. sac-cid-änanda.
satguru, s. sadguru.
satT[Sati] f'die Gute', insbes. eine Frau, die sich mit der Leiche ihres Mannes verbrennen ließ; Name PärvatT-s in ihrer frühe ren Inkarnation.
sat-sarig(a) [Satsang] m Zusammenkommen, -treffen (sariga) von Guten (sat), Treffen einer religiösen/spirituellen Gemein schaft; neuere Interpretation: Zusammenkommen mit der Wahrheit, dem Selbst.
sattva [Sattva] n u. a. einer der drei gw:w-s: Qualität der Güte, Reinheit.
sattväpatti [Sattvapatti] f vierte bhümikä, Erlangen von sattva:
gefestigt im Selbst/in der Wahrheit werden.
siva-sarrihitä
sättvika (Sattvik] m Qualität der Reinheit zugehörig; 'sattvisch' bzw. 'sattwig'.
satya [Satya] n Wahrheit.
satya-käma [Satyakama] m 'nach Wahrheit Verlangender', Name eines Weisen aus der Brhadärar:iyaka-upani$ad.
satya-/aka [Satyaloka) m Welt der Wahrheit, einer der sieben
/oka-s, s. loka.
satya-näräyaf)a [Satyanarayana] mForm Vi$QU-s.
satya-näräyaf)a-püjä [Satyanarayana Puja] f(oder -vrata) Ritual zur Verehrung Vi$QU-s.
satyänanda [Satyananda] m u. a. Name eines Schülers von SvämT Sivänanda, Gründer der Bihar School of Yoga.
sauca [Shaucha] n Reinheit, Sauberkeit; Reinigungsritual.
sava [Shava] m Leichnam.
saväsana [Shavasana] n Leichenstellung: Entspannungslage auf dem Rücken.
savikalpa [Savikalpa] mit Unterscheidung, s. nirvikalpa.
savitr, savitä [Savita] m 'Antreiber', Bez. der Sonne bzw. eines der Äditya-s.
sävitrT[Savitri]fberühmte Strophe aus dem �g-veda, s. gäyatrT. Se$O [Shesha] m Ende; Rest; Name der tausendköpfigen Schlange, auf der Vi$QU im Weltmeer liegt.
sevä [Seva] f Dienst.
Shaivismus von Englisch shaivism, Sivaismus: rel. Richtung des Hinduismus, innerhalb derer Siva als höchster Gott verehrt wird.
Shams-e-Tabrizi [Shams Tabriez] mSufi-Heiliger (gest. 1248). siddha [Siddha] m 'Vollendeter', Weiser, mit übernatürlichen Fähigkeiten (siddhi).
siddhäsana [Siddhasana] n Bez. einer Sitzposition, Medita tionsstellung.
siddhi [Siddhi] f Vollendung, Perfektion, übernatürliche Fähig
keit.
sikh [Sikh] mSchüler; Anhänger Guru Nänak-s.
sikhi-dhvaja [Shikhidvaja] m 'dessen Zeichen der Pfau ist', Kärttikeya/Subrahmar:iya; Name eines Königs im Yogaväsi$tha. Sikhismus von Guru Nänak (1469-1539) gegründete Religions gemeinschaft.
sik$ä-guru [Shiksha Guru] m Unterweisungs-guru: Lehrer ins bes. weltlichen Wissens (Wissenschaften, Künste usw.).
sif'!lha [Simha] m Löwe.
singh andere Schreibweise von si(f)h(a), Beiname von Sikh-s und Räjpüt-s.
siras [Shiras] n Kopf.
sTr$a [Shirsha] n Kopf.
si'r$äsana [Shirshasana] n Kopfstand.
sTtä [Sita] f Ehefrau Räma-s, s. Rämäyar:ia.
si'ta/T [Sitali] f 'die Kühle', einer der Haupt-präf)äyäma-s, bei dem die Luft mit zischendem Laut über die längs gerollte Zunge eingeatmet
wird (HYP 2.57, 58).
sTtkäii, si'tkkäri' [Sitkari] m (Hindi; von Sanskrit sTtkärin, sTt kkärin) 'der durch den Ton sTt/sTt charakterisierte', einer der Haupt-pränäyäma-s, bei dem die Luft mit einem zischenden Laut über die quer gerollte Zunge eingeatmet wird (HYP 2.54ff).
Siva [Shiva] meiner der Hauptgottheiten des Hinduismus; Gott der yogT-s; reines, kosmisches Bewusstsein.
siva-rätri [Shivaratri] f eigentlich mahä-siva-rätri, 'große Nacht
Siva-s', hinduistisches Fest zu Ehren Siva-s im Februar/ März. siva-saf'!lhitä [Shiva Samhita] f eines der Hauptwerke des hatha-yoga (ca. 17. Jh.).
247
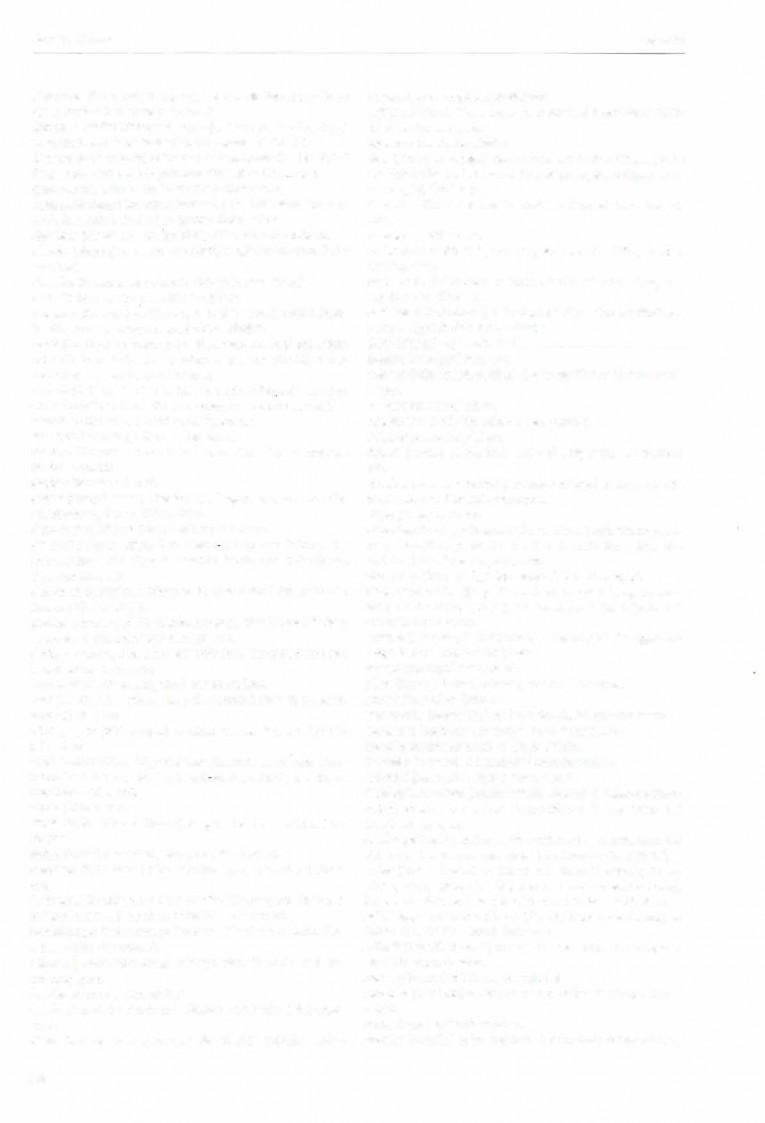
Sanskrit-Glossar
.siva-yoga [Shivayoga] m Yogaart, bei der die Verehrung Siva-s einen großen Stellenwert einnimmt.
siva-yoga-dipikä [Shivayoga Dipika] f 'Leuchte des Siva-Yoga', Yogaschrift von Sadäsivabrahmendra SarasvatT (18. Jh). sivänanda [Sivananda] m 'dessen Glückseligkeit Siva ist', SvämT Sivänanda: Name des Begründers der Divine Life Society
(1887-1963), Lehrer von SvämT Vi?r:iu-devänanda. sivänandanagara [Shivanandanagar] n Ort bei �?ikes, benannt nach dem dort befindlichen äsrama Sivänanda-s.
sivo'ham [Shivoham] 'ich bin Siva', Affirmation des odvaito. skanda [Skandal m Name von Kärttikeya/Subrahmar:iya (Sohn von Siva).
skandha [Skandha] m Schulter; Körper; Zweig; Kapitel.
s/oka [Shloka] m Strophe mit 4 x 8 Silben.
smara,:,a [Smarana] n Erinnern, z. B. den Namen Gottes (zwei tes Element der neunfachen bhakti, s. bhakti).
smrti [Smriti] f Erinnerung; im Gegensatz zu sruti diejenigen authoritativen Texte des Hinduismus, die von Menschen ver fasst wurden, insbes. Gesetzbücher.
so'ham [Soham] 'ich bin er (das Selbst/der hamsa)', mantra, der automatisch durch Ein- und Ausatmen zustandekommt. spandana [Spandana] n Pulsieren, Vibrieren.
sraddhä [Shraddha] fGlaube, Vertrauen.
srava,:,a [Shravana] n das Hören, erste Stufe der neunfachen
bhakti, s. bhakti.
sre$tha [Shreshtha] best-.
sreyas [Shreya] besser, überlegen; n Tugend, moralisches oder rel. Verdienst, Segen, Glück, Gutes.
sreyo-märga [Shreya Marga] m Weg des Guten.
sri [Shri] f Glanz, Glück; Bez. Lak?mT s; wird zum Zeichen der Hochachtung vor Namen gesetzt; heute vor männlichen Eigennamen: Herr.
srimad bhagavad-gitä [Shrimad Bhagavad-Gita] f respektvolle Bez. der Bhagavad-gTtä.
srimati [Shrimati] f die Glückversehene, Verehrungswürdige; heute vor weiblichen Eigennamen: Frau.
srotriya [Shrotriya] m ein in den Schriften, besonders im veda
bewanderter Brahmane.
s[$ti-sakti [Srishti Shakti] f Kraft der Schöpfung.
sruti [Shruti] fdas Hören, Klang; die geoffenbarten Texte: veda.
sthira [Sthira] fest.
sthita-prajna [Sthitaprajna] m einer, dessen Wissen fest ge gründet ist.
sthiti-sakti [Sthiti Shakti] f Kraft der Stabilität: kosmische erhal tende Kraft Gottes, der durch S($ti sakti erschafft, und durch sa('(Jhära-sakti zerstört.
sthüla [Sthula] grob.
sthüla-sarTra [Sthula Sharira] n grobstofflicher (physischer) Körper.
stotra [Stotra] n Preislied, Hymne (an Gottheiten).
subhä$ita [Subhashita] n 'das Wohlgesagte', geistreicher Merk vers.
subhecchä [Shubheccha] f 'glückhafter Wunsch', die Wahrheit zu kennen, erste der sieben bhümikä-s, s. bhümikä. subrahma,:,ya [Subrahmanya] m Name Kärttikeya-s, (Sohn Siva s, Heerführer der Götter).
Sudama [sudäman/Sudämä] mName eines Freundes und Ver ehrers Kr?r:ia-s.
suddha [Shuddha] rein, sauber.
suddhi [Shuddhi] f Reinheit, Helligkeit; Reinigung, Reinigungs ritual.
südra [Shudra] m Angehöriger des vierten Standes, Lohn-
248
siva-yoga
abhängiger, s. var,:,äsrama-dharma.
süft [Sufi] (Hindi) Wolle tragend; rJ1 Mitglied bestimmter mysti scher Orden des Islam.
Sufismus islamische Mystik.
-
-
-
suka [Shuka] m Papagei; Name eines mythischen Weisen, Sohn des Vyäsa (der ihn beim Anblick einer papageigestaltigen apsa ras zeugte), Sukäcärya.
-
-
suka-deva [Shukadeva] m der Gott, der Suka ist: Ehrenbez. für Suka.
sukadev s. sukha-deva.
sukha [Sukha] glücklich, freudvoll, angenehm; n Glück, Freude, Wohlergehen.
sukha-deva [Sukhadeva] m 'Gott des Glücks' oder 'einer, des sen Gott das Glück ist'.
sukhäsana [Sukhasana] n 'bequemer Sitz', eine Meditations haltung, ähnlich dem Schneidersitz.
suk/a [Shukla] weiß, rein, hell.
sük$ma [Sukshma] fein, zart.
sük$ma-sarira [Sukshma Sharira] n feinstofflicher Körper; Astral körper.
sundara [Sundara] schön.
sundarT [Sundari] f die Schöne; Bez. Durgä-s.
sünyatä [Shunyata] fleere.
sürdäs [Surdas] m nordind. Dichter/Heiliger (ca. 1478-1581/ 84),
suresvara, suresvaräcärya [Sureshvaracharya] meiner der vier wichtigsten Schüler Sarikaräcärya-s.
sürya [Surya] m Sonne.
sürya-bheda, sürya-bhedana [Surya Bheda] min 'Sonnenspal tung', Atemübung, bei der durch das rechte Nasenloch ein und durch das linke ausgeatmet wird.
sürya-när;IT [Suryanadi] f'Sonnenader', Bez. für pirigalä.
sürya-namas-kära [Surya Namaskara] m Verneigung (namas kara) an die Sonne (sürya), der Sonnengruß (wichtigste Auf wärmübung im yoga).
SU$Umnä, SU$Umr:,ä [Sushumna] f wichtigster Energiekanal (nar;J0 in der Mitte der Wirbelsäule.
SU$Upti [Sushupti] fT iefschlaf.
sütra [Sutra] n Faden, Lehrsatz, Text mit Lehrsätzen.
svarga [Svarga] m Himmel.
svarga-loka [Svargaloka] m Himmelswelt, himmlische Region.
sva-bhäva [Svabhava] m eigene Natur, Konstitution.
sva-dharma [Svadharma] m eigene Pflicht.
sva-räjya [Svarajya] n (staatliche) Unabhängigkeit.
sva-rüpa [Svarupa] n eigene Form, Natur.
svädhi$thäna-cakra [Svadhishthana Chakra] n 'Eigen-Position cakra', zweites der sieben Haupt-cakra-s, in der Höhe des Steißbeins gelegen.
svädhyäya [Svadhyaya] m Rezitation für sich selbst; Studium der
hlg. Texte, insbes. des veda; einer der niyama-s (YS 2.29, 32). svämT [Svami, Swami] m (Hindi; von Sanskrit svamin) Eigen tümer, Herr; gelehrter Brahmane, hervorragender Aske_t, Anrede für einen solchen; Bez. für verschiedene Gottheiten. svämi Vi$,:,udevänanda [Svami (Swami) Vishnu-devananda] m 1927-1993, Schüler SvämT Sivänanda-s.
svämTjT [Svamiji, Swamiji] m respekt- bzw. liebevolle Anrede in Hindi für einen Asketen.
svapna [Svapna] m Traum, Traumschlaf.
svar-loka [Svar Lokal m Himmelsregion, dritter der sieben /oka-s,
s. /oka.
svasti [Svasti] n/f Wohlergehen.
svastika [Svastika] m im asiatischen Kulturkreis Glückszeichen,
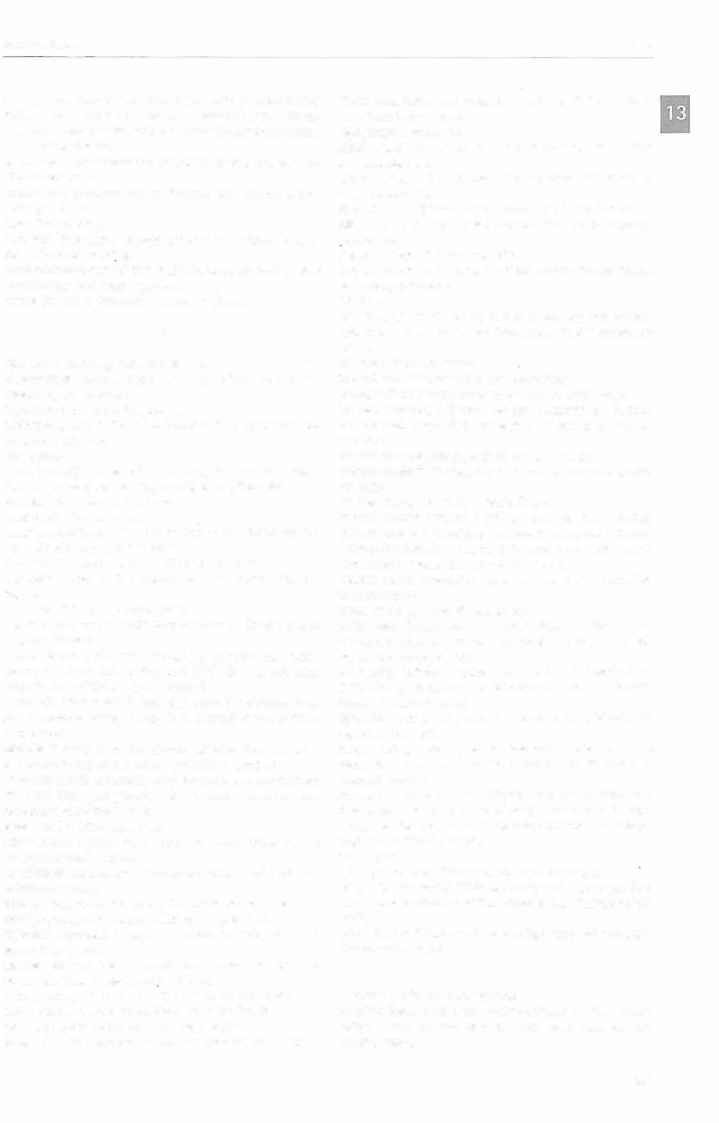
Sanskrit-Glossar
in deutschem Kontext 'Hakenkreuz' (von 1920 bis 1945 auf der Spitze stehend Symbol der Nationalsozialisten), seine öffentli che Zurschaustellung ist verboten, außer für wissenschaftliche und religiöse Zwecke.
svastikäsana [Svastikasana] n kreuzbeiniger Sitz, eine der Me ditationsstelIungen.
svätmäräma [Svatmarama] m Verfasser der Hatha(yoga)pra dTpikä (ca. 14. Jh.).
sveta [Shveta] weiß.
svetaketu [Shvetaketu] m Sohn des Weisen Uddälaka Äruoi in der Chändogya-upanisad.
svetäsvatara-upani$ad [Shvetashvatara-Upanishad] f eine
upani$ad des schwarzen Yajur-veda.
syäma [Shyam] m 'Schwarzer', Name von Kr�oa.
T
tä<ja [Tada) m Schlag, Peitschenhieb; Berg.
tä<jana-kriyä [Tadana Kriya] f Schlag-Praktik: Technik zur Erweckung der kur:ir;lalinT.
tä<jäsana [Tadasana] n Bergstellung.
taittirTya-upani$ad [Taittiriya-Upanishad] f upani$ad des schwarzen Yajur-veda.
tarn s. tham.
tamas [Tamas] n Dunkelheit, Dumpfheit; einer der drei gur:ia-s. tämasa [Tamasa] tamas-artig, dunkel, dumpf, 'tamasig'. tämbü/a [Tambulam] n Betelnuss.
Tamburin Schlaginstrument.
Tamil dravidische Sprache, die in Tamilnadu (Südindien) und Teilen SrTlarikä-s gesprochen wird.
tan-mätra [Tanmatra] n (feinstoffliches) Urelement.
täna-nä<jT [Tana Nadi] f Energiekanal im oberen Teil des Bauches.
tandri, tandri [Tandri]fSchläfrigkeit.
tänpürä [Tambura] f(Hindi) Saiteninstrument für die Beglei tung von Sängern.
tantra [Tantra] n Webstuhl, die auf ihn aufgezogenen Fäden, Faden; rel. Werk (oft zu Siva und Sakti, aber es gibt auch vi�Quitische und buddhistische tantra-s).
tantra-räja [Tantraraja] m König des tantra/der tantra-s: einer, der die tantra-s versteht; Bez. eines tantrischen Werks (Kädi matatantra).
täntrika [Tantrika] m zu den tantra-s gehörig; einer, der die in den tantra-s enthaltenen Lehren praktiziert, Tantriker.
tanu-mänasä [Tanumanasa]fdritte bhümikä, s. bhümikä: Stufe, die durch dünn/gering werden des Denkens in Bezug auf Sin nesobjekte charakterisiert ist.
täpa [Tapa] m Hitze; Qual, Leid.
tapas [Tapas] n Hitze, Feuer; Schmerz; Askese (Ansammlung innerer/spiritueller Hitze).
tapas-caryä [Tapascharya] fPraxis der Askese, Zeit intensiver asketischer Übung.
tapasvi [Tapasvin] m (Hindi; von Sanskrit tapasvin) Asket.
tapasyä [Tapasya]fasketische Übung, s. tapas-caryä.
tapo-loka [Tapoloka] m Region oberhalb der Welt, einer der sieben loka-s, s./oka.
tat tvam asi 'das bist du', mahäväkya 'großer Satz' aus dem Säma-veda (Chändogya-upanisad 6.8.12).
tattva [Tattva] n 'So-sein', u. a. höchste Realität; Element.
tejas [Tejas] n Schärfe; Hitze; Glanz; Kraft; Schönheit.
tha [Thal mystische Bez. des Mondes, s. hatha.
tham [Tham] bija-mantra des Mond-cakra-s und des Nektars.
udäna
Thora autoritative und heiligste Schrift des jüdischen Glau bens (fünf Bücher Mose).
thyägaräja, s. tyägaräja.
ti/aka [Tilak] m/n mit Sandei, roter Farbe usw. auf die Stirn gemaltes Zeichen.
tirtha [Tirtha] n Furt, Passage, Treppe/Anlegeplatz an einem Fluss, Pilgerstätte.
tirupati [Tirupati] Pilgerstadt in Andhra, nördl. von Chennai. titik$ä [Titiksha]/Duldsamkeit, Geduld, eine der $at-sampad, s. sat-sampad.
titik$U [Titikshu] duldsam, geduldig.
trätaka [Trataka] n Fixierung des Blicks, Augenreinigungsübung, eines der $Gt-karma-s.
tri [Tri] drei.
tri-käla-jnäni [Trikala Jnani] m (Hindi; von Sanskrit tri-käla jnänin) Kenner der drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zu kunft).
tri-kor:ia [Trikona] m Dreieck.
tri-kor:iäsana [Trikonasana] n Dreiecksstellung.
tri-kuti [Trikuti]fPunkt zwischen den Augen, drittes Auge.
tri-mürti [Trimurti] f'Gruppe der drei Gestalten', die Gotthei ten Brahmä, Vi�QU, Siva, angesehen als Schöpfer, Erhalter, Zerstörer.
tri-pura-sundara [Tripurasundara] m Name von Siva.
tri-pura-sundari [Tripurasundari]fName einer tantrischen Göt tin, Lalitä.
tri-süla [Trishula] n Dreizack, Waffe Siva-s.
tri-ver:ii, tri-vel)i [Triveni] f Ort, an dem die Flüsse Garigä, Yamunä und die unsichtbare SarasvatT ineinander münden: Prayäga (Allahabad); Stelle im äjnä-cakra, an der ir;/ä, pinga/ä und SU$Umnä ineinander münden (HYP 3.24).
trotaka, totaka [Trotaka] m Name eines der vier Hauptschüler Saokaräcärya-s.
t($1JÖ [Trishna]fDurst, Verlangen, Gier.
tulasT, tulsi [Tulasi, Tulsi] f Hindi 'heiliger Basilikum' (Lat. Ocimum tenuiflorum), der u. a. zur Verehrung Vi�ou-s und sei ner avatäre verwendet wird.
tulasidäsa, tulsidäs [Tulsidas] m nordind. Dichter/Heiliger (1543-1623), Verfasser der Rämäyaoa-Version in Avadhi Sprache (Rämcaritmänas).
tür ki däl [Toor Ki Dal] feine Linsensorte (arhar); Marathi tiJr r;lä/, Hindi tuvar dä/.
turiyä [Turiya] f 'vierte', vierter Bewusstseinszustand (neben Wachsein, Traum und Tiefschlaf); Zustand der Befreiung; s. bhümikä, turyagä.
turya-gä [Turyaga] fsiebte bhümikä: 'zum vierten (höchsten) Bewusstseinszustand gehende (Ebene)', Verankertsein im eige nen Selbst, das man als von nichts mehr unterschieden ansieht. tu$ti [Tushti] fZufriedenheit.
tvam [Tvam] du.
tyäga [Tyaga] m das Verlassen, Ablassen, Entsagung.
tyäga-räja [Tyagaraja] 'König der Entsagung', Name von Siva; Name eines berühmten südind. Dichters und Musikers (1767- 1847).
tyägi[Tyagi] m (Hindi; von Sanskrit tyägin) ein durch Entsagung
Charakterisierter, Asket.
u
ucchväsa [Ucchvasa] m Ausatmung.
u<j-<ji (ur;/r;/Tyate) [Uddi (Uddiyate)] hochfliegen ('er fliegt hoch'). udäna [Udana] m 'nach oben gehender Atem', einer der fünf Haupt-prär:ia-s.
249
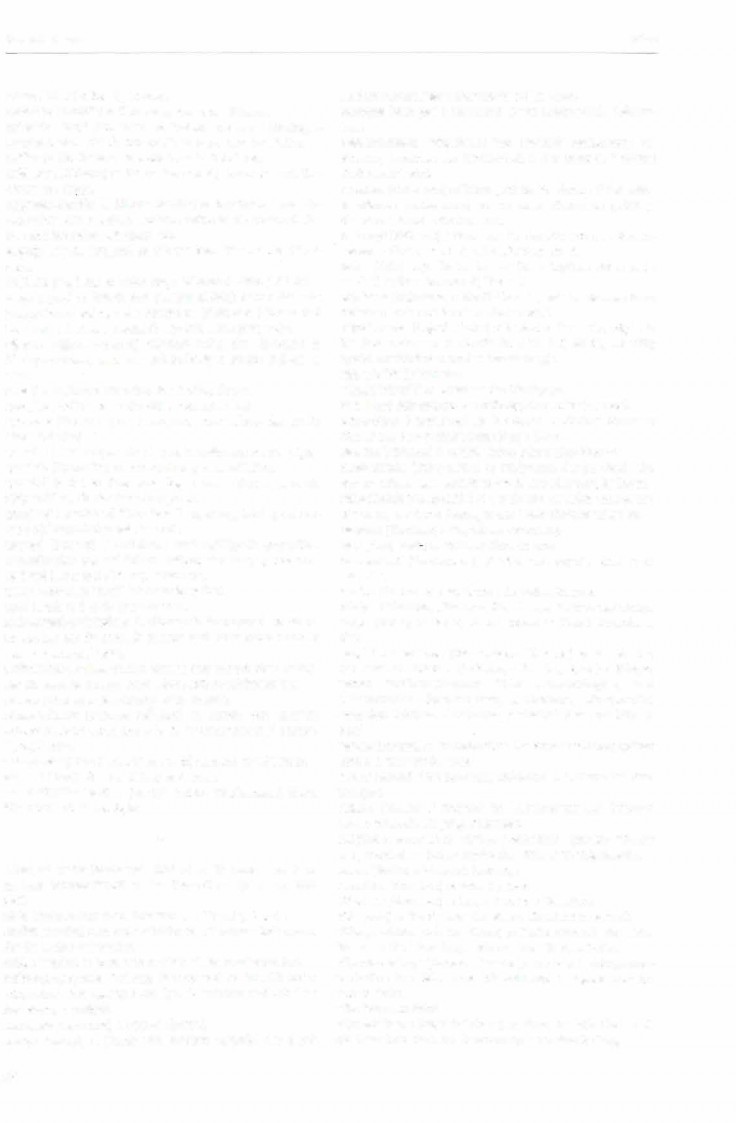
Sanskrit-Glossar
udara [Udara] n Bauch, Inneres.
udbhij-ja [Udbhijja] m 'Sprossengeborener', Pflanze.
uddälaka ärur:,i [Uddalaka] m Weiser aus der Chändogya upani$ad, Vater des Svetaketu (Chändogya-upani$ad 6.lff). uddhar$a [Uddharsha] m große Freude, Entzücken.
uddhava [Uddhava] m Name des Onkels, Freundes und Ver ehrers von Krsr:ia.
u<;llf,yäna-bandha [Uddiyana Bandha] m Bauchverschluss, Zu rückziehen des Bauches, wodurch prär:,a in die suJumnä flie ßen und kur:,<;lalinT aufsteigen soll.
udgätr, udgätä [Udgata] m Sänger bzw. Priester des Säma
veda.
udghäta [Udghata] m Anfangen, s. Väcaspati Misra (YS 2.50). ujjäyT [Ujjayi] m (Hindi; von Sanskrit ujjäyin) dritter der acht prär:,äyäma-s, bei dem die Stimmritze leicht verschlossen und der Atem mit einem Geräusch ein- und ausgeatmet wird. ujjayinT [Ujjain, Ujjayini] Pilgerort nahe der Narmadä in Madhya-pradesh, eine der sieben heiligen Städte Indiens, s. pura.
umä [Uma] f Name PärvatT-s, der Ehefrau Siva-s.
upa [Upa] Präf nahe, in die Nähe, von unten her.
upa-guru [Upa Guru] m Unter-guru, jeder Lehrer, der einem etwas beibringt.
upacära (Upachara] m Dienst; u. a. Darreichung bei der püjä.
upadesa [Upadesha] m Unterweisung; u. a. Initiation.
upädhi [Upadhi] m Täuschung, Begrenzung, Attribut, z. B. die Körperhüllen, die das Selbst umgeben.
upaniJad [Upanishad] f Text bzw. Textgattung; letzter, vorwie gend philosophischer Teil des veda.
uparati (Uparati] f Aufhören; Gleichgültigkeit gegenüber Sinnesfreuden und weltlichem Treiben; eine der Jat-sampad. upäsanä [Upasana] J Dienst, Verehrung.
upmä [Upma] m (Tamil) Weizengriesgericht.
urad [Urad] m (Hindi) eine Linsenart.
ürdhvareta�-prär:,äyäma [Urdhvaretah Pranayama] m Atem übung, bei der die sexuelle Energie nach oben gelenkt und in ojos umgewandelt wird.
ürdhvaretas [Urdhvaretas] m 'dessen Samen nach oben (geht)',
der die sexuelle Energie nach oben geführt/sublimiert hat.
utsäha [Utsaha] m Bemühung, Eifer, Energie.
uttamädhikärT [Uttama Adhikari] m (Hindi; von Sanskrit uttamädhikärin) vorzüglicher (z. B. für Unterweisung) Berech tigter/Schüler.
uttarprades [Uttar Pradesh] m (Hindi) nordind. Bundesstaat.
uttara [Uttara] nördlich, höher; m Norden.
uttarkäsT [Uttarkashi] m (Hindi) 'nördlich KäsT/Benares', kleine Pilgerstadt nördl. von l<.$ikes.
V
väcaspati misra [Vachaspati Mishra] m Verfasser des Kom mentars TattvavaisäradT zu den Yoga-sütra-s (lebte ca. 900- 980).
väda [Vada] m Sprechen, Sprache; u. a. Theorie, Doktrin. vaidika [Vaidika] zum veda gehörig; m orthodoxer Brah-mane, der die vedo-s gelernt hat.
vaidya [Vaidya] m 'zum veda gehöriger', äyurvedischer Arzt. vaikrta-prär:,äyäma [Vaikrita Pranayama] m 'modifizierter prär:iäyäma', mit Regelung von Ein-, Ausatmung und Anhalten des Atems, s. präkrta.
vaikur:,tha [Vaikuntha] n V i$r:JU-s Himmel.
vairägT [Vairagi] m (Hindi; von Sanskrit vairägin) der durch
250
udara
Leidenschaftslosigkeit charakterisiert ist, Asket.
vairägya [Vairagya] n Abwesenheit von Leidenschaft, Asketen tum.
Vaishnavismus, ViJr:,uismus von Englisch vaiJr:,avism; rel. Richtung innerhalb des Hinduismus, in der Vi$r:JU als höchster Gott verehrt wird.
vaiJr:,ava [Vaishnava] zu Vi$r:JU gehörig: Verehrer, Lehren usw. vaisvänara [Vaishvanara] m 'zu allen Menschen gehörig', Verdauungsfeuer; Wachzustand.
vaitarar:,T [Vaitarani] f Fluss, der im Jenseits von den Verstor benen zu überqueren ist, s. Kau$Ttaki-upani$ad.
vajra (Vajra] min Waffe lndra-s (ursprüngliche Form nicht geklärt), später: Donnerkeil; Diamant.
vajräsana [Vajrasana] n Meditationssitz, bei der die linke Ferse zwischen Anus und Scrotum plaziert wird.
vajro/T-mudrä [Vajroli Mudra] J Kontrolle über citrä-nä<;JT, die für Samenemission zuständig ist (HYP 3.7, 83-91, 99-103); mudrä zur Sublimierung der Sexualenergie.
väk, väc [Vak] J Sprache.
välmTki [Valmiki] m Verfasser des Rämäya,:ia.
vorn (Vam] bija-mantra des svädhi$thäna-cakra (Wasser). väma-deva [Vamadeva] m Verfasser vedischer Hymnen; Weiser aus dem Mahäbhärata; Name Siva-s.
vämana [Vamana] m Zwerg, fünfte Inkarnation Vi$r:JU-s.
väna-prastha [Vanaprastha] m Brahmane, der im Wald lebt, sich im dritten Lebensstadium (Waldeinsiedlertum) befindet. vana-prasthT[Vanaprasthi] m (Hindi; von Sansskrit vana-prast hin) einer, der durch Auszug in den Wald charakterisiert ist. vandana [Vandana] n Begrüßen; Verehrung.
vara [Vara] best ; m Wählen; Wunsch usw.
vara-lakJmT [Varalakshmi] f 'Wunsch-Lak$mT', eine Form Lak$mT-s.
varäha (Varaha] m Eber, dritte Inkarnation Vi$r:iu-s. värär:,asT[Varanasi] f Benares, KäsT, heilige Stadt an der Gangä. varr:,a (Varna] m Farbe; Klasse, (sozialer) Stand; Buchstabe, Silbe.
varr:,äsrama-dharma [Varnashrama Dharma] m Gesetz von den sozialen Ständen (brähmar:,a Priester; kJatriya Krieger; vaisya Kaufleute/Bauern; südra Lohnabhängige) und Lebensstadien (brahmacarya, gärhasthya, vänaprastha, sannyäsa: Schüler-, Haushalter-, Waldeinsiedler- und Mönch tum).
varur:,a [Varuna] m im veda: Gott des wahren Wortes; später: Gott des Wassers/Meeres.
värur:,T [Varuni] J die zu Varur:ia gehörige; u. a. Name der Frau Varur:ia-s.
väsanä [Vasana] f Eindruck im Unbewussten aus früheren Leben, Wunsch, Neigung, Phantasie.
vasiJtha [Vasishtha] m Verfasser vedischer Hymnen; Priester einiger epischer Könige; mythischer Weiser im Yogaväsi$tha. vastra [Vastra] n Gewand, Kleidung.
vasudeva [Vasudeva] m Vater Kr$r:ia-s.
väsudeva [Vasudeva] m Kr$,:ia, Sohn von Vasudeva.
väta [Vata] m Wind; einer der doJa-s (Konstitutionsarten). vätsa/ya-bhäva [Vatsalya Bhava] m Zustand/Gefühl der Liebe insbes. zu Gott bzw. Kr$r:ia, wie zu einem Kind, s. bhäva. väyavya-dhärar:,ä [Vayavya Dharana]f zum Wind gehörige Kon zentration (auf Wind bzw. Windelement bezogene Medita tionstechnik).
väyu [Vayu] m Wind.
väyu-bhak$GIJO [Vayubhakshana] m einer, der Wind isst: z. B. ein Asket bzw. nach ind. Anschauung auch eine Schlange.
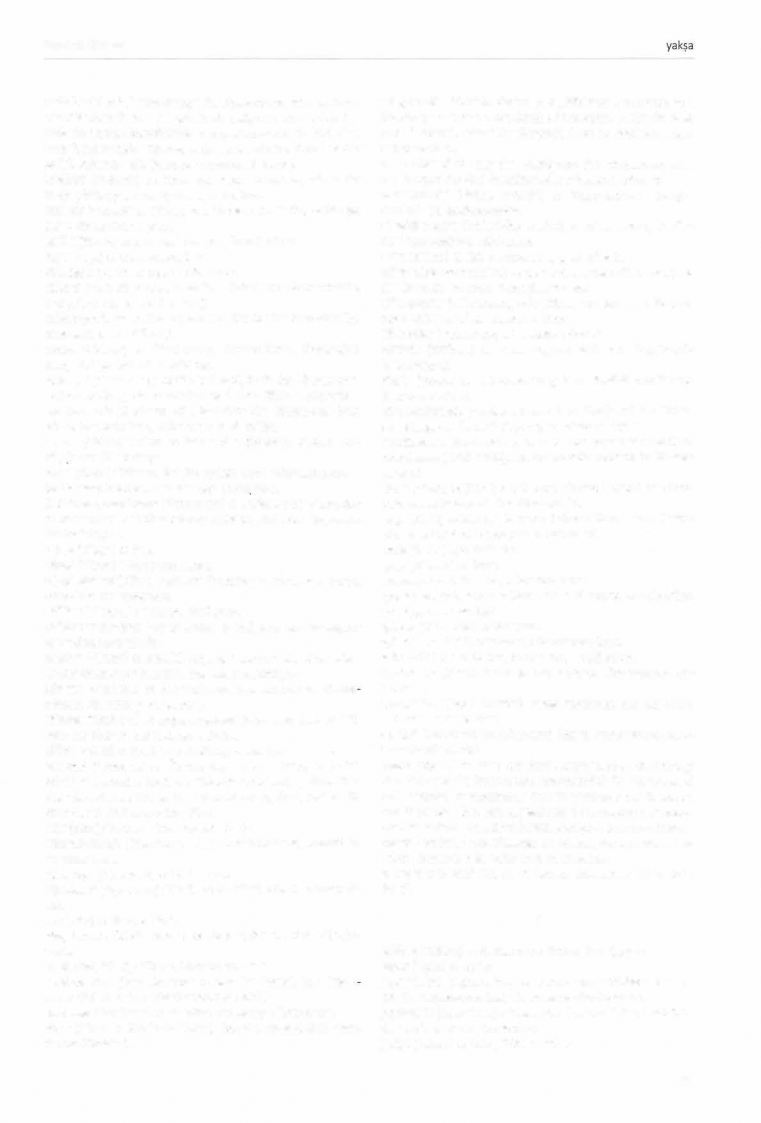
Sanskrit-Glossar
veda [Veda] m Wissen; Gruppe der ältesten überlieferten indo europäischen Texte - sie gelten als heilig; die vier veda-s: Rg veda (in Versen bestehender veda), Säma-veda (in Melodien bestehender veda), Yajur-veda (in Opfersprüchen bestehender veda), Atharva-veda (veda der Atharvan-Priester).
vedänta [Vedanta] m 'Ende des veda', upani$ad, eines der sechs philosophischen Systeme, s. darsana.
vedänti [Vedanti] m (Hindi; von Sanskrit vedäntin) Anhänger der vedanta-Philosophie.
vedha [Vedha] m das Durchdringen, Durchbohren.
vega [Vega] m Geschwindigkeit.
vibhT$GfJG [Vibhishana] m s. bibhi$OfJO.
vibhüti [Vibhuti] f Macht, Größe, Reichtum; übernatürliche Kraft; Asche (z. B. aus Kuhdung).
vibhüti-päda [Vibhuti Pada] m drittes Kapitel der Yoga-sütra (zu übernatürlichen Kräften).
vicära [Vichara] m Überlegung, Untersuchung, Unterschei
dung; stetige Selbstüberprüfung.
vicäraQä [Vicharana] f zweite bhümika, Stufe der Überlegung/ Unterscheidung, die zu rechtem Verhalten führt, s. bhümika. videha-mukti [Videhamukti] f Befreiung des Körperlosen bzw. körperlose Befreiung, Erlösung nach dem Tod.
vidura [Vidura] weise; m Name des jüngeren Bruders von Pär:idu und Dhrtarä?tfa.
vidyä [Vidya] f Wissen, Gelehrsamkeit, auch richtiges/spirituel
les Wissen; Meditationen aus den upanisad-s.
(mädhava) vidyära(Jya [Vidyaranya] m Verfasser der PancadasT (autoritatives Werk über advaita-vedanta) und einer Biographie Salikaräcärya-s.
vijaya [Vijaya] m Sieg.
vijayä [Vijaya] f Name von Durgä.
vijayä-dasami [Vijaya Dashami] f Feiertag zu Ehren von Durgä, Abschluss von navaratra.
vijfiäna [Vijnana] n Wissen, Intelligenz.
vijfiäna-maya-kosa [Vijnanamaya Kosha] min aus Intelligenz gemachte Körperhülle.
vikalpa [Vikalpa] m Zweifel, Zögern, Unsicherheit; Alternative;
Unterscheidung; Phantasie, mentale Beschäftigung.
vik$epa [Vikshepa] m das Umherwerfen, Zerstreuen, Umher blicken, Ablenkung, Verwirrung.
vik$ipta [Vikshipta] im yoga: abgelenkt (aber manchmal stabil), eine der Ebenen des Geistes, s. bhümi.
viläsa [Vilasa] m Spiel, Unterhaltung, Vergnügen.
vimarsa [Vimarsha] m Überlegung, Untersuchung; in tantri scher Philosophie: Kraft der Selbstwahrnehmung, Reflektion des Absoluten im Spiegel der Wahrnehmung; Kraft, welche die Welt der Vielfalt erscheinen lässt.
vTQä [Vina] f Saiteninstrument, ind. Laute.
vipar"ita-karaQi [Viparitakarani] f Umkehrstellung, mudra im Schulterstand.
viparyaya [Viparyaya] m Umkehrung.
vipassanä [Vipassana] f (Pali) buddhistische Meditationstech nik.
vira [Viral m Held, s. virya.
virajä-homa [Viraja Homa] m Feueropfer bei der Mönchs weihe.
virät, viräj [Virat] f Körper, Universum, Welt.
virät-svarüpa [Virat Svarupa] m von der Gestalt des Univer sums: Gott in seiner Manifestation als Welt.
virocana [Virochana] m ein König der asura-s (Dämonen). virya [Virya] n Heldenhaftigkeit, Energie, (männliche) Kraft, Samenflüssigkeit.
visi!?tadvaita [Vishishtadvaita] n qualifizierter Monismus, von Rämänuja vertretene vi?r:iuitische Philosophie, in der die Welt und die Gestalt Gottes für ebenso real wie das brahman ange sehen werden.
Vi$QU [Vishnu] meiner der Hauptgötter des Hinduismus; einer der 'Gruppe der drei Gestalten', der Erhalter; s. trimürti.
Vi$QU-granthi [Vishnu Granthi] m 'Vi?r:iu-Knoten', Energie blockade im anahata-cakra.
visuddha-cakra [Vishuddha Chakra] n 'reines' cakra, fünftes der Haupt-cakra-s, Kehl-cakra.
visva [Vishva] alle(s), n Universum, (ganze) Welt.
visvä-mitra [Vishvamitra] m r!?i, Verfasser des dritten mar_u;lala
des Rg-veda; im Epos: königlicher Weiser.
visva-prema [Vishvaprem] min (Hindi; von Sanskrit visva-pre man) Liebe für alles, kosmische Liebe.
visva-rüpa [Vishvarupa] n kosmische Gestalt.
vitthala [Vitthala] m Form Vi�r:iu-s, Gott von Par:ic;lharpür (Mahärä?tra).
viveka [Viveka] m Unterscheidung; Kraft, Realität von Illusion zu unterscheiden.
vivekacüc;fämaQi [Vivekachudamani] m Kronjuwel der Unter scheidung: ein Salikaräcärya zugeschriebenes Werk. vivekänanda [Vivekananda] m einer der Begründer des Neo hinduismus (1863-1902), machte advaita-vedanta im Westen bekannt.
vivekT[Viveki] m (Hindi; von Sanskrit vivekin) jemand, der durch Unterscheidungskraft charakterisiert ist.
vraja [Vraja] m Menge, Gruppe; Kuhstall; Name einer Region südl. von Delhi, wo Kr?r:ia gelebt haben soll.
vrata [Vrata] min Gelübde.
V(k$a [Vriksha] m Baum.
vrk$äsana [Vrikshasana] n Baumstellung.
vrndavana [Vrindavan] n Name eines Pilgerorts, der als Stätte von Kr?r:ia-s Jugend gilt.
vrscika [Vrishchika] m Skorpion.
vrscikäsana [Vrishchikasana] n Skorpionstellung.
v.rtti [Vritti] f u. a. Aktion, Bewegung, Modifikation.
vyabhicära [Vyabhichara] m Abweichung; Übertretung; Un treue.
vyabhicäriQT [Vyabhicharini] etwas Feminines, das abweicht:
z. B. eine untreue Frau.
vyabhicäriQi-bhakti [Vyabhicharini Bhakti] f inkonstante, vorü bergehende bhakti.
vyäna [Vyana] m einer der fünf Haupt-pr6Qa-s, durchdringt den Körper in alle Richtungen; verantwortlich für Blutkreislauf. vyasa [Vyasa] m mythischer Weiser, Großvater der Kaurava-s und Pär:ic;lava-s; ihm wird zugeschrieben: Aufteilung der veda-s, Verfasserschaft von Mahäbhärata, puraQa-s, Brahma-sütra-s. vya!?ti [Vyashti] f Individualität; ein Ganzes, das aus vielen ein zelnen Elementen besteht; Gott im Einzelnen.
vyavahära [Vyavahara] m Verhalten, Transaktion, Sitte, feste Regel.
y
yadava [Yadava] m Nachkomme Yadu-s, Bez. Kr?r:ia-s.
yajna [Yajna] m Opfer.
yäjnavalkya [Yajnavalkya] m Name eines Weisen aus der Brhadärar:iyaka-upani?ad; Name eines Gesetzgebers.
yajur-veda [Yajur Veda] m 'der in den Opfersprüchen bestehen de veda', einer der vier veda-s.
yak$a [Yaksha] m halbgöttliches Wesen.
251
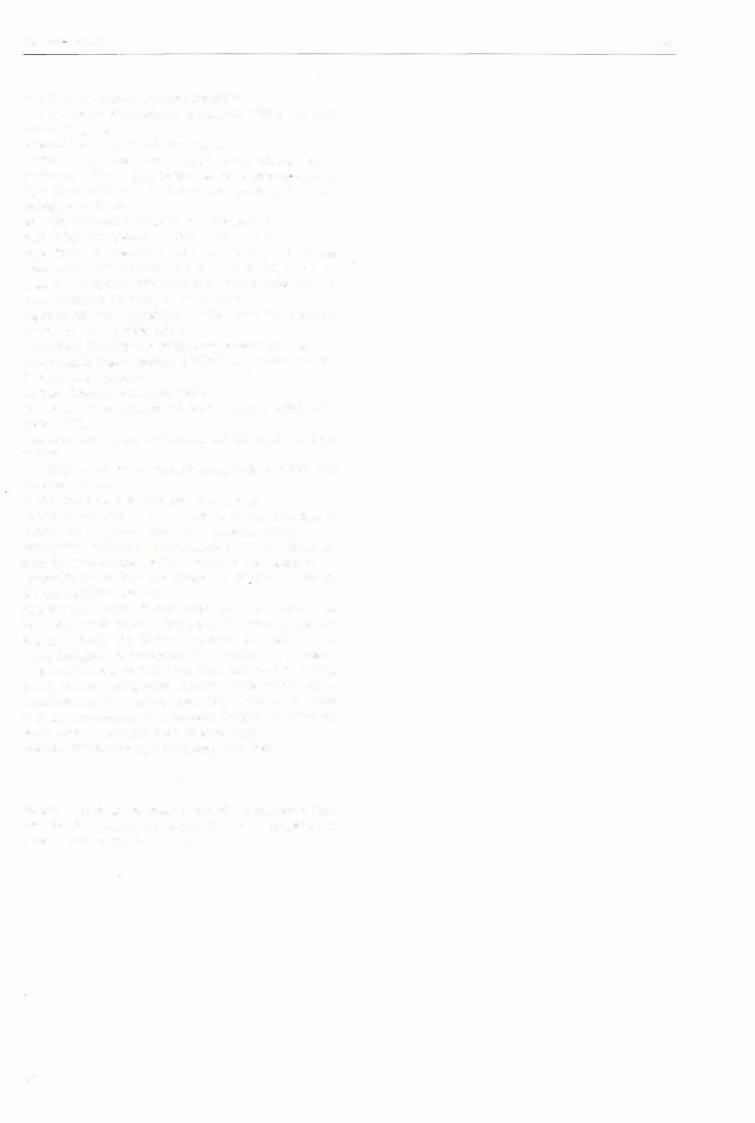
Sanskrit Glossar yarp
yaf/1 [Yam] bija-mantra des anähata-cakra.
yama [Yama] m Kontrollieren; ethische/rel. Pflicht; Name des Todesgottes, usw.
yamunä [Yamuna] f Fluss in Nordindien .
yantra [Yantra] n Instrument; magische geometrische Figur. yantra-yoga [Yantra Yoga] m Variante des kur:,cjalinT yoga, bei dem durch püjä und Meditation über yantra-s die innere Energie erweckt wird.
yasasvinT [Yashasvini] feine der zehn Haupt-näcjT-s.
yasodä [Yashoda] J Name der Ziehmutter Kr$r:ia-s.
yaga [Yoga] m Anschirren, Joch, Verbindung, Vereinigung, Praxis usw.; neuerlich auch interpetiert als Einheit, Harmonie; eines der klassischen Philosophiesysteme; meditativer Zustand ohne Gedanken; Übungen, die dahin führen.
yoga-sütra(s) [Yoga Sutra(s)] n grundlegender Text des yoga,
verfasst von Patafijali (ca. 350 n. Chr.).
yaga-tattva [Yogatattva] n Realität, wahre Natur des yoga. yaga-väsi$tha [Yoga Vasishtha] n VälmTki zugeschriebener Text über Erlösung und yoga.
yogägni [Yogagni] m Feuer des yoga.
yagänanda [Yogananda] m ind. yogT, Philosoph, Schriftsteller (1893-1952).
yagesvara [Yogeshvara] m Herr, Meister des yoga; Bez. Siva-s und Vi$1)U-s.
yogT [Yogi] m (Hindi; von Sanskrit yogin) Vollendeter im oder
Übender des yoga.
yogini[Yogini] fweiblichesGegenstück zu yogT.
yoni [Yoni] m/J Mutterschoß, weibliches Geschlechtsorgan (in
yantra-s oft nach unten zeigendes Dreieck); Ursprung.
yoni-mudrä [Yoni Mudra] f Fingerposition, bei der mittels der zehn Finger die Energie der fünf Sinne nach innen gekehrt wird. yudhi$thira [Yudhishthira] m ältester der Pänc,Java-s; steht für rechtes/rechtliches Verhalten.
yuga [Yuga] n Zeitalter, Periode. yuga bezieht sich insbesonde re auf die vier Weltalter: 1. krta-yuga, die vollkommenste und längste Periode. Die Erscheinungsweise von Reinheit und Tugendhaftigkeit; 2. tretä-yuga, hier beginnen sich langsam Eigenschaften, wie Bosheit, Lüge, Zorn, Leidenschaft, Betrug, Roheit, Gewalt, Furcht, Sorge, Kummer, Unwissenheit usw. zu manifestieren; 3. dväpara-yuga, hier nehmen all diese Zustände noch stärker zu. 4. kali-yuga (Zeitalter des Streites), hier dominieren alle schlechten Eigenschaften.
yukti [Yukti] fVerbindung, Anwendung, Plan, Trick.
z
Zarathustra m persischer Religionsstifter (1. Jahrtausend v. Chr.). Zend Avesta Schriften und Kommentare des Zoroastrismus, teilweise verfasst von Zarathustra.
252

\

- - --- - - ----------
YOGALEHRER/IN SEIN, MEINE BERUFUNG
Bei YOGA VI DYA lehren wir den ganzheitlichen Yoga in der Tradition von Swami Sivananda, Swami Vishnu-devananda und Sukadev Bretz
Eine Yogalehrer/innenausbildung kommt zuallererst dir selbst zugute und das, was du daraus gewinnst, wirst du mit anderen teilen wollen ...
Yoga zu unterrichten ist eine erfüllende, verantwortungsvolle Aufgabe. Ein/e Yogalehrer/in braucht dafür eine solide Basis eigener Yogapraxis und genaue Kenntnis der Yogaübungen und Unterrichtstechniken.
Die durch deine Praxis erweckte Lebensenergie (prär:,a) schenkt dir die Ausstrahlung, die für eine/n Yogalehrer/in so wichtig ist. Sie hilft dir auch, die ideale des Yoga im Alltag zu leben.
Die verschiedenen Ausbildungsvarianten bei YOGA VI DYA bereiten dich darauf gründlich in Theorie und Praxis vor. Sie machen dich mit den verschiedenen Yogawegen vertraut.
Bei der YOGA VI OVA-Ausbildung lernst du, kompetent Yoga zu unterrichten, Teilnehmer an zuleiten und zu inspirieren.